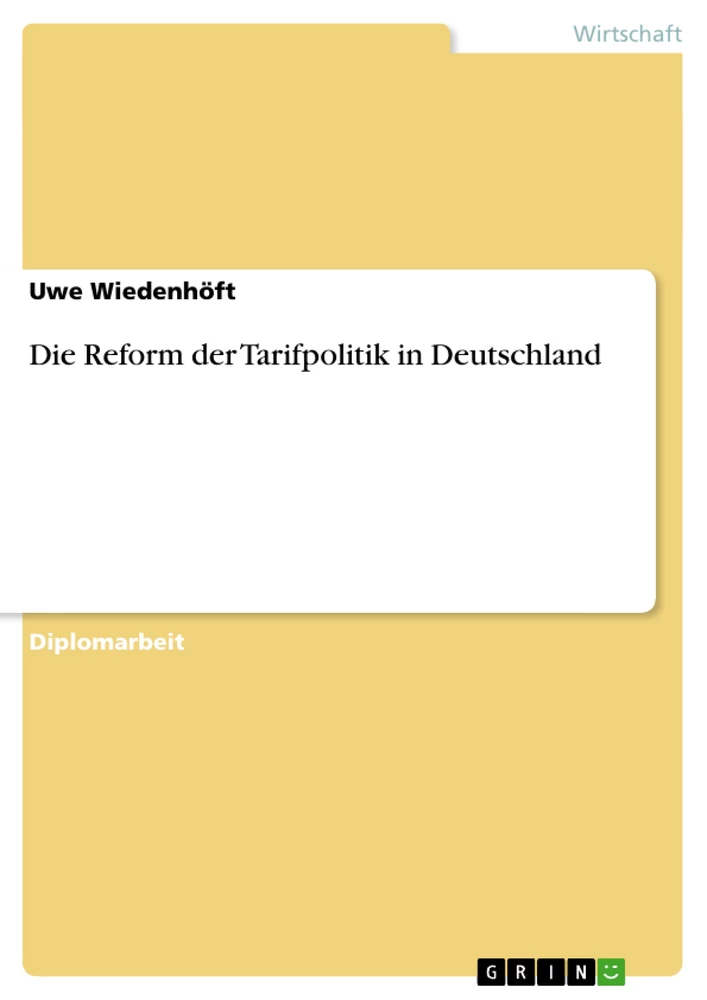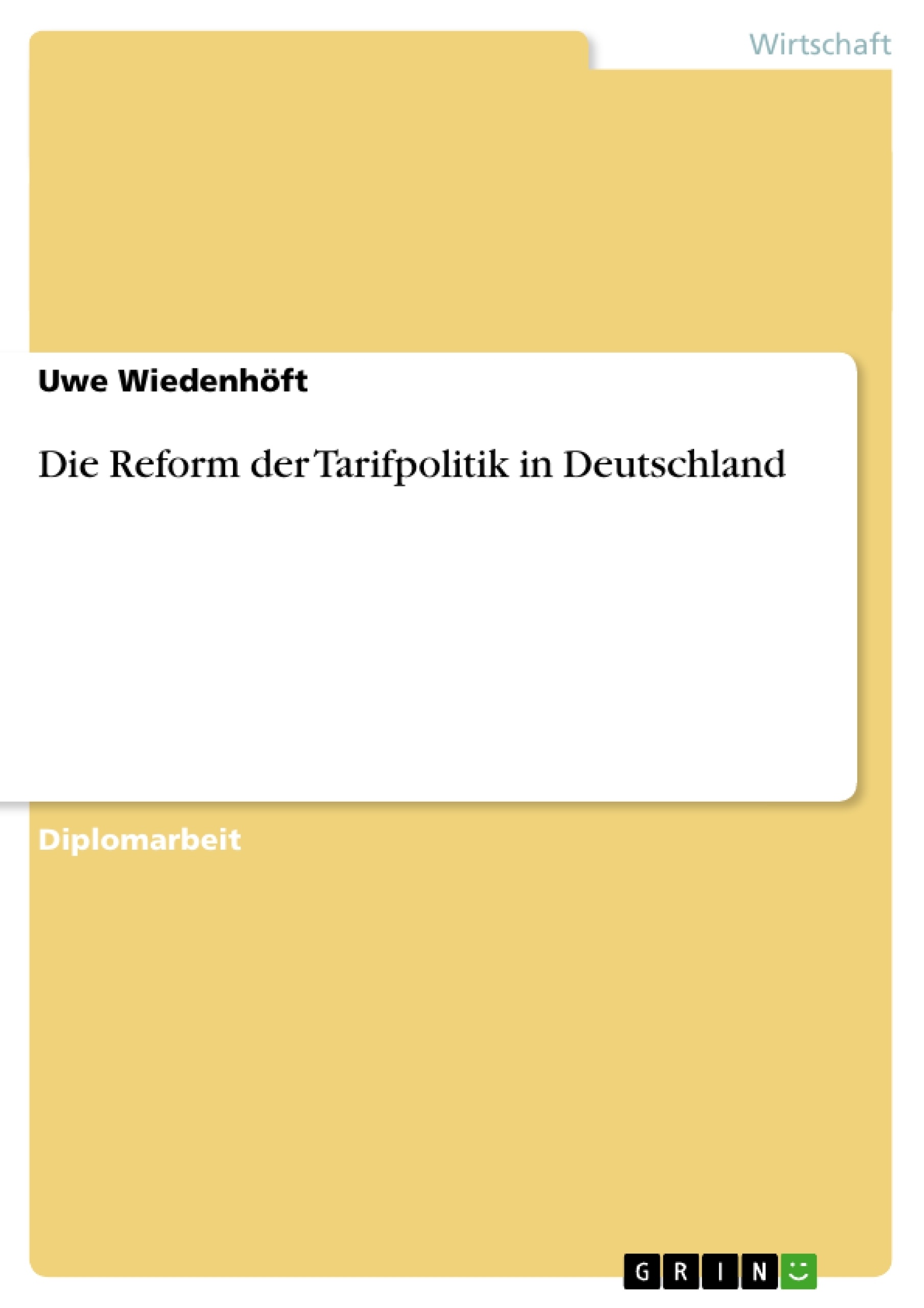Nach dem zweiten Weltkrieg erschuf die Gründergeneration der Bundesrepublik Deutschland, getrieben von dem Wunsch, Wirtschaft und Politik sowie Wirtschaft und Staat voneinander unabhängig zu machen, ein System, dass es den großen gesellschaftlichen Gruppierungen erlaubte, Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen selbst auszugestalten. Durch Teilung der Kompetenzen bekamen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zukünftig jene Freiheiten zugestanden. Das System der Tarifautonomie in seiner jetzigen Form entstand. Einige Jahrzehnte hindurch war dieses Modell Garant wirtschaftlichen Aufschwungs und wurde vor allem wegen seiner friedensstiftenden Funktion gelobt. Unter Rechtfertigungsdruck geriet es Anfang der neunziger Jahre. Globalisierung und verschärfter internationaler Wettbewerbsdruck, gepaart mit Massenarbeitslosigkeit und strukturellen Problemen des Standorts Deutschland stellten es zunehmend in Frage. In Wirtschaft und Politik begann eine Debatte um die Grundstrukturen des deutschen Tarifsystems, die bis heute andauert.
Kritikpunkte bildeten sich hauptsächlich drei heraus:
•Undifferenziertheit, erkennbar an einer bloßen Orientierung an Branchen und Regionen einerseits und einer weitgehende Gleichbehandlung von Arbeitnehmergruppen andererseits,
•Inflexibilität, die sich vor allem in der ungenügenden Anpassungsfähigkeit des Systems an veränderte Bedingungen zeigt und schließlich noch,
•die durch zu hohe Arbeitskosten bedingte Kostenintensivität des Systems.
Obwohl aus einigen Teilen der Wirtschaft und Politik Stimmen laut wurden, die aufgrund dieser Zustände eine vollständige Abschaffung dieses Tarifsystems zugunsten betrieblicher Regelungen fordern, blieb das jetzige System um den Verbandstarifvertrag (VTV) bis zum heutigen Tag prägende Ordnungsgröße deutscher Arbeitsbeziehungen. Unbestritten bleibt allerdings die mehrheitliche Meinung, dass die Tarifstruktur in Deutsch- land verkrustet sei und einer grundlegenden Reform bedarf. Professor Franz, Mitglied des
- 6 -Sachverständigenrats unterstrich diese verbreitete Anschauung einst mit folgendem Zitat: „Der Flächentarifvertrag ist nicht überholt, aber er ist dringend überholungsbedürftig.“ Tatsache ist dabei aber auch, dass sich das Tarifsystem seit nunmehr rund fünfzehn Jahren in einem stetigen Wandelprozess befindet und sich den Reformerfordernissen zu stellen versucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Vorgehensweise
- 1.3 Die Transaktionskostentheorie
- 2 Das Tarifvertragssystem in Deutschland - Begriffserklärungen
- 2.1 Rechtsgrundlagen und Aufbau
- 2.2 Die Tarifvertragsparteien
- 3 Das Problemfeld Verbandstarifvertrag
- 3.1 Einordnung in den Rahmen des Tarifvertragssystems
- 3.2 Argumente für Verbandstarifverträge
- 3.3 Verbandstarifverträge in der Kritik
- 3.4 Die Abkehr vom Tarifvertrag
- 4 Reformgedanken und Lösungsansätze der Tarifvertragsparteien
- 4.1 Öffnungsklauseln
- 4.1.1 Tarifvertragliche Öffnungsklauseln
- 4.1.2 Gesetzliche Öffnungsklauseln
- 4.1.3 Der Standpunkt der Gewerkschaften
- 4.1.4 Der Standpunkt der Arbeitgeber
- 4.1.5 Transaktionskostentheoretische Betrachtungen
- 4.2 Günstigkeitsprinzip
- 4.2.1 Neudefinition des Günstigkeitsprinzips durch reformierten Sachgruppenvergleich
- 4.2.1 Der Standpunkt der Gewerkschaften
- 4.2.2 Der Standpunkt der Arbeitgeber
- 4.3 Begleitende Reformmaßnahmen
- 4.3.1 Begrenzung der Tarifgebundenheit
- 4.3.2 Einschränkung der Nachwirkung von Tarifnormen
- 4.3.3 Tariftreuegesetz und Allgemeinverbindlichkeitserklärung
- 4.3.4 Der Standpunkt der Gewerkschaften
- 4.3.5 Der Standpunkt der Arbeitgeber
- 4.4 Änderungen im Streikrecht zur Unterstützung des Reformprozesses
- 4.4.1 Das Ungleichgewicht der Kampffähigkeit der Tarifvertragspartner
- 4.4.2 Der Standpunkt der Arbeitgeber
- 4.4.3 Der Standpunkt der Gewerkschaften
- 5 Reformen am Beispiel der Metall- und Elektroindustrie
- 5.1 Branchenüberblick und Entwicklung des VTV
- 5.2 Reaktionen, Konzepte und Gegenmaßnahmen der Verbände
- 6 Die Sichtweise der Betriebs- und Personalräte zum Wandelprozess
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Reformansätze im deutschen Tarifvertragssystem, insbesondere im Hinblick auf den Verbandstarifvertrag. Ziel ist es, die verschiedenen Standpunkte der Tarifvertragsparteien und die damit verbundenen Problemfelder zu analysieren und mögliche Lösungsansätze zu beleuchten.
- Analyse des deutschen Tarifvertragssystems und seiner Rechtsgrundlagen
- Bewertung der Vor- und Nachteile von Verbandstarifverträgen
- Untersuchung von Reformvorschlägen wie Öffnungsklauseln und Änderungen des Günstigkeitsprinzips
- Beurteilung der Rolle der Betriebs- und Personalräte im Wandelprozess
- Fallstudie der Metall- und Elektroindustrie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung bezüglich der Flexibilität von Tarifverträgen und die Zielsetzung der Arbeit. Es skizziert die Vorgehensweise und gibt einen Überblick über die verwendete Transaktionskostentheorie als analytisches Werkzeug.
2 Das Tarifvertragssystem in Deutschland - Begriffserklärungen: Dieses Kapitel erläutert die Rechtsgrundlagen und den Aufbau des deutschen Tarifvertragssystems. Es definiert wichtige Begriffe und beschreibt die Rolle der Tarifvertragsparteien (Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften) im System. Die Kapitel unterstreicht die Komplexität des Systems und legt den Grundstein für das Verständnis der nachfolgenden Problematiken.
3 Das Problemfeld Verbandstarifvertrag: Dieses Kapitel analysiert kritisch den Verbandstarifvertrag, seine Einordnung in das Tarifvertragssystem, Argumente für und gegen ihn, und die zunehmende Abkehr von diesem Modell. Es beleuchtet die Spannungsfelder zwischen einheitlicher Regelung und individualisierter Gestaltung von Arbeitsbedingungen und zeigt die Herausforderungen für die beteiligten Akteure auf.
4 Reformgedanken und Lösungsansätze der Tarifvertragsparteien: Dieses Kapitel konzentriert sich auf verschiedene Reformvorschläge, die von den Tarifvertragsparteien diskutiert werden. Es untersucht Öffnungsklauseln (tarifvertragliche und gesetzliche), die Neudefinition des Günstigkeitsprinzips, und begleitende Maßnahmen wie die Begrenzung der Tarifgebundenheit und Änderungen im Streikrecht. Die unterschiedlichen Standpunkte der Gewerkschaften und Arbeitgeber werden ausführlich dargestellt und analysiert.
5 Reformen am Beispiel der Metall- und Elektroindustrie: Dieses Kapitel bietet eine Fallstudie zur Metall- und Elektroindustrie, um die theoretischen Überlegungen aus den vorherigen Kapiteln anhand eines konkreten Beispiels zu illustrieren. Es analysiert die Entwicklung des Verbandstarifvertrags in dieser Branche und die Reaktionen der beteiligten Verbände auf die Herausforderungen des Wandels.
6 Die Sichtweise der Betriebs- und Personalräte zum Wandelprozess: Dieses Kapitel beleuchtet die Perspektive der Betriebs- und Personalräte auf die Veränderungen im Tarifvertragssystem. Es untersucht, wie sich die Reformen auf die Interessen und die Handlungsspielräume der Betriebsräte auswirken.
Schlüsselwörter
Tarifvertragssystem, Verbandstarifvertrag, Öffnungsklauseln, Günstigkeitsprinzip, Tarifautonomie, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Betriebsräte, Reform, Flexibilität, Transaktionskostentheorie, Metall- und Elektroindustrie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum deutschen Tarifvertragssystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Herausforderungen und Reformansätze im deutschen Tarifvertragssystem, insbesondere im Hinblick auf den Verbandstarifvertrag. Sie untersucht die verschiedenen Standpunkte der Tarifvertragsparteien (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände), die damit verbundenen Problemfelder und mögliche Lösungsansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das deutsche Tarifvertragssystem und seine Rechtsgrundlagen, die Vor- und Nachteile von Verbandstarifverträgen, Reformvorschläge wie Öffnungsklauseln und Änderungen des Günstigkeitsprinzips, die Rolle der Betriebs- und Personalräte im Wandelprozess und eine Fallstudie der Metall- und Elektroindustrie. Die Transaktionskostentheorie dient als analytisches Werkzeug.
Was sind die zentralen Probleme des Verbandstarifvertrags?
Die Arbeit kritisiert den Verbandstarifvertrag wegen seiner Starrheit und mangelnder Flexibilität. Sie beleuchtet die Spannungsfelder zwischen einheitlicher Regelung und individualisierter Gestaltung von Arbeitsbedingungen und zeigt die Herausforderungen für die beteiligten Akteure auf. Die zunehmende Abkehr von diesem Modell wird ebenfalls thematisiert.
Welche Reformansätze werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Reformvorschläge, darunter Öffnungsklauseln (tarifvertragliche und gesetzliche), eine Neudefinition des Günstigkeitsprinzips, die Begrenzung der Tarifgebundenheit, Änderungen im Streikrecht und die Rolle des Tariftreuegesetzes und der Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Die unterschiedlichen Standpunkte der Gewerkschaften und Arbeitgeber werden ausführlich dargestellt und analysiert.
Wie wird das Günstigkeitsprinzip behandelt?
Die Arbeit diskutiert eine mögliche Neudefinition des Günstigkeitsprinzips durch einen reformierten Sachgruppenvergleich. Die Standpunkte der Gewerkschaften und Arbeitgeber zu dieser Thematik werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Rolle spielen die Betriebs- und Personalräte?
Die Arbeit untersucht die Perspektive der Betriebs- und Personalräte auf die Veränderungen im Tarifvertragssystem und wie sich die Reformen auf deren Interessen und Handlungsspielräume auswirken.
Wie wird die Metall- und Elektroindustrie behandelt?
Die Metall- und Elektroindustrie dient als Fallstudie, um die theoretischen Überlegungen anhand eines konkreten Beispiels zu illustrieren. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Verbandstarifvertrags in dieser Branche und die Reaktionen der beteiligten Verbände auf die Herausforderungen des Wandels.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Tarifvertragssystem, Verbandstarifvertrag, Öffnungsklauseln, Günstigkeitsprinzip, Tarifautonomie, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Betriebsräte, Reform, Flexibilität, Transaktionskostentheorie, Metall- und Elektroindustrie.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit verwendet die Transaktionskostentheorie als analytisches Werkzeug, um die verschiedenen Aspekte des Tarifvertragssystems zu untersuchen und die Reformansätze zu bewerten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Standpunkte der Tarifvertragsparteien und die damit verbundenen Problemfelder zu analysieren und mögliche Lösungsansätze für ein flexibleres und effizienteres Tarifvertragssystem zu beleuchten.
- Quote paper
- Uwe Wiedenhöft (Author), 2005, Die Reform der Tarifpolitik in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44741