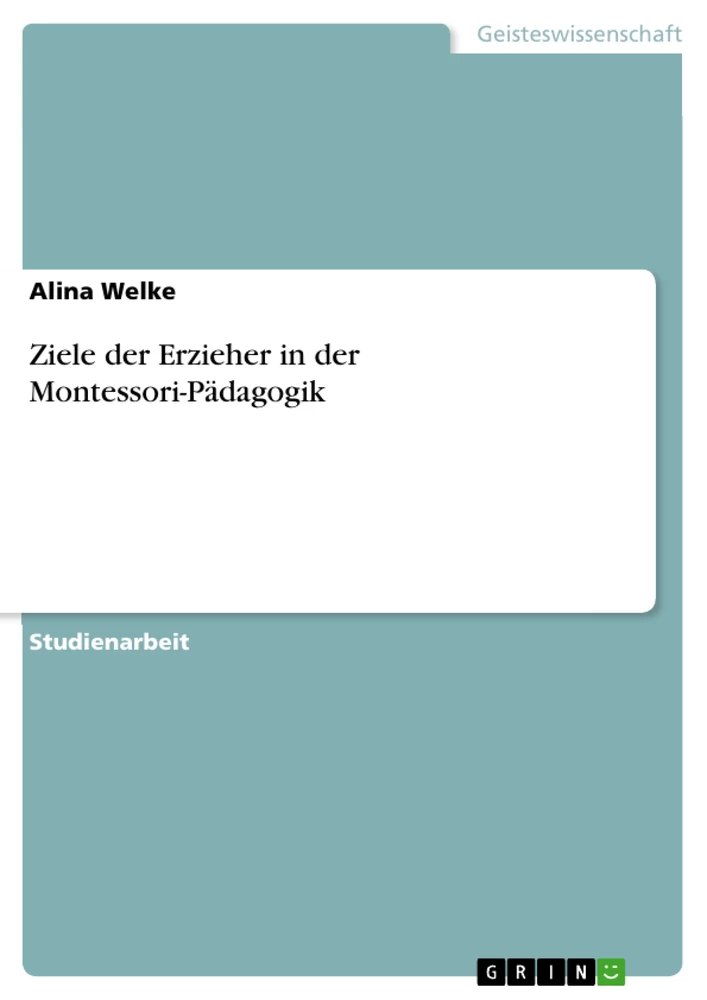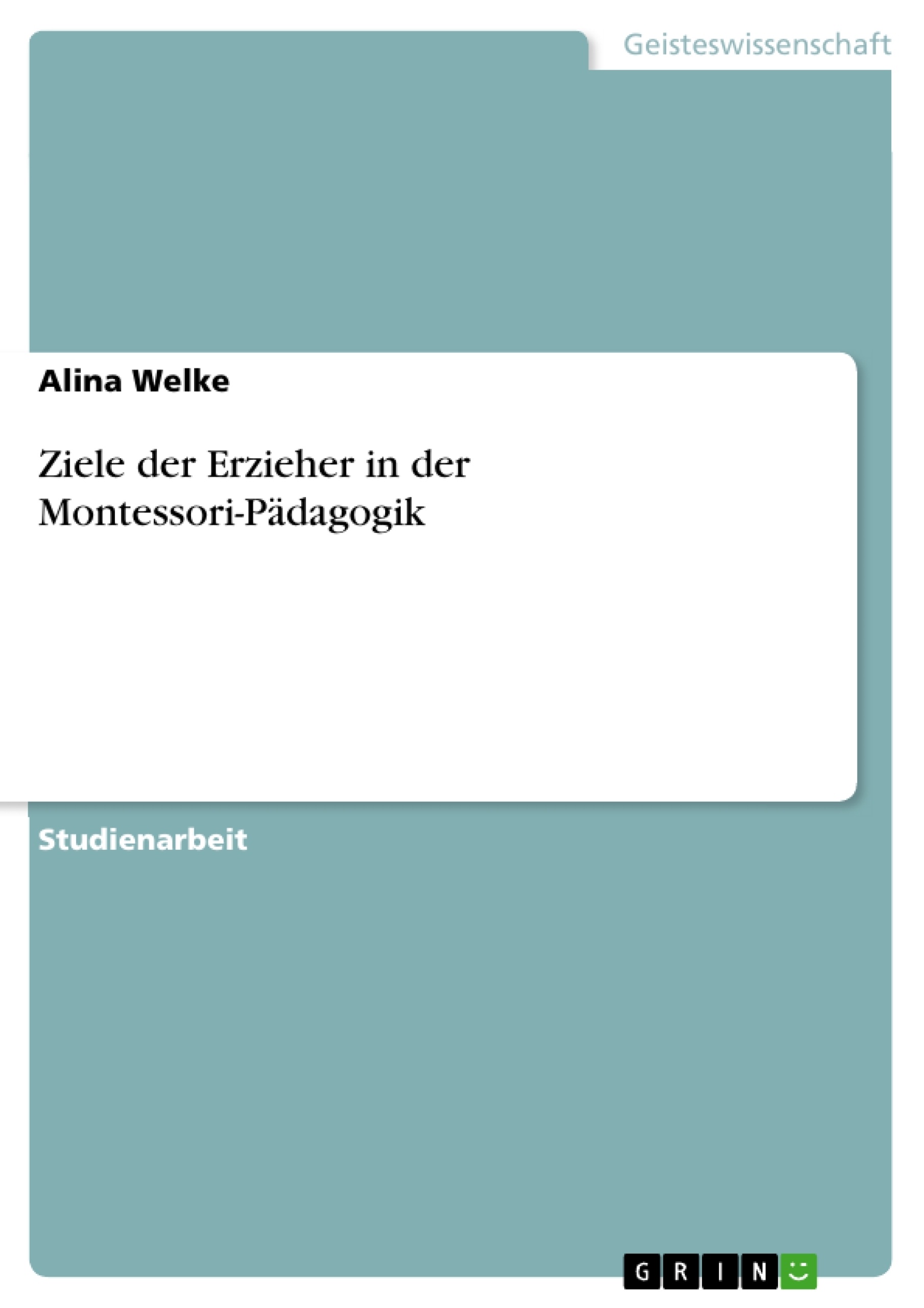In einer Zeit, in der das deutsche Schulsystem stark kritisiert wird, zerbrechen sich die Menschen den Kopf darüber, wie Schule dem Kind wieder nähergebracht werden kann und wie das Interesse der Schüler nachhaltig geweckt wird. Unterricht soll nicht länger die bloße Aneignung von Wissen oder die Erfüllung bestimmter Bildungsstandards sein, sondern vielmehr den Schüler und dessen Individualität als Ausgangspunkt berücksichtigen.
Ziel soll es daher sein, die Selbstständig- und Selbsttätigkeit sowie die Kreativität der Kinder gezielt zu fördern und nicht länger standardisierte inhaltliche Lernziele als Voraussetzung für Erfolg zu sehen. Die Förderung der Selbstständig- und Selbsttätigkeit und das daraus resultierende intrinsisch motivierte Interesse des Kindes wird ausschlaggebend für dessen Lernerfolg sein. Doch wie kann ein Kind gezielt darin unterstützt werden, zu einem mündigen, freihandelnden und selbstständigen Individuum heranzuwachsen? Genau dieser Thematik widmet sich diese Arbeit.
Beschäftigt man sich eine Zeit lang mit den verschiedenen pädagogischen Ansätzen, die sich genau dieses Ziel gesetzt haben, so wird vermutlich recht schnell der Name Maria Montessori auftauchen. Sie gilt bis heute als eine der bekanntesten Pädagoginnen der Reformpädagogik. Nicht nur sie als Person, sondern vor allem ihre Idee, veränderte die Pädagogik bedeutsam. Aus der einfachen Bitte eines Kindes – „Hilf mir, es selbst zu tun“ – entwickelt Maria Montessori ein bisher völlig fremdes Bild von Pädagogik. Sie nimmt gezielt das Kind mit all seinen Bedürfnissen und seiner eigenen Persönlichkeit in den Blick und baut ihren reformpädagogischen Ansatz darauf auf.
Ihr Konzept wird bis heute in zahlreichen Kindergärten und Schulen umgesetzt. Konkret gibt es aktuell in Deutschland über 1000 Montessori-Einrichtungen, davon ca. 600 Kindergärten und über 400 Schulen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Maria Montessori
- Zur Person Maria Montessori
- Maria Montessoris Bild vom Kind
- Grundgedanken der Montessoripädagogik
- Rolle der Erzieher in der Montessoripädagogik
- Die Ziele der Montessoripädagogik
- Vergleich zwischen Zielen der Erzieher in den Bildungsgrundsätzen und der Montessoripädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Montessoripädagogik und untersucht insbesondere die Rolle der Erzieher in diesem pädagogischen Ansatz. Sie analysiert die zentralen Ziele und Grundgedanken von Maria Montessoris Konzept und stellt sie in den Kontext aktueller pädagogischer Debatten.
- Die Lebensgeschichte und Philosophie Maria Montessoris
- Das Bild vom Kind in der Montessoripädagogik
- Die Rolle des Erziehers als Begleiter und Unterstützer der kindlichen Entwicklung
- Die Ziele der Montessoripädagogik im Vergleich zu den Bildungsgrundsätzen
- Die Bedeutung der Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit im Montessorianischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle Kritik am deutschen Schulsystem vor und führt in die Thematik der Montessoripädagogik ein. Sie betont die Bedeutung von Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit für die kindliche Entwicklung.
- Maria Montessori: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Leben und die zentralen Ideen der Pädagogin Maria Montessori. Es beleuchtet ihre Rolle als Ärztin und ihre Entwicklung des Montessorianischen Ansatzes.
- Grundgedanken der Montessoripädagogik: Dieser Abschnitt befasst sich mit den grundlegenden Prinzipien der Montessoripädagogik und legt dabei den Fokus auf die Rolle des Erziehers.
- Die Ziele der Montessoripädagogik: Dieses Kapitel fasst die Ziele der Montessoripädagogik zusammen und stellt sie in Bezug zu den Bildungsgrundsätzen.
Schlüsselwörter
Maria Montessori, Montessoripädagogik, Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit, Erzieherrolle, Bildungsgrundsätze, sensiblen Phasen, absorbierender Geist, „Hilf mir, es selbst zu tun“, Casa dei bambini.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernmotto der Montessori-Pädagogik?
Das bekannteste Motto lautet: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Es unterstreicht das Ziel der Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit des Kindes.
Welche Rolle nimmt der Erzieher bei Montessori ein?
Der Erzieher ist kein klassischer Lehrer, sondern ein Begleiter und Beobachter, der die Umgebung vorbereitet und das Kind in seiner individuellen Entwicklung unterstützt.
Was bedeutet der Begriff „absorbierender Geist“?
Maria Montessori beschrieb damit die Fähigkeit des Kindes, Informationen und Eindrücke aus seiner Umwelt mühelos und ganzheitlich aufzunehmen.
Was sind „sensible Phasen“?
Es sind bestimmte Zeitfenster in der Entwicklung eines Kindes, in denen es eine besondere Empfänglichkeit für das Erlernen spezifischer Fähigkeiten (z.B. Sprache, Ordnung) besitzt.
Wie viele Montessori-Einrichtungen gibt es in Deutschland?
Aktuell gibt es in Deutschland über 1000 Einrichtungen, darunter etwa 600 Kindergärten und über 400 Schulen.
- Citar trabajo
- Alina Welke (Autor), 2017, Ziele der Erzieher in der Montessori-Pädagogik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446354