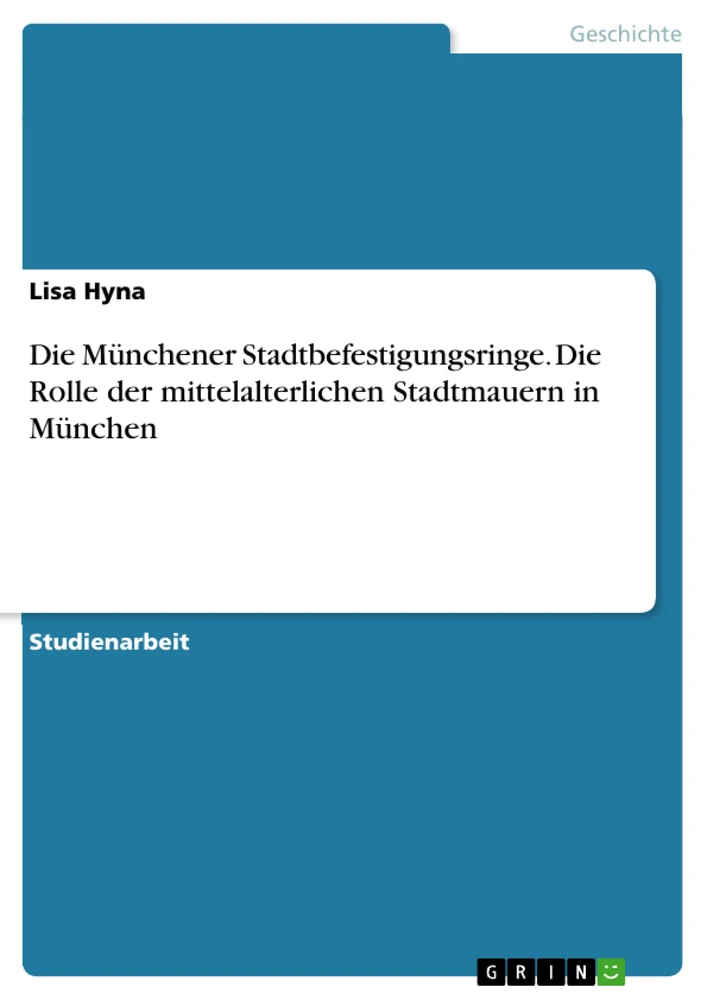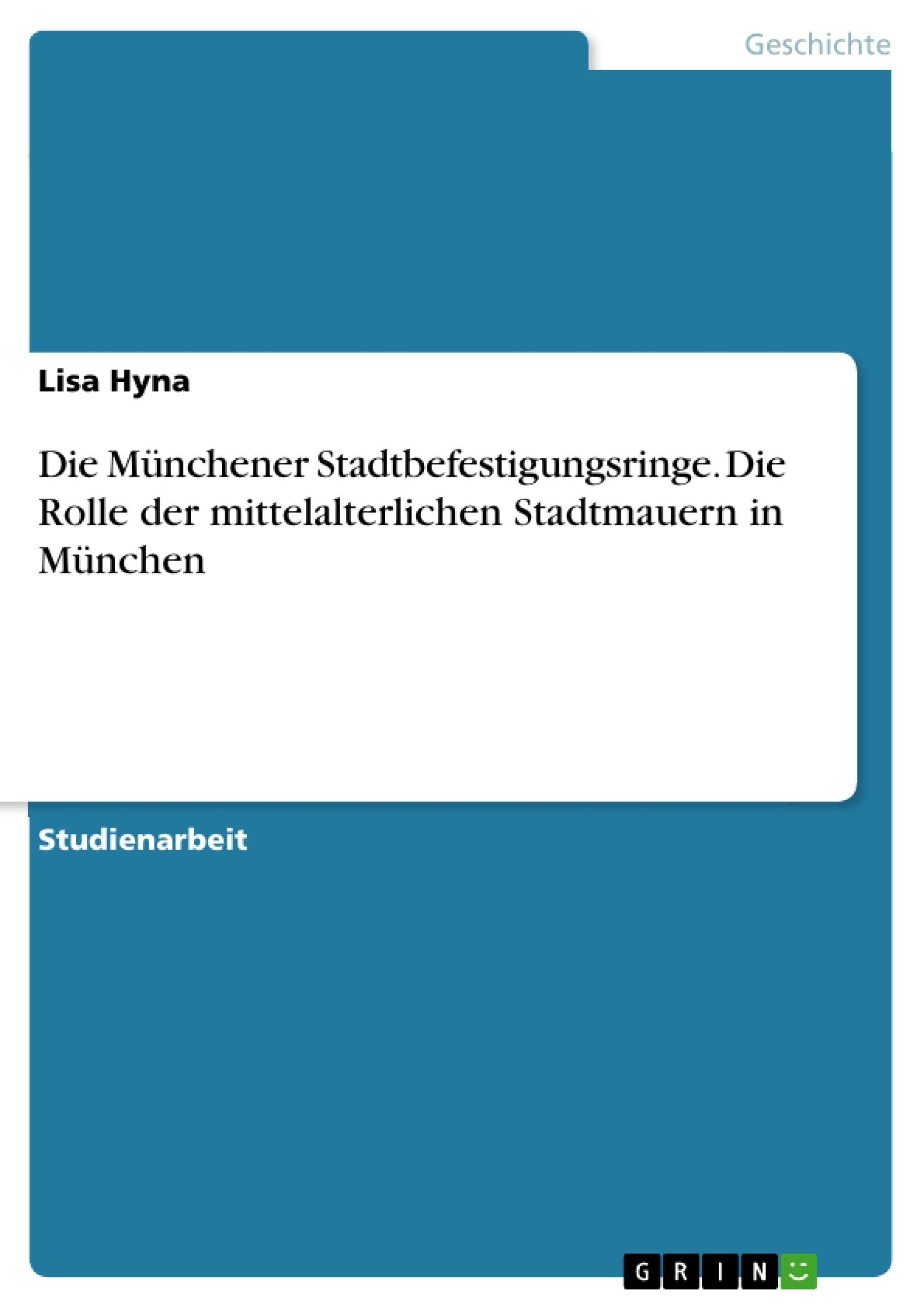Freimut Scholz nutzt in seinem Text "Vom Marktflecken zur Residenzstadt 1158 – 1800" die Bauzeiten der Münchner Stadtbefestigungsringe als Anhaltspunkte für eine zeitliche Unterteilung der frühen Entwicklung der Stadt München.
Die ersten 600 Jahre Stadtgeschichte bis in die Neuzeit hinein lassen sich seiner Meinung nach in drei Schritten zusammenfassen, die sich alle an der baulichen Entstehung und Weiterführung der Mauerringe orientieren. Den ersten Abschnitt bilde dabei die Gründung der Stadt 1158 bis zum Bau der ersten Stadtmauer. Die Erweiterung der Stadtfläche bis zur weitgefassten Vergrößerung durch den Bau der zweiten Stadtmauer im 13. und 14. Jahrhundert, bestimme den zweiten Zeitabschnitt der Geschichte Münchens.
Die Ausdehnung zur Residenzstadt, die schon nicht mehr im Mittelalter, sondern in der frühen Neuzeit stattfand, mache den dritten zeitlichen Rahmen des Wachstums Münchens aus. Durch die Ausrichtung dieser Einteilung anhand der Münchner Stadtbefestigungen stellen diese also einen wichtigen Bestandteil der Wachstumsentwicklung der Stadt dar.
Offen bleibt dabei, welche Rolle die ersten Stadtmauern Münchens im mittelalterlichen Stadtleben spielten und inwiefern sie das Stadtbild beeinflussten. Um dies heraus zu arbeiten soll in der folgenden Arbeit der geschichtliche Hintergrund in Form der Herrschaftsverhältnisse betrachtet werden, sowie deren Einflussnahme auf die Stadt. Zudem sollen das Wirken zwischen Stadt und Mauer im Zusammenspiel vorgestellt werden und damit die Bedeutung der Stadtbefestigung für Bürger und Stadtbild dargelegt werden.
Ausgerichtet sind die Ergebnisse hauptsächlich an den Forschungsständen von Freimut Scholz und Fridolin Solleder. Der "Chronik der Stadt München" von Helmuth Stahleder und Michael Schattenhofers Bericht "Im Spiegel der Jahrhunderte" wurden einige Quellen entnommen und analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bauliche Beschaffenheit der Stadtmauern Münchens
- Die erste Stadtmauer
- Beschaffenheit
- Standort
- Die zweite Stadtmauer
- Beschaffenheit
- Hohe Beständigkeit
- Der Zwingerbau
- Die erste Stadtmauer
- Herrschaftsverhältnisse in den Zeiten des Mauerbaus
- Stadtgründung unter Heinrich dem Löwen
- München unter den Freisinger Bischöfen
- Pfalzgraf Otto I. als erster Wittelsbacher Herrscher
- Ludwig der Strenge setzt Grundstein für zweite Stadtmauer
- Beschluss zum Zwingerbau durch Bayerische Herzöge
- Stadt und Mauer im Zusammenspiel
- Vorgesehener Schutz
- Strenge Plandurchführung
- Ausmaße der Stadterweiterung
- Langer Bestand des Erweiterungsgebietes
- Bürgertum
- Erhalt der Mauer als wichtiger Bestandteil des Stadtlebens
- Heranziehen der Bürger zu Bau und Finanzierung
- Finanzierung des Zwingerbaus als Belastung
- Auswirkungen der Mauern auf das Münchener Stadtbild
- Unterstützung der Herzöge
- Beitrag der Mauern zum Ansehen der Stadt
- Stadtmauern als Aushängeschild Münchens
- Die Stellung der mittelalterlichen Stadtbefestigung in der Stadtgeschichte Münchens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Vom Marktflecken zur Residenzstadt 1158 – 1800“ analysiert die Entwicklung der Stadt München anhand der baulichen Entstehung und Erweiterung ihrer Stadtbefestigungen. Das Hauptziel ist es, die Rolle der mittelalterlichen Stadtmauern in der frühen Stadtgeschichte aufzuzeigen, insbesondere hinsichtlich ihres Einflusses auf das Stadtbild und das Stadtleben.
- Die bauliche Beschaffenheit der Münchner Stadtmauern
- Die Herrschaftsverhältnisse in den Zeiten des Mauerbaus
- Das Zusammenspiel zwischen Stadt und Mauer im Hinblick auf Schutz und Stadtentwicklung
- Die Auswirkungen der Mauern auf das Münchener Stadtbild und das Ansehen der Stadt
- Die Bedeutung der mittelalterlichen Stadtbefestigung in der Gesamtgeschichte Münchens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Textes skizziert den Rahmen der Analyse, die sich auf die drei Bauphasen der Münchner Stadtmauern fokussiert. Kapitel 2 beschreibt die bauliche Beschaffenheit der ersten und zweiten Stadtmauer, einschließlich ihrer Konstruktion, Standorte und Besonderheiten. Kapitel 3 widmet sich den Herrschaftsverhältnissen in München während der jeweiligen Bauzeiten. Es werden die Rollen von Heinrich dem Löwen, den Freisinger Bischöfen und den Wittelsbacher Herzögen beleuchtet, sowie deren Einfluss auf die Entwicklung der Stadtbefestigung. Kapitel 4 analysiert das Zusammenspiel zwischen Stadt und Mauer, wobei die Schutzfunktion der Stadtbefestigung, die strenge Plandurchführung der Stadterweiterung und die Beteiligung der Bürger am Bau und der Finanzierung der Mauern untersucht werden. Kapitel 5 erörtert die Auswirkungen der Mauern auf das Münchener Stadtbild, insbesondere die Bedeutung der Stadtbefestigung für das Ansehen der Stadt und die Förderung der Entwicklung Münchens zu einer bedeutenden Residenzstadt. Abschließend betrachtet Kapitel 6 die Stellung der mittelalterlichen Stadtbefestigung in der Gesamtgeschichte Münchens und betont die Bedeutung der Mauern für das Wachstum, den Schutz und das Selbstverständnis der Stadt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Stadtmauern, Stadtbefestigung, München, mittelalterliche Stadtgeschichte, Stadtentwicklung, Herrschaftsverhältnisse, Schutz, Stadtbild, Bürgertum, Ansehen, Residenzstadt.
- Quote paper
- Lisa Hyna (Author), 2011, Die Münchener Stadtbefestigungsringe. Die Rolle der mittelalterlichen Stadtmauern in München, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444239