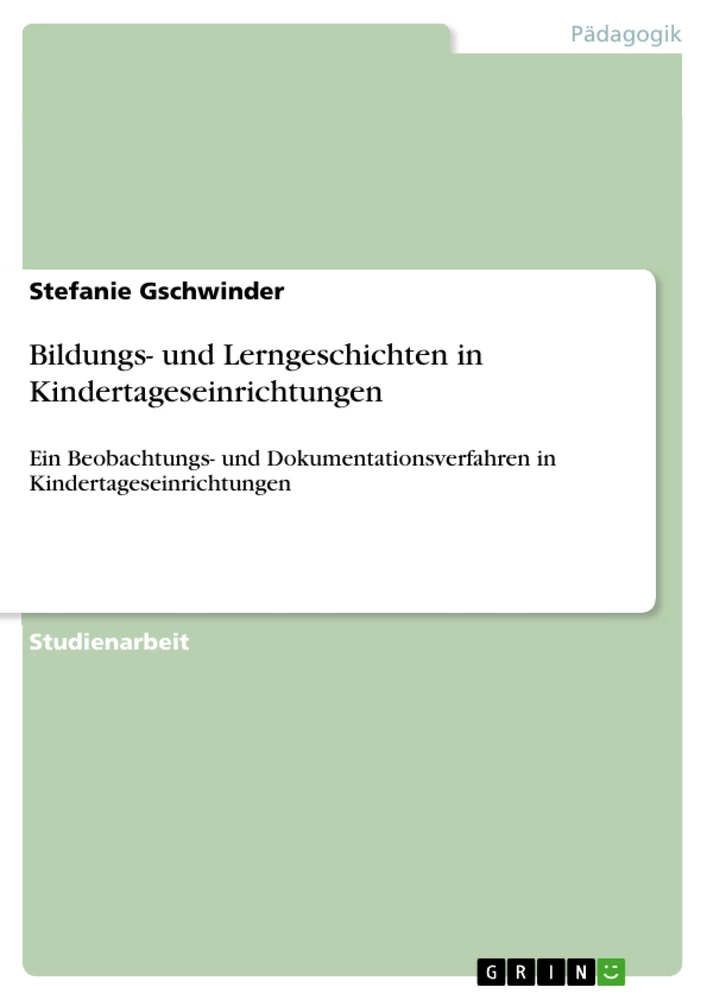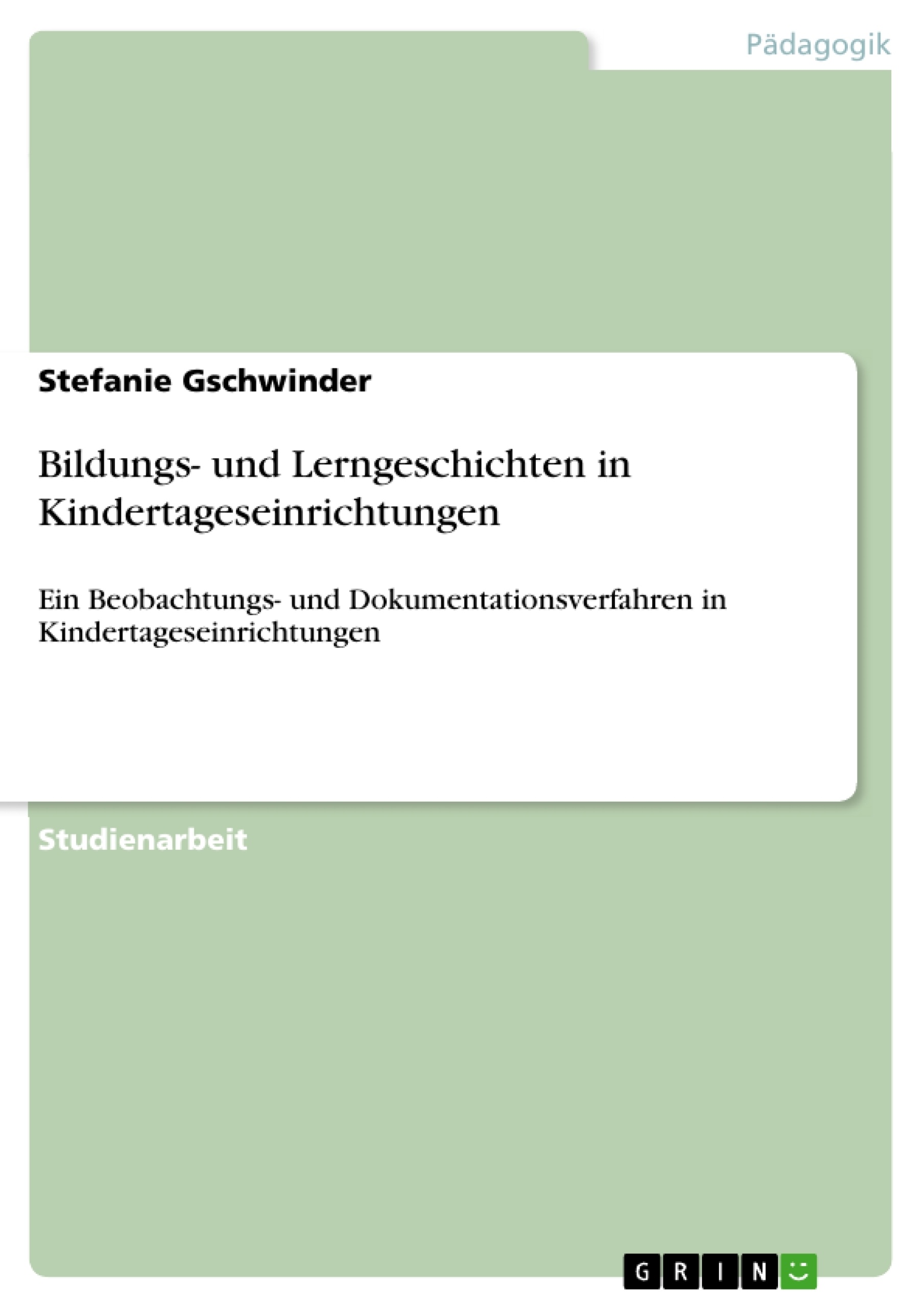In dieser Hausarbeit wird detailliert das Konzept dieses Beobachtungsverfahren dargestellt. Dabei stellt sich die Frage, ob Bildungs- und Lerngeschichten als alleiniges Beobachtungsverfahren angewendet werden können, und ob alle Entwicklungsbereiche der Kinder abgedeckt werden oder diese Ergänzungen benötigen.
Im Rahmen des Projekts „Bildungs- und Lerngeschichten“ wurde von 2004 bis 2007 vom Deutschen Jugendinstitut das in Neuseeland entwickelte Verfahren der „learning stories“ adaptiert und an die Voraussetzungen der Kindertageseinrichtungen in Deutschland angepasst. Hinter diesem Verfahren steht die Beobachtung des kindlichen Lernens, seine Beschreibung und darauf aufbauend der pädagogische Auftrag dieses zu unterstützen und zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Thematik
- 2. Bildungs- und Lerngeschichten
- 2.1 Ursprung der Bildungs- und Lerngeschichten
- 2.2 Eigenschaften von Bildungs- und Lerngeschichten
- 2.3 Ziele der Bildungs- und Lerngeschichten
- 3. Lerndispositionen
- 4. Arbeitsschritte der Bildungs- und Lerngeschichten
- 4.1 Erster Schritt: Das Beobachten und Beschreiben
- 4.2 Zweiter Schritt: Die Analyse und der Austausch der Beobachtung
- 4.3 Dritter Schritt: Die Entscheidung über nächsten Schritte
- 4.4 Vierter Schritt: Die Dokumentation
- 5. Haltungen und Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte
- 6. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten als Beobachtungsverfahren in Kindertageseinrichtungen. Ziel ist es, die Methode detailliert darzustellen und deren Anwendbarkeit und Grenzen zu beleuchten. Dabei wird insbesondere die Frage nach der alleinigen Anwendbarkeit und der Abdeckung aller Entwicklungsbereiche untersucht.
- Ursprung und Entwicklung der Bildungs- und Lerngeschichten
- Eigenschaften und Ziele des Verfahrens
- Praktische Anwendung und Arbeitsschritte
- Haltungen und Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in die Thematik: Die Einleitung beleuchtet den Kontext der Entstehung von Bildungsplänen in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Zusammenhang mit den Ergebnissen der PISA-Studie. Sie hebt die zunehmende Bedeutung der frühkindlichen Bildung hervor und führt in das Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten als Dokumentationsverfahren ein. Es werden die Forschungsfragen formuliert, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen, nämlich die alleinige Anwendbarkeit und die Abdeckung aller Entwicklungsbereiche der Kinder durch dieses Verfahren.
2. Bildungs- und Lerngeschichten: Dieses Kapitel beschreibt den Ursprung der Bildungs- und Lerngeschichten in Neuseeland, ausgehend vom Curriculum „Te Whariki“. Es werden die Eigenschaften dieses offenen Beobachtungs- und Dokumentationsverfahrens erläutert, das den Fokus auf die individuellen Lernqualitäten des Kindes legt und dessen Entwicklung ohne vorgefertigte Leistungskriterien beurteilt. Die Ziele des Verfahrens werden detailliert dargestellt, um ein Verständnis für die einzigartigen Lernqualitäten jedes Kindes aufzubauen und seine selbstbestimmte Mitwirkung am sozialen Miteinander zu fördern.
Schlüsselwörter
Bildungs- und Lerngeschichten, frühkindliche Bildung, Beobachtung, Dokumentation, Lernprozesse, Te Whariki, Neuseeland, pädagogische Fachkraft, Entwicklungsverfahren, individuelle Lernqualitäten.
Häufig gestellte Fragen: Bildungs- und Lerngeschichten
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht detailliert das Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten als Beobachtungsverfahren in Kindertageseinrichtungen. Sie beleuchtet den Ursprung, die Eigenschaften, die Ziele und die praktische Anwendung der Methode. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, ob das Verfahren allein ausreichend ist und alle Entwicklungsbereiche von Kindern abdeckt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Ursprung und die Entwicklung der Bildungs- und Lerngeschichten (insbesondere in Bezug auf das neuseeländische Curriculum „Te Whariki“), die Eigenschaften und Ziele des Verfahrens, die praktischen Arbeitsschritte, die Haltungen und Erfahrungen pädagogischer Fachkräfte sowie eine kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einführung, ein Kapitel zu Bildungs- und Lerngeschichten (inkl. Ursprung, Eigenschaften und Zielen), ein Kapitel zu Lerndispositionen, ein Kapitel zu den Arbeitsschritten der Bildungs- und Lerngeschichten (Beobachten, Analysieren, Entscheiden, Dokumentieren), ein Kapitel zu den Haltungen und Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte sowie eine abschließende Diskussion. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist die detaillierte Darstellung des Konzepts der Bildungs- und Lerngeschichten und die Untersuchung seiner Anwendbarkeit und Grenzen. Es soll geklärt werden, ob das Verfahren allein ausreicht und alle Entwicklungsbereiche der Kinder abdeckt.
Woher stammt das Konzept der Bildungs- und Lerngeschichten?
Die Bildungs- und Lerngeschichten haben ihren Ursprung in Neuseeland und basieren auf dem Curriculum „Te Whariki“.
Welche Eigenschaften haben Bildungs- und Lerngeschichten?
Es handelt sich um ein offenes Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren, das den Fokus auf die individuellen Lernqualitäten des Kindes legt und dessen Entwicklung ohne vorgefertigte Leistungskriterien beurteilt.
Welche Arbeitsschritte umfasst das Verfahren?
Die Arbeitsschritte umfassen: Beobachten und Beschreiben des Kindes, Analyse und Austausch der Beobachtungen, Entscheidung über die nächsten Schritte und die Dokumentation der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bildungs- und Lerngeschichten, frühkindliche Bildung, Beobachtung, Dokumentation, Lernprozesse, Te Whariki, Neuseeland, pädagogische Fachkraft, Entwicklungsverfahren, individuelle Lernqualitäten.
Was ist der Kontext der Arbeit?
Die Arbeit steht im Kontext der Entwicklung von Bildungsplänen in Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts, beeinflusst durch die Ergebnisse der PISA-Studie und der zunehmenden Bedeutung frühkindlicher Bildung.
- Quote paper
- Stefanie Gschwinder (Author), 2017, Bildungs- und Lerngeschichten in Kindertageseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/442088