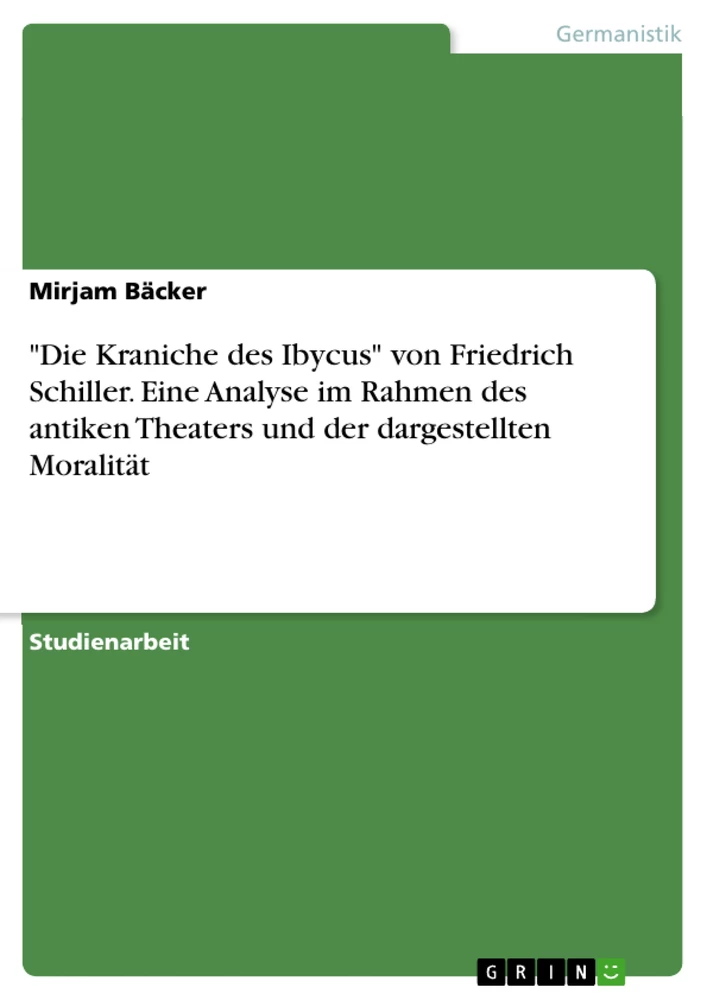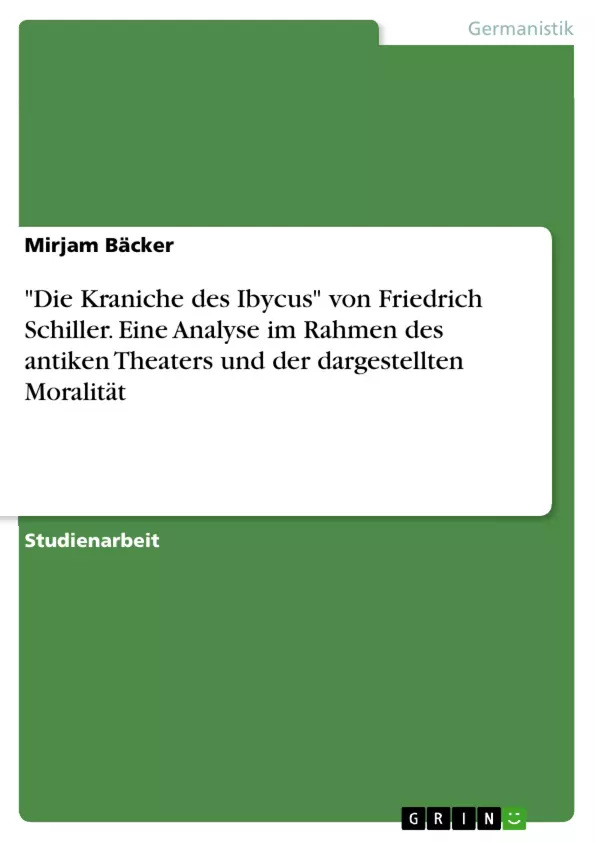Friedrich Schiller hatte sich der Aufklärung im 18. Jahrhundert verschrieben, war Befürworter einer Revolution der Gesellschaft und ein Verfechter der Selbstbestimmung des Individuums. Als Teil der Weimarer Klassik, der vor allem die ästhetische Allianz zwischen Schiller und Goethe und deren gegenseitige Inspiration zu Grunde lag und zu deren wichtigsten Motiven Menschlichkeit und Toleranz zählte, prägte Friedrich Schiller das Genre der moralischen Erzählung neu.
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit der Ballade „Die Kraniche des Ibycus“ von Friedrich Schiller intensiv auseinander und konzentriert sich dabei konkret auf die Darstellung des antiken Theaters im Text und klärt inwieweit die verschiedenen Elemente des dargestellten Schauspiels eine aufklärende Funktion zu Gunsten der dargestellten Moralität einnehmen. Dazu wird zu Beginn, der historisch überlieferte Aufbau des antiken Theaters und dessen konkrete Darstellung in der Ballade betrachtet. Es folgt eine kurze Ausführung der Hintergründe der Entstehungsgeschichte und weshalb Schiller für seinen Erzählstoff das Medium der Ballade gewählt haben könnte. Eine Textanalyse auf struktureller und inhaltlicher Ebene wird vorgenommen und dabei besonders auf die Wirkungselemente der Kraniche und des Chores und deren Rolle bezüglich der Aufklärung des Verbrechens eigegangen. Folgend werden Friedrich Schillers moralische und philosophische Ansichten und Überlegungen zu dem Thema herausgearbeitet, primär unter Berücksichtigung seines Aufsatzes „Die Schaubühne als moralische Anstalt betrachtet“. Außerdem wird der Begriff der „Moral“ nach Schillers Empfinden und Interpretation kritisch betrachtet und schließlich die Zusammenhänge zwischen der Ballade und Schillers Idealisierungskonzepts in einem Fazit dargelegt.
Die zu dem Thema existierende und herangezogene Forschungsliteratur konzentrierte sich vor allem auf den Aspekt der Verbindung Schillers zum Theater an sich und dessen philosophische Abhandlungen im Sinne der Aufklärung. Deutlich weniger Interpretationsmaterial ist explizit zu der Ballade „Die Kraniche des Ibycus“ zu finden und nichts desto trotz lässt sich Friedrich Schillers gedanklicher Ansatz eines Theaters als Hilfskonzept zur moralischen Erziehung erfolgreich auf die Ballade projizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau des Theaters in der Antike und dessen konkrete Darstellung in der Ballade
- Hintergrund und Entstehung
- Strukturelle Analyse
- Die Rolle der Kraniche
- Die Rolle des Erinnyenchores
- Schillers Schaubühnenaufsatz
- Der Trugschluss des Begriffs „moralisch“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Friedrich Schillers Ballade „Die Kraniche des Ibycus“, mit dem Fokus auf die Darstellung des antiken Theaters und dessen aufklärende Funktion im Hinblick auf die Moralität der Geschichte. Die Arbeit untersucht den historischen Aufbau des antiken Theaters, die Entstehungsgeschichte der Ballade, die strukturelle und inhaltliche Textanalyse, die Rolle der Kraniche und des Chores, Schillers moralisch-philosophische Ansichten, sowie eine kritische Betrachtung des Begriffs „Moral“ im Kontext der Ballade.
- Darstellung des antiken Theaters in Schillers Ballade
- Aufklärende Funktion des antiken Theaters in Bezug auf Moralität
- Entstehungsgeschichte und Schillers Wahl des Mediums Ballade
- Analyse der Rolle von Kranichen und Chor
- Schillers moralisch-philosophische Positionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der Ballade „Die Kraniche des Ibycus“ im Hinblick auf die Darstellung des antiken Theaters und dessen Beitrag zur moralischen Aufklärung. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die historische Betrachtung des antiken Theaters, die Entstehungsgeschichte der Ballade und eine detaillierte Textanalyse umfasst. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle der Kraniche und des Chores gelegt, sowie auf Schillers moralphilosophische Positionen und seine Interpretation des Begriffs "Moral". Die Einleitung betont die relative Knappheit an Literatur, die sich explizit mit der Ballade auseinandersetzt, und verdeutlicht die Relevanz einer solchen Analyse für das Verständnis von Schillers Werk.
Aufbau des Theaters in der Antike und dessen konkrete Darstellung in der Ballade: Dieses Kapitel analysiert den Aufbau des antiken griechischen Theaters und seine Darstellung in Schillers Ballade. Es beschreibt die Architektur des Theaters, den kreisrunden Orchester, das Halbrund des Theatron, die Bühne und die Scena. Der Text vergleicht die beschriebene Architektur in der Ballade mit den realgeschichtlichen Gegebenheiten des antiken Theaters. Die Funktion des Chores als Mittlerelement zwischen Handlung und Publikum wird hervorgehoben und mit Zitaten aus der Ballade belegt. Das Kapitel zeigt auf, wie Schiller den architektonischen Aufbau, den Hintergrund der Isthmischen Spiele und den Ablauf der griechischen Tragödie in seiner Ballade realgeschichtlich und strukturell nachahmt.
Hintergrund und Entstehung: Dieses Kapitel beleuchtet den Hintergrund und die Entstehung der Ballade „Die Kraniche des Ibycus“ im Kontext des „Balladenjahres“ 1797 und der Zusammenarbeit zwischen Schiller und Goethe. Es wird der Einfluss Goethes auf die Entstehung der Ballade beschrieben und der Briefwechsel beider Dichter erwähnt. Das Kapitel erörtert Schillers Entscheidung, die Ballade als Medium zu wählen, um eine breite Masse an Publikum zu erreichen und den Fokus auf die Handlung zu lenken. Die antike, realgeschichtliche Stoffvorlage der Geschichte des Dichters Ibycus wird erläutert, sowie Schillers Erweiterung des Stoffes um den Erinnyenchor.
Strukturelle Analyse: Dieses Kapitel analysiert die dreiteilige, pyramidale Struktur der Ballade, die sich an der Struktur des Dramas orientiert. Die Ballade wird in Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt und Peripetie unterteilt, wobei die einzelnen Abschnitte der Ballade detailliert analysiert werden. Das Kapitel zeigt, wie die Struktur der Ballade zur dramatischen Wirkung beiträgt.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Die Kraniche des Ibycus, Ballade, Antikes Theater, Griechische Tragödie, Aufklärung, Moral, Erinnyenchor, Kraniche, Isthmische Spiele, Textanalyse, Strukturanalyse, Weimarer Klassik, Goethe.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers "Die Kraniche des Ibycus"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Friedrich Schillers Ballade "Die Kraniche des Ibycus" mit dem Schwerpunkt auf der Darstellung des antiken Theaters und dessen aufklärender Funktion im Hinblick auf die Moralität der Geschichte. Die Arbeit untersucht den historischen Aufbau des antiken Theaters, die Entstehungsgeschichte der Ballade, die strukturelle und inhaltliche Textanalyse, die Rolle der Kraniche und des Chores, Schillers moralisch-philosophische Ansichten und eine kritische Betrachtung des Begriffs "Moral" im Kontext der Ballade.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Darstellung des antiken Theaters in Schillers Ballade; aufklärende Funktion des antiken Theaters in Bezug auf Moralität; Entstehungsgeschichte und Schillers Wahl des Mediums Ballade; Analyse der Rolle von Kranichen und Chor; Schillers moralisch-philosophische Positionen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zum Aufbau des antiken Theaters und dessen Darstellung in der Ballade, zum Hintergrund und der Entstehung der Ballade, zur strukturellen Analyse, der Rolle der Kraniche und des Erinnyenchores, Schillers Schaubühnenaufsatz, einer kritischen Betrachtung des Begriffs "moralisch" und abschließend einem Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Aspekts.
Welche Rolle spielen die Kraniche und der Chor in der Ballade?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Kraniche und des Chores in der Ballade ausführlich. Es wird analysiert, wie diese Elemente zur dramatischen Wirkung und zur moralischen Aussage der Ballade beitragen. Die Funktion des Chores als Mittlerelement zwischen Handlung und Publikum wird hervorgehoben.
Welche Bedeutung hat der Begriff "Moral" in der Arbeit?
Die Arbeit betrachtet den Begriff "Moral" kritisch im Kontext der Ballade und untersucht Schillers moralisch-philosophische Positionen. Es wird analysiert, wie Schiller den Begriff "Moral" in seiner Ballade verwendet und welche Bedeutung er ihm beimisst.
Wie wird das antike Theater in der Ballade dargestellt?
Die Arbeit analysiert den Aufbau des antiken griechischen Theaters und seine konkrete Darstellung in Schillers Ballade. Sie vergleicht die beschriebene Architektur in der Ballade mit den realgeschichtlichen Gegebenheiten und zeigt auf, wie Schiller den architektonischen Aufbau, den Hintergrund der Isthmischen Spiele und den Ablauf der griechischen Tragödie in seiner Ballade nachahmt.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Die Kraniche des Ibycus, Ballade, Antikes Theater, Griechische Tragödie, Aufklärung, Moral, Erinnyenchor, Kraniche, Isthmische Spiele, Textanalyse, Strukturanalyse, Weimarer Klassik, Goethe.
Welche methodischen Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der die historische Betrachtung des antiken Theaters, die Entstehungsgeschichte der Ballade und eine detaillierte Textanalyse umfasst. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle der Kraniche und des Chores gelegt, sowie auf Schillers moralphilosophische Positionen und seine Interpretation des Begriffs "Moral".
Wie ist die Struktur der Ballade?
Die Arbeit analysiert die dreiteilige, pyramidale Struktur der Ballade, die sich an der Struktur des Dramas orientiert. Die Ballade wird in Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt und Peripetie unterteilt.
Welche Bedeutung hat der Kontext des "Balladenjahres" 1797?
Das Kapitel über den Hintergrund und die Entstehung der Ballade beleuchtet den Kontext des "Balladenjahres" 1797 und die Zusammenarbeit zwischen Schiller und Goethe. Es wird der Einfluss Goethes auf die Entstehung der Ballade beschrieben und der Briefwechsel beider Dichter erwähnt. Schillers Entscheidung, die Ballade als Medium zu wählen, wird ebenfalls erörtert.
- Citar trabajo
- Mirjam Bäcker (Autor), 2016, "Die Kraniche des Ibycus" von Friedrich Schiller. Eine Analyse im Rahmen des antiken Theaters und der dargestellten Moralität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441062