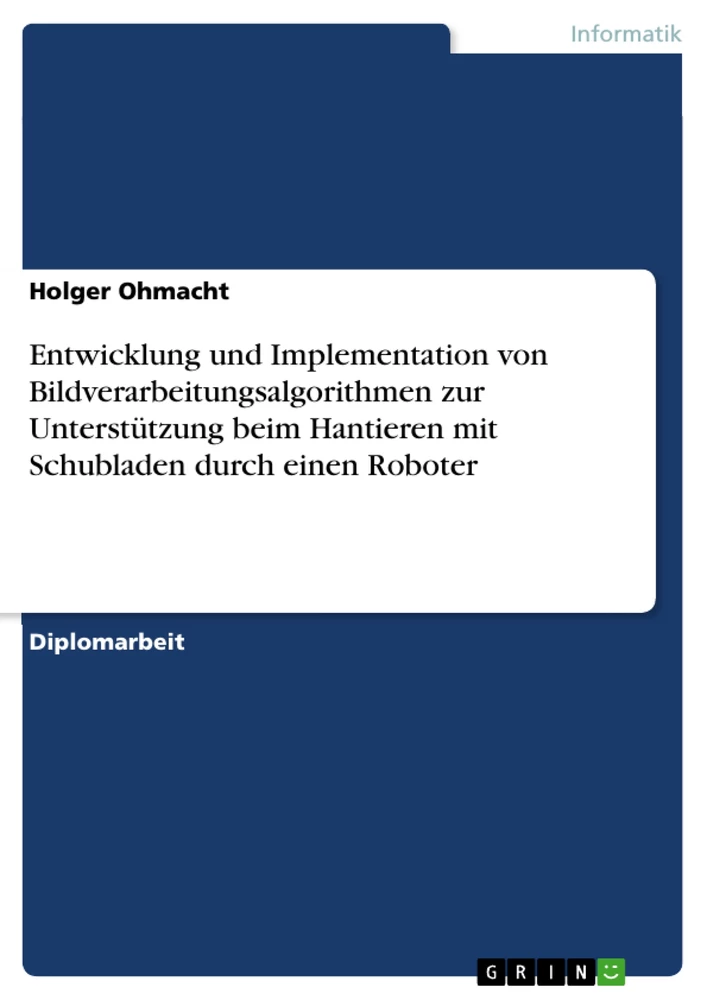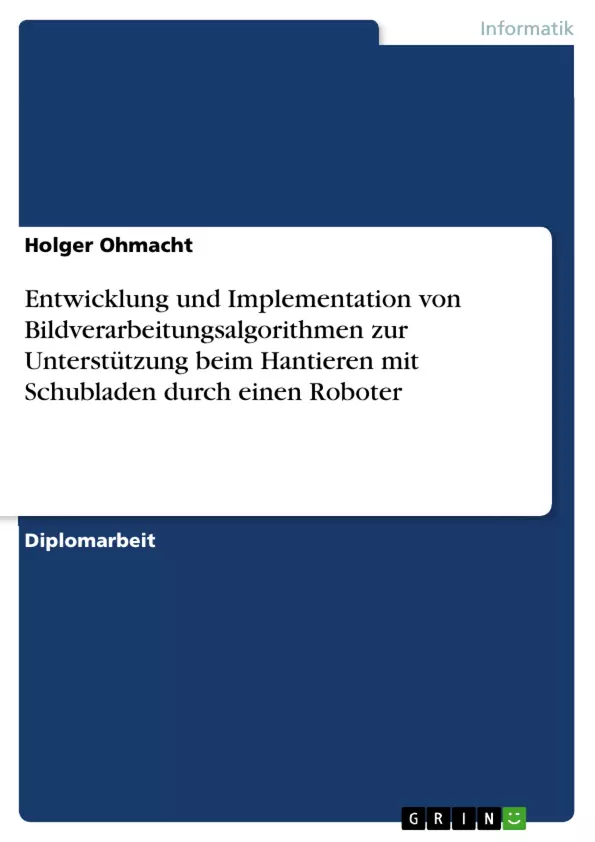1. Einleitung
1.1. Der Entwicklungsstand der heutigen Robotik und
deren Stellenwert im Leben des modernen Menschen
Je weiter der moderne Mensch an Orte vordringt, an welchen er sich selbst nur mittels eines immens hohen technischen Aufwandes, wie z.B. dem Weltraum, und/oder verbunden mit erheblichen Gefahren, wie der Tiefsee, aufhalten kann, desto mehr stellt er an die Wissenschaft die Forderung, Roboter mit eigener Intelligenz zu entwickeln.
Mit dieser Eigenschaft befähigt, sollen diese - ohne die für einen Menschen geltenden natürlichen Restriktionen, wie z.B. Luftversorgung, Verpflegung, Schlaf, ärztliche Betreuung - an gefährlichen Plätzen dessen Aufgaben übernehmen. Auch aus dem
Grund, daß der Mensch selbst aller Voraussicht nach die größte Fehlerquelle darstellt - vorwiegend dann, wenn er unter extremen Situationen innerhalb besonders knappen Reaktionszeiten handeln muß.
Die bisherige Vorgehensweise in der Weltraumrobotik, die Fernsteuerung „dummer“ Roboter, ist anbetracht der stetig größer werdenden Distanzen, die die Signale zurücklegen müssen (und der damit verbundenen Zeitverzögerungen), kläglich zum Scheitern verurteilt. Bereits bei unserem nächsten planetaren Nachbarn, dem Mars, treten schon Signallaufzeiten auf, die im ungünstigsten Falle mehr als 10 Minuten betragen können.
Nicht immer allein sind es die außergewöhnlichen Aufgaben, die man bewältigen möchte. Meistens sind es klassische, zum Teil monotone Aufgabenbereiche, die trotzdessen ein Höchstmaß an Präzision und Flexibilität bei immer kürzeren Produktionszeiten fordern, schaut man sich in diesem Zusammenhang die heutige Industrierobotik an. Und wer denkt vermutlich nicht auch an das überforderte und
überlastete Krankenhauspersonal, denen eines Tages ein Serviceroboter unter die Arme greifen soll?
Mangelnde Flexibilität ist das größte Handicap heutiger Roboter, da sie durch ihre vorprogrammierten Bewegungsabläufe außerstande sind, auf Veränderungen ihrer Umgebung adäquat reagieren, wie z.B. dem unerwarteten Auftauchen einer Person innerhalb ihres Bewegungsraumes.
Nicht zu vergessen ist das Dilemma mit der Handhabung: Eine Vielzahl von Modellen verschiedener Firmen, jedes einzelne beschränkt auf ein kleines Aufgabengebiet, inkompatibel zueinander und schwierig zu programmieren, ließen - und lassen häufig den Wunsch nach einem universell einsetzbaren Roboter mit einer unkompliziert zu betätigenden Bedieneroberfläche laut werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text "Mağnūn Laylā" erzählt die Geschichte der tragischen Liebe zwischen Qays Bin Al-Mulawwaḥ und Laylā Bint Al-Mahdī, einer Liebesgeschichte, die in die vorislamische Beduinenwelt zurückreicht.
- Die `Udhristische Liebe als Ideal des existentiellen Leidens, des Verzichts und der ewigen Treue.
- Die soziale Ungleichheit als Hindernis für die Liebeserfüllung.
- Die Bedeutung von Poesie als Ausdruck von Liebe und Schmerz.
- Die Rolle des Wahnsinns als Reaktion auf unerfüllte Liebe.
- Die Bedeutung von Tradition und Mythos in der Gestaltung der Liebesgeschichte.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt eine Einführung in die Liebesgeschichte von Mağnūn und Laylā. Sie beschreibt die frühen Anekdoten und mündlichen Berichte über die beiden Liebenden, die in verschiedenen Quellen dokumentiert sind. Außerdem werden die Merkmale der `Udhristischen Liebe und ihre Bedeutung für die Liebesgeschichte erläutert.
Übersetzung
Dieser Abschnitt enthält eine Auswahl von Gedichten, die Qays Bin Al-Mulawwaḥ für Laylā geschrieben hat. Die Gedichte drücken seine tiefe Liebe und seinen Schmerz über ihre Trennung aus.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: `Udhristische Liebe, Liebesgeschichte, soziale Ungleichheit, Poesie, Wahnsinn, Tradition, Mythos, Qays Bin Al-Mulawwaḥ, Laylā Bint Al-Mahdī.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Geschichte von Mağnūn und Laylā?
Es handelt sich um eine tragische Liebesgeschichte aus der vorislamischen Beduinenwelt zwischen Qays Bin Al-Mulawwaḥ (Mağnūn) und Laylā Bint Al-Mahdī.
Was bedeutet der Begriff „Udhristische Liebe“?
Die `Udhristische Liebe ist ein literarisches Ideal, das durch existenzielles Leiden, Verzicht, absolute Keuschheit und ewige Treue über den Tod hinaus gekennzeichnet ist.
Warum wird Qays als „Mağnūn“ (der Wahnsinnige) bezeichnet?
Sein Beiname rührt von seinem Wahnsinn her, in den er verfiel, nachdem ihm die Heirat mit Laylā verwehrt wurde. Er lebte daraufhin einsam in der Wüste und widmete sein Leben nur noch der Poesie für seine Geliebte.
Welche Rolle spielt die Poesie in diesem Werk?
Poesie ist das zentrale Ausdrucksmittel für Liebe und Schmerz. Die überlieferten Gedichte von Qays bilden den Kern des Mythos und dokumentieren seine tiefe emotionale Bindung.
Was waren die Hindernisse für die Erfüllung ihrer Liebe?
Soziale Ungleichheit, Stammesregeln und die Tradition der Beduinenwelt verhinderten die Verbindung, was die Geschichte zu einem Symbol für den Konflikt zwischen individuellem Gefühl und gesellschaftlicher Norm macht.
Ist die Geschichte historisch belegt?
Die Geschichte basiert auf frühen Anekdoten und mündlichen Berichten. Ob die Personen exakt so existierten, ist historisch schwer zu fassen, doch der Mythos ist fest in der arabischen Literaturtradition verankert.
- Quote paper
- Holger Ohmacht (Author), 1999, Entwicklung und Implementation von Bildverarbeitungsalgorithmen zur Unterstützung beim Hantieren mit Schubladen durch einen Roboter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43