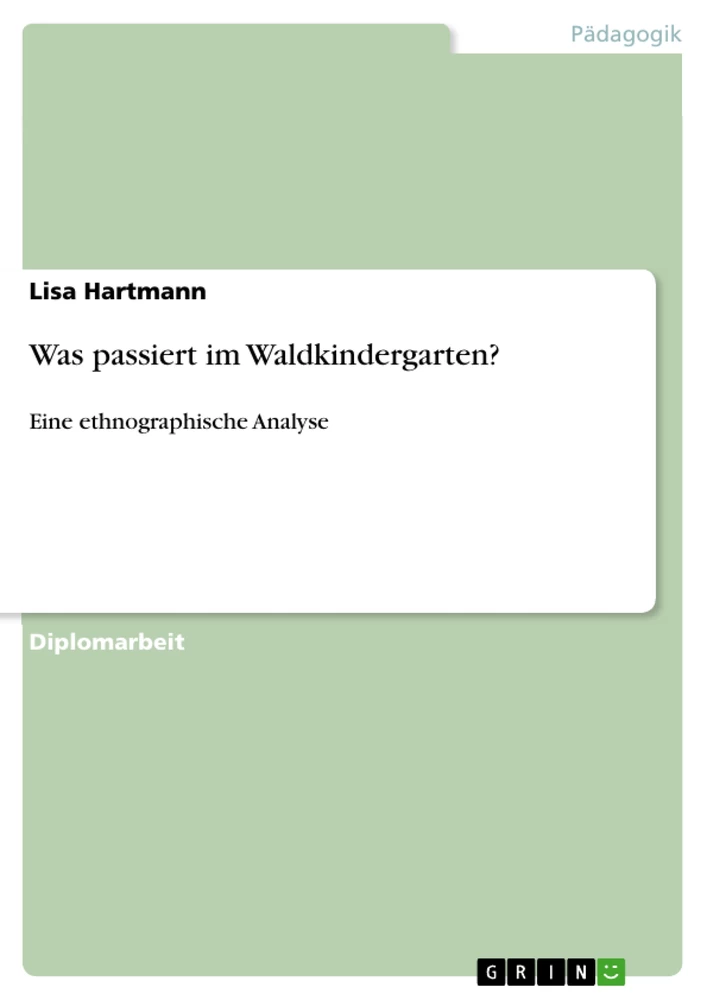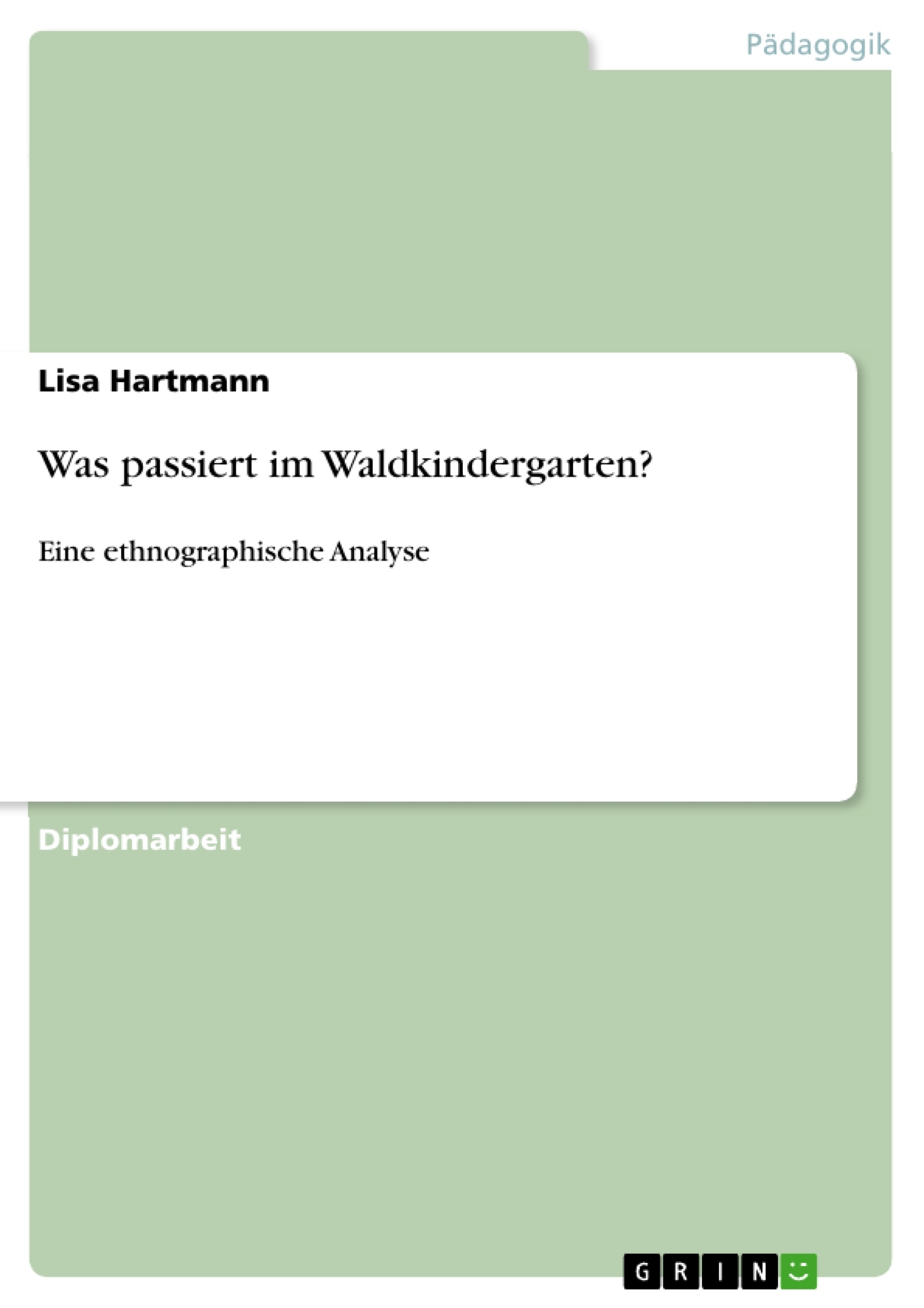Es wurde eine Feldforschung mit Teilnehmender Beobachtung in der Waldgruppe einer Kindertagesstätte durchgeführt. Ausgangspunkt der Forschung ist eine offene und undogmatische Fragestellung, die vorerst keine Prüfung theoretischer Hypothesen verlangt, aber eine erste Orientierung in der Feldforschung bietet und durch das theoretische Vorwissen spezifiziert wird. Das Vorgehen der Arbeit folgt der Spezifikation der Fragestellung.
Da das Forschungsdesign in Anlehnung an die Grounded Theory Methodologie entstand, liefert der erste Teil der Arbeit die wichtigsten Theoriebausteine. Hierzu wird bestimmt, was Kindertageseinrichtungen sind und welche Aufgabe sie zu erfüllen haben. Durch die Begriffsbestimmung von Betreuung, Erziehung und Bildung werden diese voneinander abgegrenzt. Durch die Definition der differenten Arten von Bildung kann explizit verdeutlicht werden, welche Art von Bildung in Kindertageseinrichtungen implementiert werden soll und welche nicht.
Die Notwendigkeit von Kindertageseinrichtungen für Kinder werden durch einen historischen Exkurs dargestellt. In diesem Rückblick wird auch der Situationsansatz knapp umrissen. Die heutige Bildungsdiskussion weist auf die Wichtigkeit frühkindlicher Bildung hin. Der hieraus entstandene Bildungsplan sowie der Bildungsauftrag an den Kindergarten werden deshalb ebenfalls dargestellt. Gemeinsam mit der Annahme über Bildungsprozesse im kindlichen Spiel bilden Selbstbildung und Ko-Konstruktion in dieser Arbeit als Bildungskonzepte den Ausganspunkt für Bildung. Alle diese Konzepte werden vorgestellt und der theoretische Rahmen geschlossen.
Das Forschungsdesign in Anlehnung an die Grounded Theory Methodologie sowie das exakte Forschungsvorgehen werden im zweiten Teil der Arbeit dargestellt. Dort findet sich auch eine erste Präsentation der Ergebnisse.
Eine ausführliche Darstellung und Diskussion der Ergebnisse mit Rückbezug auf die Theoriebausteine ist im dritten Teil der Arbeit zu finden. Dort werden die durch die Kodier-Arbeiten im Zuge der Grounded Theory Methodologie herausgearbeiteten Kategorien auf dem Hintergrund der „Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ dargestellt und im Hinblick die Forschungsfrage diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- I Theoretischer Rahmen
- 2. Zentralen Begriffe
- 2.1 Kindertageseinrichtung
- 2.2 Betreuung
- 2.3 Bildung
- 2.3.1 Formelle Bildung
- 2.3.2 Informelle Bildung
- 2.3.3 Non-formelle Bildung
- 2.4 Erziehung
- 3. Die Geschichte des (Wald)-Kindergartens
- 3.1 Die Erfindung des Kindergartens
- 3.2 Die Bildungsdiskussion 1960/1970
- 3.3 Der Situationsansatz
- 3.4 Der Waldkindergarten
- 4. Frühkindliche Bildung heute
- 4.1 Bildungspläne in Kindertageseinrichtungen
- 4.2 Bildungskonzepte
- 4.2.1 Selbstbildung
- 4.2.2 Ko-Konstruktion
- 4.3 Bildungsprozesse im Spiel
- 4.4 Bildungsraum
- 5. Zwischenfazit und Entwicklung der Forschungsfrage
- II Empirie und Forschungszugang
- 6. Darlegung und Begründung der Methodenwahl
- 6.1 Rahmenkonzept: Die Grounded Theory Methodologie
- 6.1.1 Untersuchungskonzept: Deskriptive Feldforschung
- 6.1.2 Erhebungsverfahren: Die Teilnehmende Beobachtung
- 6.1.3 Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren: Kodes und Kategoriensysteme
- 6.2 Spezifikation der Fragestellung
- III Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
- 7. Aufbau der Ergebnisdarstellung
- 7.1 Erläuterung des theoretischen Modells
- 7.2 Darstellung und Diskussion der Kategorien
- 7.2.1 Bewegung
- 7.2.2 Wahrnehmung
- 7.2.3 Sprache
- 7.2.4 Gemeinschaft und soziales Verhalten
- 7.2.5 Fantasie und Kreativität
- 7.2.6 Naturerfahrung und Ökologie
- 7.2.7 Mathematik und Naturwissenschaft
- 8. Fazit und Weiterführende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Bildungsprozesse im Waldkindergarten und analysiert, wie der Bildungsauftrag in der Praxis umgesetzt wird. Sie setzt sich mit den pädagogischen Konzepten des Waldkindergartens auseinander und betrachtet die Rolle des Waldes als Bildungsraum. Die Arbeit stützt sich auf eine ethnographische Analyse, die in der Waldgruppe der Prot. Kindertagesstätte Musterdorf durchgeführt wurde.
- Bildung im Waldkindergarten
- Ethnographische Analyse
- Umsetzung des Bildungsauftrags
- Der Wald als Bildungsraum
- Pädagogische Konzepte des Waldkindergartens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer theoretischen Einführung in die Thematik der Frühkindlichen Bildung, wobei zentrale Begriffe wie Kindertageseinrichtung, Betreuung, Bildung und Erziehung definiert werden. Die Geschichte des (Wald)-Kindergartens wird beleuchtet und verschiedene Bildungspläne und -konzepte, insbesondere im Kontext des Waldkindergartens, vorgestellt.
Im zweiten Teil wird die empirische Forschungsmethodik erläutert, die auf der Grounded Theory Methodologie basiert. Die Wahl der Methode, die deskriptive Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung, wird detailliert begründet und die Datenerhebung und -auswertung mit Kodes und Kategoriensystemen vorgestellt.
Der dritte Teil der Arbeit präsentiert die Ergebnisse der ethnographischen Analyse. Es wird ein theoretisches Modell entwickelt, das die beobachteten Bildungsprozesse im Waldkindergarten strukturiert. Die einzelnen Kategorien, wie Bewegung, Wahrnehmung, Sprache, Gemeinschaft und soziales Verhalten, Fantasie und Kreativität, Naturerfahrung und Ökologie sowie Mathematik und Naturwissenschaft, werden anhand von Beispielen aus der Feldforschung diskutiert.
Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und weiterführende Gedanken zum Thema Waldkindergarten und frühkindliche Bildung anregt.
Schlüsselwörter
Waldkindergarten, Frühkindliche Bildung, Ethnographie, Teilnehmende Beobachtung, Grounded Theory, Bildungsauftrag, Bildungsraum, Naturerfahrung, Ökologie, Spiel, Selbstbildung, Ko-Konstruktion.
- Quote paper
- Lisa Hartmann (Author), 2014, Was passiert im Waldkindergarten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/438758