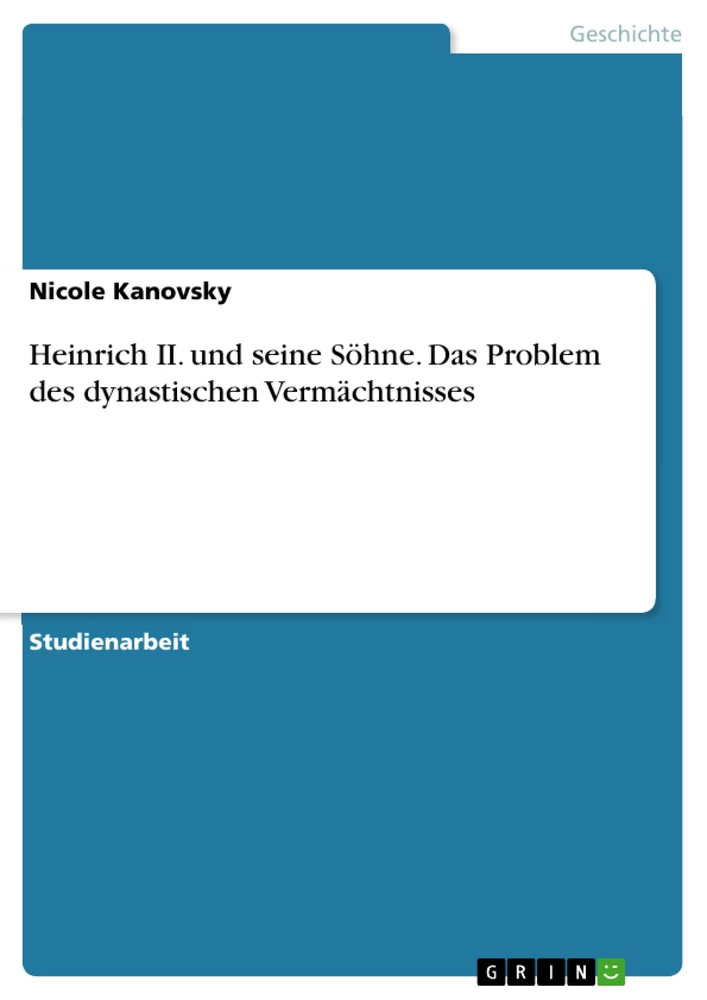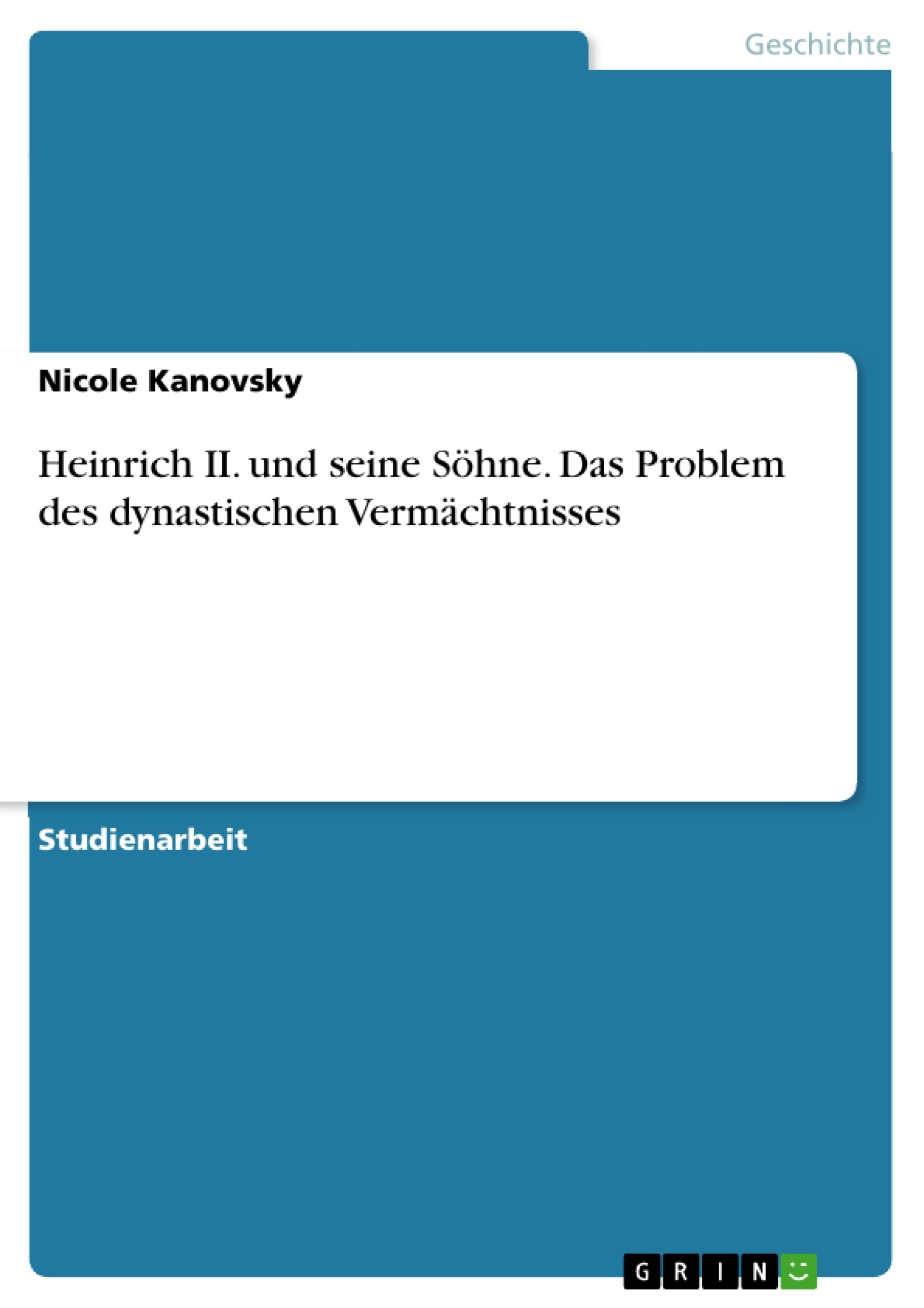Als Heinrich der Jüngere 1170 zum designierten König gekrönt wurde, war dies für das angevinische Reich in vielerlei Hinsicht ein Novum. Heinrich der Jüngere war zwar der Zweitgeborene, aber älteste Sohn Heinrichs II., da sein Bruder Wilhelm bereits im Kindesalter verstarb. Er wurde noch zu Leb- und Regierungszeit seines Vaters zu dessen Nachfolger und Statthalter in England ernannt.
Es stellt sich daher die Frage, ob der Wille Heinrichs darin begründet lag, seiner Herrschaft durch die Primogenitur Beständigkeit zu geben.
Die Aktualität dieses Themas zeigt sich unter anderem an dem bis heute nicht abgerissenen Kult um einen weiteren Sohn Heinrichs II., Richard Löwenherz. Erst kürzlich widmete das Historische Museum der Pfalz zu Speyer diesem eine ganze Ausstellung. Abseits des populären Mythos um Richard Löwenherz besteht auch heute noch Interesse an den Taten der angevinischen Könige Englands. Für den angelsächsischen Sprachraum ergibt sich dies aus dem Bezug zur eigenen Geschichte, jedoch greifen auch deutschsprachige Historiker dieses Thema auf, da die internationalen Beziehungen Heinrichs II. weit über das anglonormannisch-französische Gebiet hinausgingen. Neben Richard Löwenherz und Heinrich II. Plantagenet rückt nun auch dessen Zweitgeborener, Heinrich der Jüngere in den Fokus der Wissenschaft. So veröffentlichte Matthew Strickland 2016 eine ausführliche Monographie, die sich mit dem Mitkönig beschäftigt.
In der Forschung der letzten Jahre kristallisierten sich zwei Theorien heraus, den Konflikt zwischen Heinrich II. und seinen Söhnen sowie den französischen Königen Ludwig VII. und Philipp II. zu betrachten. Zum einen das Entstehen einer Idee des frühen Nationalstaats. Dies lässt sich unter anderem daran festmachen, dass Heinrich II. gewisse Gebiete als unteilbar erachtete, so zum Beispiel England und die Normandie oder Irland als Ganzes und diese auch nur in sich geschlossen weitervermachen wollte. Zum anderen der kapetingisch-angevinische Gegensatz. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts lässt sich bezüglich dieser zwei Häuser ohne Bedenken von europäischen Großmächten sprechen. Jedoch werfen verwandtschaftliche beziehungsweise angeheiratete Beziehungen die Frage auf, wie groß dieser Gegensatz wirklich war. Sowohl Heinrich der Jüngere als auch Richard Löwenherz suchten und fanden des Öfteren Unterstützung am französischen Hof, entweder gegen ihren Vater oder zur Sicherung ihrer eigenen Interessen [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Angevinische Reich
- 2.1 Das homagium in Abgrenzung zum Lehenswesen
- 2.2 Der Aufstieg der Angevinen
- 2.3 Die Reformen und Herrschaftskonsolidierung Heinrichs II.
- 3. Die Herrschaftsverteilung unter den Nachfolgern Heinrich II.
- 3.1 Heinrich der Jüngere als Erbe Heinrich II.
- 3.2 Das Mitkönigtum als Instrument zur Herrschaftssicherung
- 3.3 Die Erziehung Heinrich des Jüngeren zum Erben
- 3.3.1 Der Konflikt zwischen Heinrich II. und Thomas Beckett
- 3.4 Die Krönung Heinrich des Jüngeren
- 3.5 Die große Rebellion gegen Heinrich II. 1173
- 4. Heinrich II. und seine Söhne – Das Problem des dynastischen Vermächtnisses 1174 - 1189
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Nachfolgeplanung Heinrichs II. und die Herausforderungen des dynastischen Vermächtnisses im Angevinischen Reich. Der Fokus liegt auf der Rolle Heinrichs des Jüngeren als designierter König und den komplexen Beziehungen zwischen Heinrich II. und seinen Söhnen, insbesondere im Kontext des homagium und der Herrschaftsverteilung.
- Die Nachfolgeplanung Heinrichs II. und die Ernennung Heinrichs des Jüngeren.
- Das Konzept des homagium im Angevinischen Reich und seine Bedeutung für die Beziehungen zwischen Heinrich II., seinen Söhnen und Frankreich.
- Die Herausforderungen der Herrschaftskonsolidierung und -verteilung im Angevinischen Reich.
- Die Konflikte zwischen Heinrich II. und seinen Söhnen im Kontext der dynastischen Nachfolge.
- Die Quellenlage und die Herausforderungen der historischen Forschung zu diesem Thema.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Beweggründen Heinrichs II. bei der frühzeitigen Ernennung seines Sohnes Heinrich des Jüngeren zum Mitkönig in den Mittelpunkt. Sie skizziert die aktuelle Forschungslandschaft und die zwei vorherrschenden Theorien: den frühen Nationalstaat und den kapetingisch-angevinischen Gegensatz. Die schwierige Quellenlage wird angesprochen, mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit eines vergleichenden Zugriffs auf diverse zeitgenössische Berichte. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Berichte von William of Newburgh, Radulphus de Diceto, Heinrich von Huntington, Robert von Torigni und Roger von Howden, um ein umfassendes Bild der Bemühungen Heinrichs II. zur Sicherung seiner Dynastie zu zeichnen.
2. Das Angevinische Reich: Dieses Kapitel definiert das Angevinische Reich als Verbund verschiedener Grafschaften und Herzogtümer unter der Herrschaft Heinrichs II., im Gegensatz zu einem Nationalstaat. Es beschreibt kurz die Entstehung des Hauses Anjou und die frühen Jahre Heinrichs II. als König Englands. Der Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung des homagium, das im Gegensatz zum Lehnswesen als ideelle Freundschaft verstanden wird, mit wechselseitiger Treue und Friedenspflicht, jedoch ohne Unterwerfung. Das Kapitel verdeutlicht, wie das homagium die Beziehungen zwischen Heinrich II., Ludwig VII. und seinen Söhnen beeinflusste, und wie es zur Sicherung von Besitzungen und zur Vermeidung von Konflikten diente.
Schlüsselwörter
Heinrich II., Heinrich der Jüngere, Richard Löwenherz, Angevinisches Reich, Dynastische Nachfolge, Homagium, Lehenswesen, Kapetinger, Mitkönigtum, Herrschaftskonsolidierung, Quellenkritik, Frühmittelalterliche Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Heinrich II. und die dynastische Nachfolge im Angevinischen Reich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Nachfolgeplanung Heinrichs II. und die Herausforderungen des dynastischen Vermächtnisses im Angevinischen Reich. Der Fokus liegt auf der Rolle Heinrichs des Jüngeren als designierter König und den komplexen Beziehungen zwischen Heinrich II. und seinen Söhnen, insbesondere im Kontext des Homagium und der Herrschaftsverteilung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Nachfolgeplanung Heinrichs II., das Konzept des Homagium im Angevinischen Reich und dessen Bedeutung für die Beziehungen zwischen Heinrich II., seinen Söhnen und Frankreich, die Herausforderungen der Herrschaftskonsolidierung und -verteilung, die Konflikte zwischen Heinrich II. und seinen Söhnen im Kontext der dynastischen Nachfolge, sowie die Quellenlage und die Herausforderungen der historischen Forschung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Berichte von William of Newburgh, Radulphus de Diceto, Heinrich von Huntington, Robert von Torigni und Roger von Howden, um ein umfassendes Bild der Bemühungen Heinrichs II. zur Sicherung seiner Dynastie zu zeichnen. Die schwierige Quellenlage und die Notwendigkeit eines vergleichenden Zugriffs auf diverse zeitgenössische Berichte werden hervorgehoben.
Was ist das Homagium und welche Rolle spielt es in der Arbeit?
Das Homagium wird im Gegensatz zum Lehnswesen als ideelle Freundschaft verstanden, mit wechselseitiger Treue und Friedenspflicht, jedoch ohne Unterwerfung. Die Arbeit untersucht, wie das Homagium die Beziehungen zwischen Heinrich II., Ludwig VII. und seinen Söhnen beeinflusste und zur Sicherung von Besitzungen und zur Vermeidung von Konflikten diente.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über das Angevinische Reich (inkl. Homagium und Aufstieg der Angevinen), ein Kapitel über die Herrschaftsverteilung unter den Nachfolgern Heinrichs II. (inkl. Mitkönigtum Heinrichs des Jüngeren und der großen Rebellion von 1173), ein Kapitel über Heinrich II. und seine Söhne (1174-1189), und ein Fazit.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, nach den Beweggründen Heinrichs II. bei der frühzeitigen Ernennung seines Sohnes Heinrich des Jüngeren zum Mitkönig. Die Arbeit beleuchtet auch die zwei vorherrschenden Theorien: den frühen Nationalstaat und den kapetingisch-angevinischen Gegensatz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heinrich II., Heinrich der Jüngere, Richard Löwenherz, Angevinisches Reich, Dynastische Nachfolge, Homagium, Lehenswesen, Kapetinger, Mitkönigtum, Herrschaftskonsolidierung, Quellenkritik, Frühmittelalterliche Geschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Nachfolgeplanung Heinrichs II. und die Herausforderungen des dynastischen Vermächtnisses im Angevinischen Reich. Sie analysiert die Rolle Heinrichs des Jüngeren und die komplexen Beziehungen zwischen Heinrich II. und seinen Söhnen im Kontext des Homagium und der Herrschaftsverteilung.
- Citar trabajo
- Nicole Kanovsky (Autor), 2017, Heinrich II. und seine Söhne. Das Problem des dynastischen Vermächtnisses, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437548