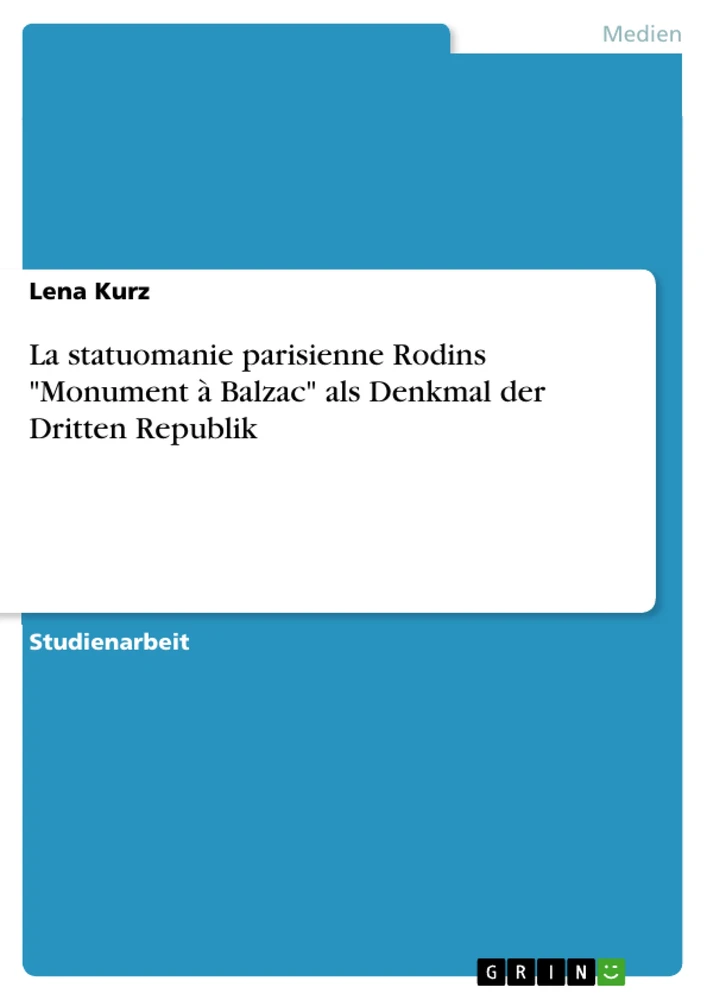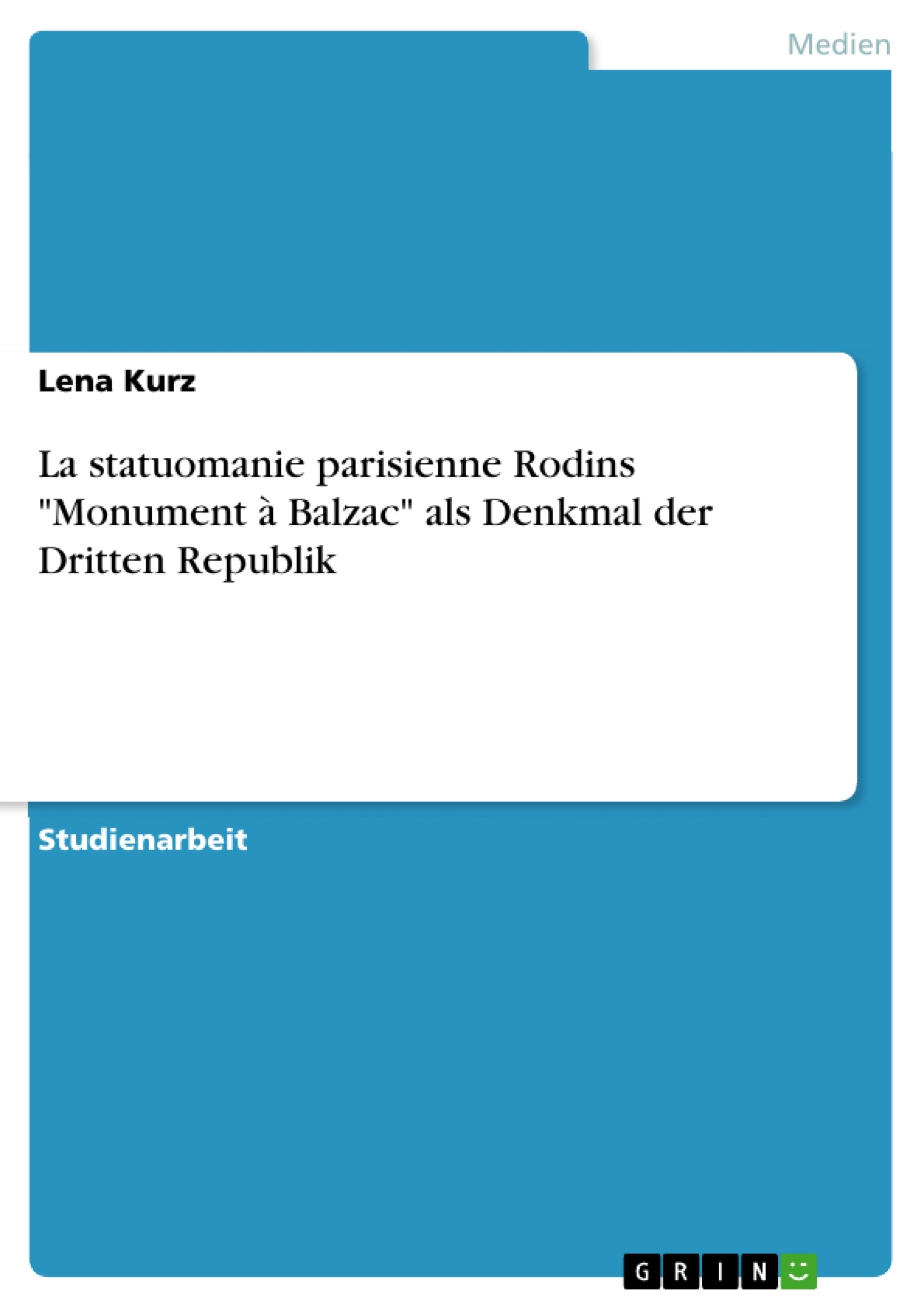In den Jahren von 1870 bis 1917 werden in Paris über 150 Denkmäler erbaut, es herrscht „Statuomanie“ – Statuenwahn. Insbesondere die Kritiker des Denkmalbaus verwenden diesen Begriff, um zu beschreiben, was in der dritten Republik in Paris und der übrigen Nation zu beobachten ist. Seit dem Entstehen der Republik 1870 in Folge der Niederlage Napoleons bei Sedan werden öffentliche Denkmäler zunehmend vielzähliger und gesellschaftlich relevant. Denn die laizistische, liberale Republik will sich nach ihrer Niederlage gegen die preußischen Nachbarn durch Fortschritt in Bildung, Technik und Zivilisation behaupten, wodurch ein forschungsorientiertes meritokratisches System entsteht. Wer einen Beitrag zum Wohl und Modernisierung der Nation leistet, wird darum durch Ehrungen belohnt und dient anderen als Vorbild.
Das öffentliche Denkmal wird zum Medium für diese Ehrungen. Grund dafür ist, dass ein Denkmal eine Person im öffentlichen Raum sichtbar machen und in einen Kontext einordnen kann. Der Prozess des Denkmalbaus wird zudem demokratisiert und ritualisiert. Komitees initiieren Denkmäler, Künstler werden durch Wettbewerb ausgesucht, Finanzierung funktioniert über öffentliche Subskription und die Einweihungsfeiern werden symbolisch aufgeladene Ereignisse. Insbesondere in Paris werden Denkmäler relevant, da die Stadt bereits damals das kulturelle Zentrum der Nation darstellt, der urbane Raum viele freie Plätze für Denkmäler bietet und die stark republikanische Stadtverwaltung sich in öffentlicher Repräsentation ausdrücken will. Viele Werke aus der Zeit der dritten Republik lassen sich offensichtlich als stellvertretend für den Denkmalbau verstehen, während bei anderen ein Bezug fern zu liegen scheint. Ein Beispiel ist Auguste Rodins umstrittenes Monument à Balzac, das aufgrund der starken Kritik und seine formale Erscheinung wie ein Gegenbild zu anderen Pariser Denkmälern scheint.
Im Folgenden soll jedoch durch die Auseinandersetzung mit dem Denkmal sowie die Rekonstruktion seiner Entstehung und der Kritik der Balzac als wichtiger und repräsentativer Teil des Pariser Denkmalbaus herausgearbeitet werden. Dazu soll zuerst eine Beschreibung des Werkes sowie seiner Entstehung erfolgen, worauf dann im Einzelnen auf den Denkmalbau, die formalen Aspekte und die Kritik am Denkmal im Kontext der üblichen Praktiken und Formen der Dritten Republik eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Statuomanie in der Dritten Republik
- 2. Beschreibung: August Rodins „Monument à Balzac“
- 3. Analyse: Der „Balzac“ als Pariser Denkmal
- 3.1 Der Prozess des Denkmalbaus
- 3.2 Formale Aspekte
- 3.3 Kritik und Statuomanie
- 4. Fazit: Das Monument à Balzac als Denkmal der Dritten Republik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht August Rodins „Monument à Balzac“ im Kontext der „Statuomanie“ der Dritten Französischen Republik. Ziel ist es, das Werk nicht als isolierten Fall, sondern als repräsentativen Teil des Pariser Denkmalbaus dieser Epoche zu verstehen. Die Analyse beleuchtet den Entstehungsprozess, die formalen Aspekte und die Kritik an Rodins Skulptur, um ihren Stellenwert im gesellschaftlichen und künstlerischen Kontext zu bestimmen.
- Die „Statuomanie“ in Paris während der Dritten Republik
- Der Entstehungsprozess von Rodins „Monument à Balzac“
- Formale Aspekte und künstlerische Gestaltung des Denkmals
- Die Kritik an Rodin’s „Balzac“ und ihre Bedeutung
- Das Denkmal als Medium der öffentlichen Repräsentation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Statuomanie in der Dritten Republik: Die Einleitung beschreibt den monumentalen Bauboom in Paris zwischen 1870 und 1917, der als „Statuomanie“ bezeichnet wird. Dieser Bauboom wird im Kontext des Wiederaufbaus und der Selbstdarstellung der nach der Niederlage gegen Preußen neu gegründeten Republik gesehen. Öffentliche Denkmäler fungierten als Mittel zur Ehrung von Personen, die zum Fortschritt und zur Modernisierung der Nation beitrugen, und der Denkmalbau wurde demokratisiert und ritualisiert. Die Arbeit fokussiert sich auf Auguste Rodins umstrittenes „Monument à Balzac“ als ein Beispiel, das zunächst als Gegenbild zu anderen Denkmälern erscheint, aber letztendlich als repräsentativer Teil des Pariser Denkmalbaus verstanden werden soll.
2. Beschreibung: August Rodins „Monument à Balzac“: Dieses Kapitel beschreibt Rodins Bronzeplastik „Monument à Balzac“ detailliert. Es werden Größe, Material, Form und die Darstellung Balzacs beschrieben. Die Betonung liegt auf der monumentalen Größe, der unkonventionellen Darstellung Balzacs im Mantel und dem starken Fokus auf dessen Kopf, der Ähnlichkeiten zu einer Daguerreotypie aufweist. Die Beschreibung legt den Grundstein für die spätere Analyse der formalen Aspekte und der Kritik an dem Werk.
3. Analyse: Der „Balzac“ als Pariser Denkmal: Dieser Abschnitt analysiert Rodins „Monument à Balzac“ in drei Unterabschnitten. Der erste Unterabschnitt betont, dass der Entstehungsprozess des Balzac, inklusive des ursprünglichen Auftrags an einen anderen Künstler, repräsentativ für den Denkmalbau der Dritten Republik ist, mit Komitees, öffentlichen Subskriptionen und symbolisch aufgeladenen Einweihungen. Der zweite Unterabschnitt beleuchtet die formalen Aspekte des Denkmals, unter anderem die ungewöhnliche Darstellung Balzacs. Der dritte Unterabschnitt behandelt die Kritik an dem Werk im Kontext der „Statuomanie“ und den damals gängigen Vorstellungen von öffentlichen Denkmälern. Die Analyse vergleicht und kontrastiert Rodins Werk mit anderen Beispielen und zeigt, wie es in den breiteren Kontext der öffentlichen Kunst und der politischen Ideologie der Zeit passt.
Schlüsselwörter
Statuomanie, Dritte Französische Republik, August Rodin, Monument à Balzac, öffentlicher Raum, Denkmalbau, öffentliche Repräsentation, Meritokratie, Formale Aspekte, Kritik, Societé des Gens de Lettres, Honoré de Balzac.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: August Rodins „Monument à Balzac“ im Kontext der Statuomanie der Dritten Republik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert August Rodins Skulptur „Monument à Balzac“ im Kontext der „Statuomanie“ während der Dritten Französischen Republik. Sie untersucht das Werk nicht isoliert, sondern als repräsentativen Teil des Pariser Denkmalbaus dieser Epoche.
Welche Aspekte des „Monument à Balzac“ werden untersucht?
Die Analyse beleuchtet den Entstehungsprozess des Denkmals, seine formalen Aspekte (Größe, Material, Darstellung Balzacs), die zeitgenössische Kritik daran und seinen Stellenwert im gesellschaftlichen und künstlerischen Kontext der Dritten Republik. Dabei wird der Vergleich mit anderen Denkmälern dieser Zeit gezogen.
Was ist die „Statuomanie“?
Die „Statuomanie“ bezeichnet den monumentalen Bauboom in Paris zwischen 1870 und 1917. Dieser wird im Kontext des Wiederaufbaus und der Selbstdarstellung der nach dem Deutsch-Französischen Krieg neu gegründeten Republik gesehen. Öffentliche Denkmäler dienten der Ehrung von Personen, die zum Fortschritt und zur Modernisierung Frankreichs beitrugen. Der Denkmalbau wurde in dieser Zeit demokratisiert und ritualisiert.
Wie wird der Entstehungsprozess des „Monument à Balzac“ dargestellt?
Der Entstehungsprozess, inklusive des ursprünglichen Auftrags an einen anderen Künstler, wird als repräsentativ für den Denkmalbau der Dritten Republik dargestellt. Es werden Aspekte wie Komitees, öffentliche Subskriptionen und symbolisch aufgeladene Einweihungen beleuchtet.
Welche formalen Aspekte des Denkmals werden analysiert?
Die Analyse der formalen Aspekte konzentriert sich auf die ungewöhnliche Darstellung Balzacs, seine monumentale Größe, das Material (Bronze), die Form und den starken Fokus auf Balzacs Kopf, der Ähnlichkeiten zu einer Daguerreotypie aufweist.
Welche Rolle spielt die Kritik am „Monument à Balzac“?
Die Kritik an Rodins „Balzac“ im Kontext der „Statuomanie“ und den damals gängigen Vorstellungen von öffentlichen Denkmälern wird analysiert. Es wird gezeigt, wie Rodins Werk im breiteren Kontext der öffentlichen Kunst und der politischen Ideologie der Zeit steht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Statuomanie, Dritte Französische Republik, August Rodin, Monument à Balzac, öffentlicher Raum, Denkmalbau, öffentliche Repräsentation, Meritokratie, formale Aspekte, Kritik, Societé des Gens de Lettres, Honoré de Balzac.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein beschreibendes Kapitel über das „Monument à Balzac“, eine Analyse des Werks im Kontext der Statuomanie und ein Fazit. Die Analyse ist in Unterkapitel zu Entstehungsprozess, formalen Aspekten und Kritik unterteilt.
Welches ist das übergeordnete Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, Rodins „Monument à Balzac“ nicht als isolierten Fall zu betrachten, sondern als repräsentativen Teil des Pariser Denkmalbaus der Dritten Republik zu verstehen und dessen Bedeutung im gesellschaftlichen und künstlerischen Kontext zu erfassen.
- Citation du texte
- Lena Kurz (Auteur), 2018, La statuomanie parisienne Rodins "Monument à Balzac" als Denkmal der Dritten Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437205