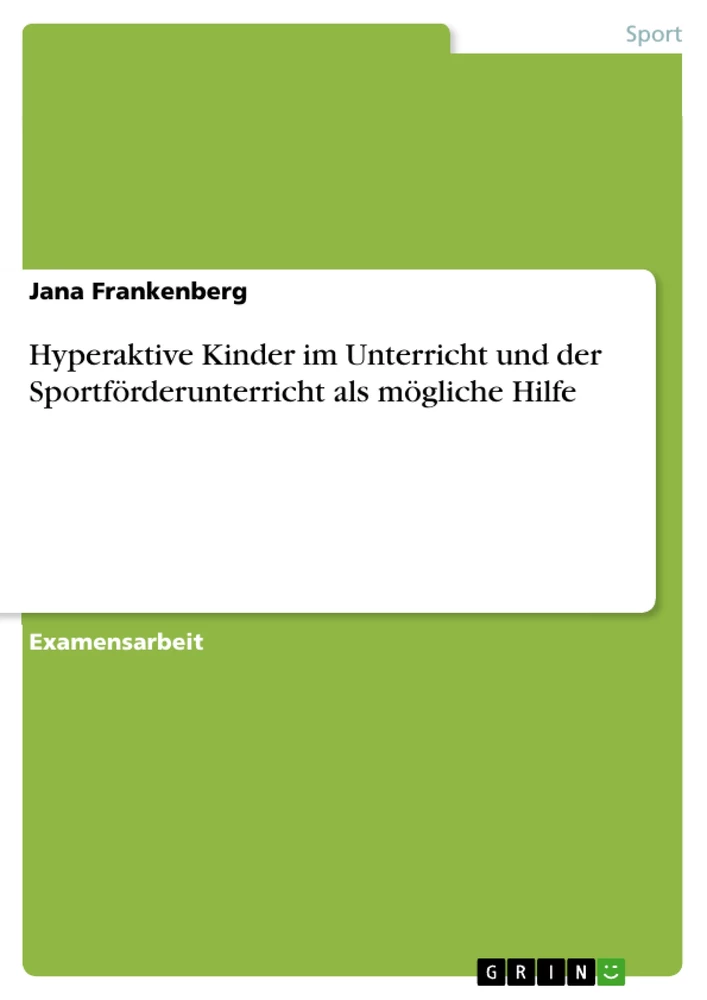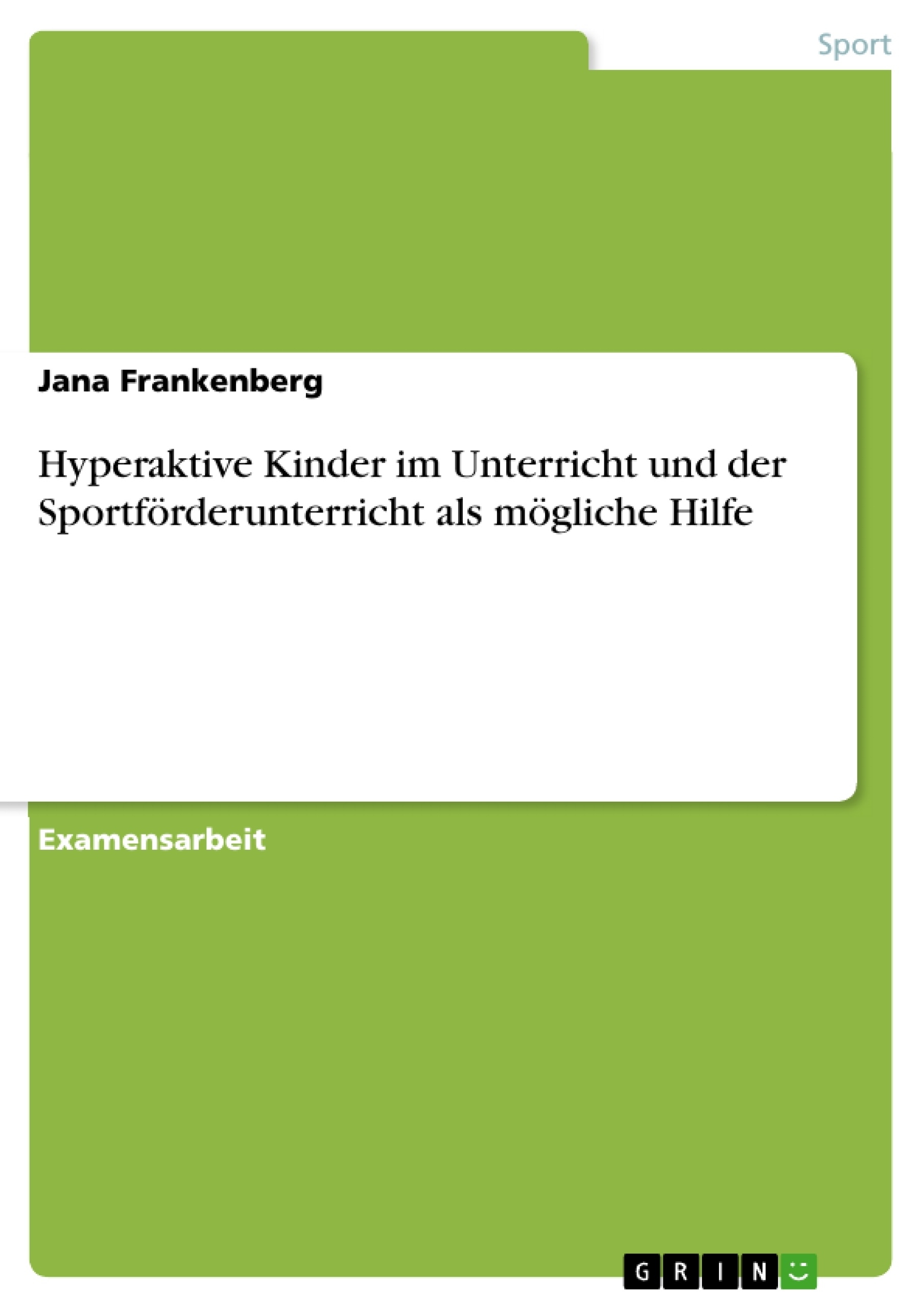Im Rahmen der Vorüberlegungen zu meiner Examensarbeit habe ich mir über viele pädagogische Handlungsfelder Gedanken gemacht. Da ich seit meinem Studienbeginn die Problematik der Lern- und Erziehungsprobleme heranwachsender Kinder mit zunehmendem Interesse verfolge, möchte ich mich auch in meiner Arbeit diesem Thema widmen.
Erste, sehr spannende Einblicke bekam ich in diversen Seminaren, die sich mit dieser Thematik beschäftigten. Hinsichtlich des Gedankens, mit diesen Problemen auch in meiner späteren Berufspraxis konfrontiert zu werden, entschied ich mich dafür, die Lebens- und Lernsituationen von Kindern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten näher zu betrachten. Mein Anliegen ist es, ihre Situation besser zu verstehen, um ihnen dann in meinem späteren Berufleben eventuell effektive Hilfestellungen anbieten zu können.
Die Problematik von ADHS- Kindern ist schon seit langem ein zentraler Bestandteil schulpädagogischer Handlungsräume, die im Rahmen einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen nicht vernachlässigt werden darf. Neben der Bearbeitung des ADH- Syndroms werde ich des Weiteren noch genauer auf den Sportförderunterricht in der Schule eingehen, der lediglich als „eine“ mögliche Hilfe verhaltensauffälliger Kinder angesehen werden kann.
Auf die Problematik der Hyperaktivität bin ich im Zusammenhang mit meinem Fachpraktikum Anfang des Jahres gestoßen. In meiner damaligen ersten Klasse befand sich ein Junge, der immer wieder durch übermäßige Impulsivität, ständige Unruhe und einen ausgesprochenen Bewegungsdrang in der Gruppe auffiel. Bei einem Gespräch mit der Klassenlehrerin erfuhr ich wenig später, dass der Junge unter Umständen das ADH-Syndrom haben könnte. Eine genaue Diagnose stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Laut Anamnese und Aussagen der Eltern sind bestehende Auffälligkeiten im Vorschulalter (Kindergarten) noch nicht behandelt worden. Erst im Rahmen der schulischen Unterrichtssituationen bemerkte die Klassenlehrerin bei ihm jene Auffälligkeiten, auf die ich im Laufe meiner Arbeit noch genauer eingehen werde.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- Zur Themenauswahl
- Aufbau der Arbeit
- Zur Relevanz des Themas
- HYPERAKTIVITÄT
- Allgemeine Begriffsklärung
- Definitionsversuche
- Historischer Abriss
- Mögliche Ursachen
- Genetische Faktoren
- Organische Faktoren
- Ökologische Faktoren
- Psycho- soziale Faktoren
- Störung der sensorischen Integration der Sinne
- Das Körperschema
- Veränderte Kindheit
- Welche Symptome zeigen hyperaktive Kinder im Alltag?
- Welche Symptome kommen in der Schule hinzu?
- Wie sollte ein Lehrer mit einem hyperaktiven Kind im Unterricht umgehen?
- Die Diagnose
- Verschiedene Therapieformen
- Verhaltenstherapie
- Kinderpsychotherapie
- Logopädie
- Ergotherapie
- Spieltherapie
- Psychomotorik
- Medikamentöse Behandlung
- Familientherapie
- SPORTFÖRDERUNTERRICHT ALS SPEZIELLE THERAPIEFORM IN DER SCHULE
- Was ist Sportförderunterricht?
- Warum Sportförderunterricht in der Schule?
- Verändertes Gesundheitsverständnis
- Veränderte Kindheit
- Entstehungsgeschichte des Sportförderunterrichts
- Aufgabenbereiche und Zielsetzungen
- Zielgruppe
- Die Auswahl der Kinder
- Inhaltsbereiche
- Wahrnehmungsförderung
- Motorische Wahrnehmung
- Soziale, emotionale und kognitive Förderung
- Organisatorische und didaktische Überlegungen
- PRAKTISCHER TEIL
- Beschreibung der Schule
- Zur Auswahl der Kinder für den Sportförderunterricht
- Eine Beschreibung der Sportfördergruppe an der Schule
- Entwicklungsgeschichte eines ADHS- Jungen von der Geburt bis heute
- Auffälligkeiten des ADHS- Jungen im Unterricht
- Möglichkeiten des Sportförderunterrichts in Hinblick auf seine Auffälligkeiten
- Eine Sportförderstunde zum Thema Sozialverhalten
- Verhalten des ADHS- Jungen in dieser Stunde
- Eine Sportförderstunde zum Thema Körperschema
- Verhalten des ADHS- Jungen in dieser Stunde
- Kurzfristige Auswirkungen des Sportförderunterrichts im regulären Unterricht
- Langfristige Veränderungen durch den Sportförderunterricht seit Schulbeginn
- Eine Zusammenfassung der praktischen Beobachtungen
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Thematik hyperaktiver Kinder im Schulunterricht und dem Sportförderunterricht als möglicher Hilfe. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis für die Ursachen und Symptome von Hyperaktivität zu entwickeln und die Möglichkeiten des Sportförderunterrichts in der pädagogischen Praxis zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung von Hyperaktivität
- Mögliche Ursachen und Symptome von Hyperaktivität
- Eignung des Sportförderunterrichts als spezielle Therapieform
- Praktische Anwendung des Sportförderunterrichts in einem konkreten Fall
- Bewertung der Auswirkungen des Sportförderunterrichts auf das Lernverhalten und die soziale Integration des Kindes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Themenauswahl, den Aufbau der Arbeit und die Relevanz des Themas beleuchtet. Kapitel 2 widmet sich der Hyperaktivität, indem es die allgemeine Begriffsklärung, Definitionsversuche, den historischen Abriss sowie mögliche Ursachen und Symptome beleuchtet. Die Diagnose und verschiedene Therapieformen werden ebenfalls behandelt.
Kapitel 3 untersucht den Sportförderunterricht als spezielle Therapieform in der Schule, einschließlich seiner Entstehung, Aufgabenbereiche, Zielsetzungen, Zielgruppe und Inhaltsbereiche. Der praktische Teil der Arbeit (Kapitel 4) beschreibt eine konkrete Schule und die Auswahl der Kinder für den Sportförderunterricht, einschließlich der Entwicklungsgeschichte eines ADHS- Jungen. Es werden die Auffälligkeiten des Jungen im Unterricht, die Möglichkeiten des Sportförderunterrichts in Hinblick auf seine Auffälligkeiten sowie zwei konkrete Sportförderstunden zum Thema Sozialverhalten und Körperschema dargestellt.
Schlüsselwörter
Hyperaktivität, ADHS, Sportförderunterricht, Schule, Therapie, Pädagogik, Sozialverhalten, Körperschema, Lernverhalten, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptsymptome von ADHS in der Schule?
Dazu gehören übermäßige Impulsivität, ständige Unruhe, Konzentrationsschwäche und ein ausgeprägter Bewegungsdrang.
Welche Ursachen für Hyperaktivität werden diskutiert?
Die Arbeit nennt genetische, organische, ökologische und psychosoziale Faktoren sowie Störungen der sensorischen Integration.
Wie kann Sportförderunterricht Kindern mit ADHS helfen?
Er fördert die motorische Wahrnehmung, das Sozialverhalten und das Körperschema und bietet einen kontrollierten Raum für den Bewegungsdrang.
Welche Therapieformen neben Sport gibt es?
Dazu zählen Verhaltenstherapie, Ergotherapie, Logopädie, Spieltherapie und medikamentöse Behandlungen.
Welche Ziele verfolgt die Wahrnehmungsförderung?
Ziel ist es, die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung durch gezielte motorische Reize und Übungen zu stärken.
- Citation du texte
- Jana Frankenberg (Auteur), 2004, Hyperaktive Kinder im Unterricht und der Sportförderunterricht als mögliche Hilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43696