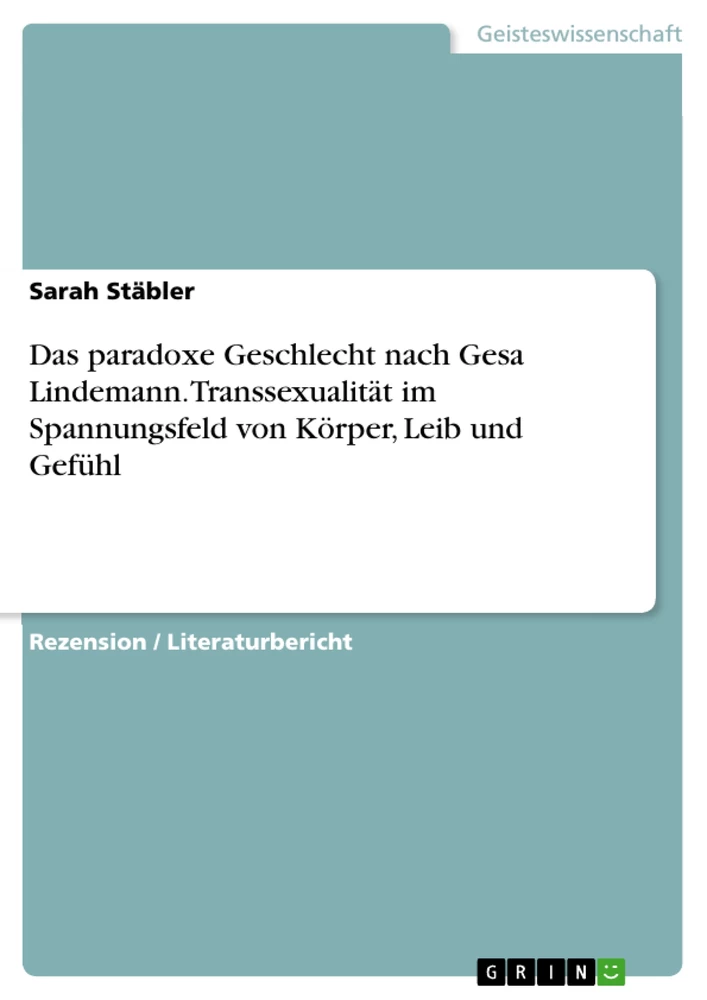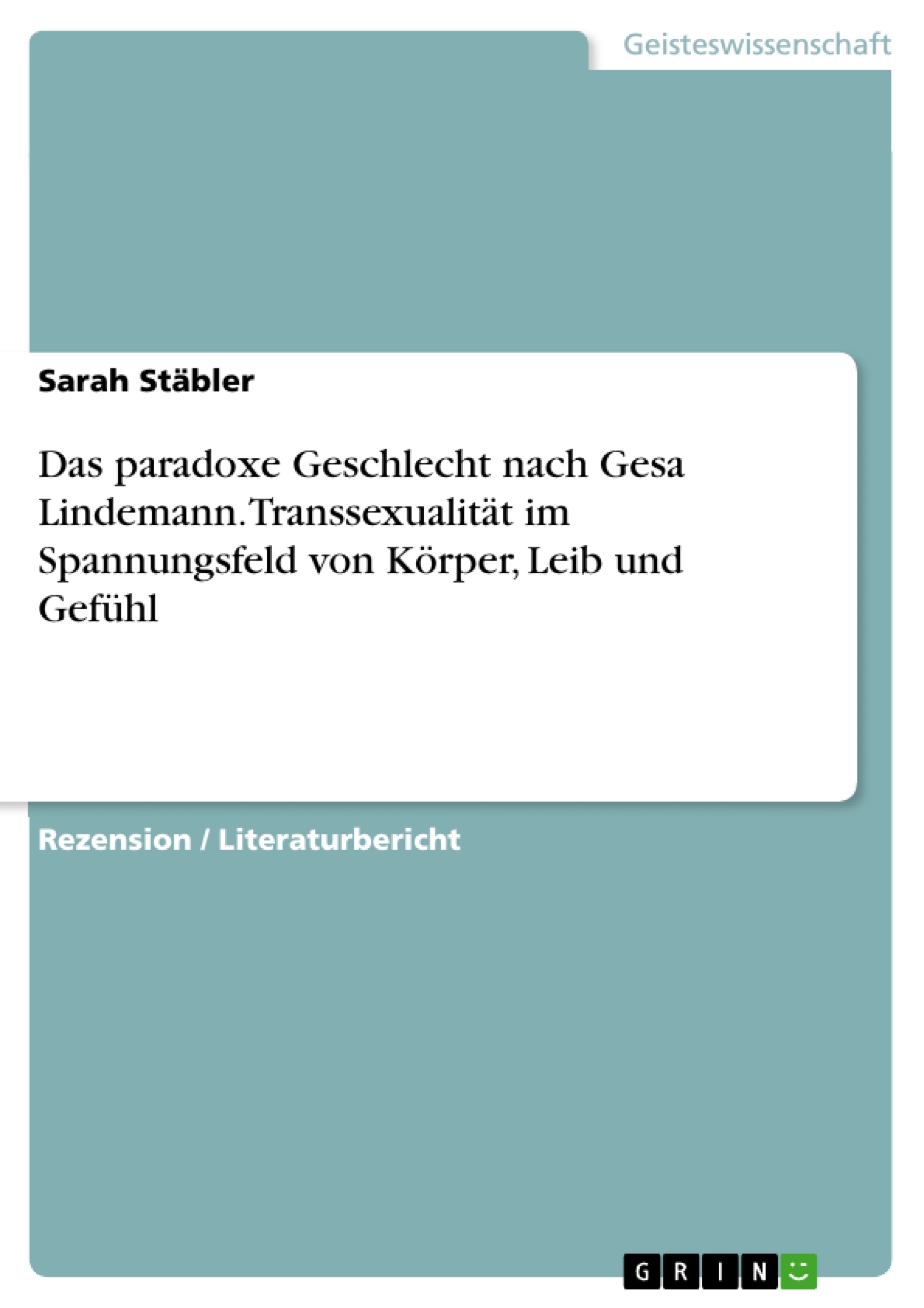Gesa Lindemanns mikrosoziologische Studie „Das paradoxe Geschlecht“ von 2011 ist eine überarbeitete Version ihres gleichnamigen 1993 erschienenen Werks. Lindemann begeht diese Feldforschung von einem zweigeteilten Standpunkt aus, zum Einen als Beraterin von Transsexuellen und Personen ihres sozialen Umfeldes im Rahmen der Berliner Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, zum Anderen als Soziologin, die diese Position nutzt um eine Feldstudie durchzuführen. Sie selbst empfindet sich in diesem sehr heterogenen Feld als Komplize und Fremdling zugleich, was ihr sowohl Vor- als auch Nachteile in den Interviewsituationen bot: Sie muss analytisch zerlegen was sie an geschlechtlicher Wirklichkeit mitträgt und sich zugleich einer doppelten Verfremdung unterziehen. Neben diesen eigens gesammelten Daten stützt sich ihre Studie „auf schriftliches Material wie Gerichtsurteile, Autobiographien, Berichte in der allgemein zugänglichen Presse und Szenezeitschriften“.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Theoretische Grundlagen und leiblich-affektive Konstruktion von Geschlecht
- Kapitel 2: Herauslösen aus interaktiven Zwängen des Ausgangsgeschlechts
- Kapitel 3: Wirklichkeit des neuen Geschlechts und Folgen der Geschlechtsveränderung
- Kapitel 4: Sprachliche Auswirkungen der Geschlechtsänderung
- Kapitel 5: Systematische Analyse der Geschlechtsunterschiede und azentrische Form der Geschlechterunterscheidung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie von Gesa Lindemann zielt darauf ab, Transsexualität aus mikrosoziologischer Perspektive zu untersuchen und die Bedeutung dieses Phänomens für die soziale Konstruktion von Geschlecht zu beleuchten. Sie nutzt dabei empirische Daten aus Interviews und schriftlichem Material, um ihre theoretischen Überlegungen zu stützen.
- Soziale Konstruktion von Geschlecht als leiblich-affektive Konstruktion
- Erfahrungen und Herausforderungen von Transsexuellen im Alltag
- Veränderungen in sozialen Beziehungen im Zuge der Geschlechtsumwandlung
- Sprachliche und soziale Anpassungsprozesse
- Azentrische Form der Geschlechterunterscheidung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Theoretische Grundlagen und leiblich-affektive Konstruktion von Geschlecht: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Studie dar. Lindemann reformuliert die These der sozialen Konstruktion des Geschlechts als "leiblich-affektive Konstruktion", verbindend leibliche Erfahrungen mit sozialen Strukturen. Sie untersucht die alltägliche Reproduktion der Geschlechterordnung und legt den Fokus auf die Interaktion zwischen individuellem Erleben und gesellschaftlichen Normen. Der Bezug auf Plessners Theorie der exzentrischen Positionalität und Schmitz' Konzept der leiblich-affektiven Umweltbeziehung ist zentral für die Argumentation.
Kapitel 2: Herauslösen aus interaktiven Zwängen des Ausgangsgeschlechts: Hier beschreibt Lindemann den Prozess, wie Transsexuelle sich aus den interaktiven Zwängen ihres Ausgangsgeschlechts lösen. Die Autorin betont das "Aushaken" aus der bestehenden leiblich-affektiven Umweltbeziehung und das anschließende "Einhaken" in eine neue, vom neuen Geschlecht bestimmte Beziehung. Dieser Prozess wird als komplex und herausfordernd dargestellt, mit Fokus auf die Veränderungen in der sozialen Interaktion und die Bewältigung von Erwartungen und Normen der Gesellschaft.
Kapitel 3: Wirklichkeit des neuen Geschlechts und Folgen der Geschlechtsveränderung: Dieses Kapitel beleuchtet die Wirklichkeit des neuen Geschlechts und die daraus resultierenden Auswirkungen für die Betroffenen und ihr soziales Umfeld. Lindemann analysiert die Veränderungen in den Beziehungen zu gleich- und verschiedengeschlechtlichen Personen und betont die Bedeutung der Zukunftsgestaltung für Transsexuelle. Der zirkuläre Aufbau des Kapitels spiegelt den Prozess der Geschlechtsveränderung wider, von den anfänglichen Schwierigkeiten bis hin zur Konstruktion des neuen Geschlechts.
Kapitel 4: Sprachliche Auswirkungen der Geschlechtsänderung: Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die sprachlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Geschlechtsänderung. Die Autorin untersucht die Verwendung von Personalpronomen und Vornamen und beleuchtet die Schwierigkeiten, die sich daraus für die Betroffenen und ihr Umfeld ergeben. Dieser Abschnitt zeigt, wie eng sprachliche Benennung mit der sozialen Anerkennung und Integration des neuen Geschlechts verknüpft ist.
Schlüsselwörter
Transsexualität, mikrosoziologische Studie, Geschlechterdifferenz, Verschiedengeschlechtlichkeit, leiblich-affektive Konstruktion, exzentrische Positionalität, soziale Konstruktion von Geschlecht, Umweltbeziehung, Geschlechtsveränderung.
Häufig gestellte Fragen zur Studie "Transsexualität: Mikrosoziologische Studie zur leiblich-affektiven Konstruktion von Geschlecht"
Was ist das zentrale Thema der Studie von Gesa Lindemann?
Die Studie untersucht Transsexualität aus einer mikrosoziologischen Perspektive und beleuchtet die Bedeutung dieses Phänomens für die soziale Konstruktion von Geschlecht. Sie basiert auf empirischen Daten aus Interviews und schriftlichem Material.
Welche theoretischen Grundlagen verwendet die Studie?
Die Studie reformuliert die These der sozialen Konstruktion von Geschlecht als "leiblich-affektive Konstruktion", verbindend leibliche Erfahrungen mit sozialen Strukturen. Sie bezieht sich auf Plessners Theorie der exzentrischen Positionalität und Schmitz' Konzept der leiblich-affektiven Umweltbeziehung.
Welche Kapitel umfasst die Studie und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Studie besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 legt die theoretischen Grundlagen dar (leiblich-affektive Konstruktion von Geschlecht). Kapitel 2 beschreibt den Prozess des Loslösens von den interaktiven Zwängen des Ausgangsgeschlechts. Kapitel 3 beleuchtet die Wirklichkeit des neuen Geschlechts und die Folgen der Geschlechtsveränderung. Kapitel 4 konzentriert sich auf die sprachlichen Auswirkungen der Geschlechtsänderung. Kapitel 5 analysiert systematisch Geschlechtsunterschiede und eine azentrische Form der Geschlechterunterscheidung (dieser Kapitelzusammenfassung fehlt im gegebenen Text).
Welche Schlüsselthemen werden in der Studie behandelt?
Schlüsselthemen sind die soziale Konstruktion von Geschlecht als leiblich-affektive Konstruktion, die Erfahrungen und Herausforderungen von Transsexuellen im Alltag, Veränderungen in sozialen Beziehungen im Zuge der Geschlechtsumwandlung, sprachliche und soziale Anpassungsprozesse und eine azentrische Form der Geschlechterunterscheidung.
Welche Methodik verwendet die Studie?
Die Studie stützt sich auf empirische Daten aus Interviews und schriftlichem Material, um die theoretischen Überlegungen zu untermauern.
Welche konkreten Aspekte der Geschlechtsveränderung werden untersucht?
Die Studie untersucht den Prozess des "Aushakens" und "Einhakens" in eine neue leiblich-affektive Umweltbeziehung, Veränderungen in sozialen Beziehungen (zu gleich- und verschiedengeschlechtlichen Personen), sprachliche Herausforderungen (Verwendung von Personalpronomen und Vornamen) und die Zukunftsgestaltung für Transsexuelle.
Welche Rolle spielt die Sprache in der Studie?
Die Studie untersucht die sprachlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Geschlechtsänderung, insbesondere die Verwendung von Personalpronomen und Vornamen und deren Bedeutung für die soziale Anerkennung und Integration des neuen Geschlechts.
Welche zentralen Begriffe werden in der Studie verwendet?
Zentrale Begriffe sind Transsexualität, mikrosoziologische Studie, Geschlechterdifferenz, Verschiedengeschlechtlichkeit, leiblich-affektive Konstruktion, exzentrische Positionalität, soziale Konstruktion von Geschlecht, Umweltbeziehung und Geschlechtsveränderung.
Für wen ist diese Studie relevant?
Diese Studie ist relevant für Wissenschaftler*innen, die sich mit Geschlechterforschung, Soziologie, Transgender-Studies und Sprachwissenschaft beschäftigen. Sie bietet zudem wichtige Einblicke für Menschen, die sich mit Transsexualität auseinandersetzen.
- Quote paper
- Sarah Stäbler (Author), 2016, Das paradoxe Geschlecht nach Gesa Lindemann. Transsexualität im Spannungsfeld von Körper, Leib und Gefühl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434373