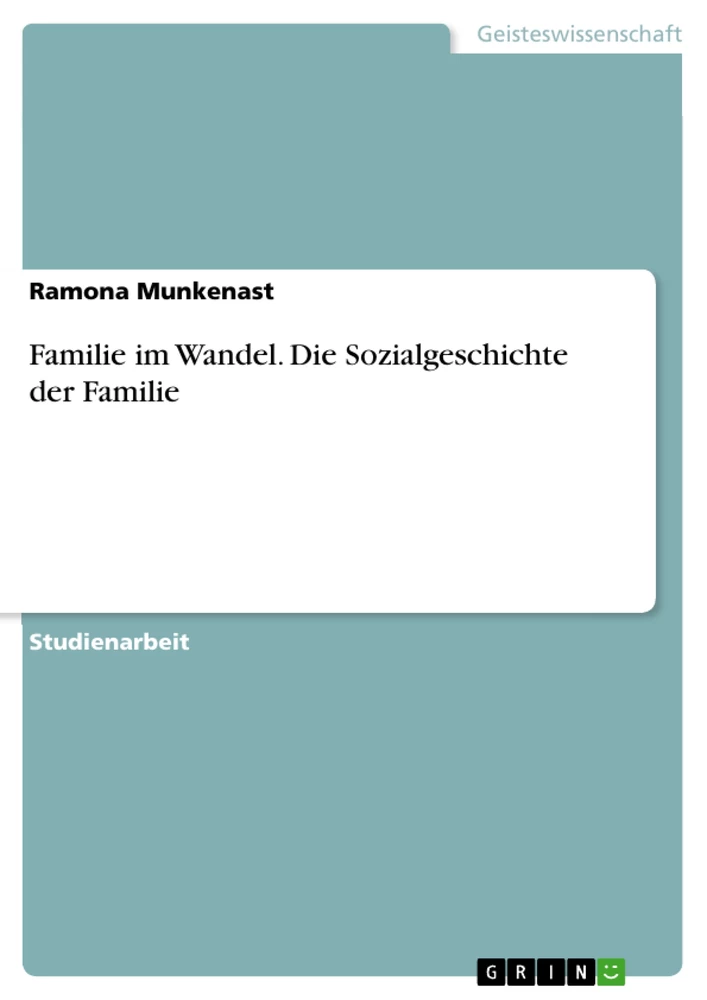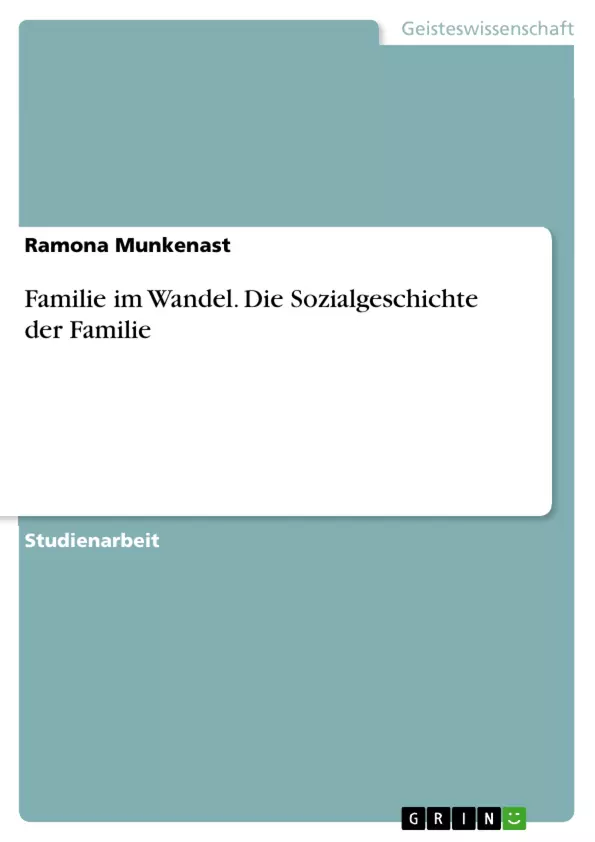Der Stellenwert der Familie hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert. Die stärkste Veränderung ist aktuell die steigende Scheidungsrate, der Rückgang von Eheschließungen und der Geburtenrückgang seit Mitte der sechziger Jahre. Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften, Wohngemeinschaften und Einpersonenhaushalte steigen immer weiter an.
Das traditionelle Familienmodell dominiert aber nach wie vor noch. Diejenigen, die versuchen, die neuen Lebensformen nicht am klassischen Familienmodell zu messen, verwenden den Begriff Familienkonstellation. Darunter versteht man auch „Ein-Elternteil-Familien“, „Zweitfamilien“, „Ein-Kind-Familie“, „Patchworkfamilien“, „geteilte Familien“, „postfamilialen Familien“, „Fortsetzungsfamilien“ und vielen mehr. Nicht nur die Lebensformen ändern sich, sondern auch die Bedeutung der Familie.
Die Vorstellungen über Geschlechter, Geschlechterverhältnissen, Partnerschaften, eingetragene Lebensgemeinschaften, Ehen und Familien werden überholt. Dabei wird besonders darauf geachtet, welche Bedeutung diese intimen Sozialbeziehungen für die Menschen haben und welche Akzeptanz oder Ablehnung sie in der Gesellschaft erfahren. Dabei geht es nicht nur um die Homoehe und Gleichberechtigung. Auch Paare mit unterschiedlicher Herkunft oder einer niedrigeren Schicht erleiden oft Ablehnung oder Wiederstand.
Auch die Medien spielen eine erhebliche Rolle. Immer wieder ist in den Medien von „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ die Rede. Dabei meinen die Medien aber nicht „Bekommt mehr Kinder und schiebt sie dann in die Ganztagesgrippe oder Kindertagesstätten ab und geht mehr arbeiten, um eure Familie ernähren zu können“, sondern viel mehr „Wie kann ich familienfreundlichere Arbeitsplätze schaffen?“ Wenn das Thema von Vereinbarkeit von Familie und Beruf angesprochen wird, ist klar, dass sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft etwas getan werden muss.
Das „klassische“ Modell der „Hausfrau“ und des „Geldverdieners“ existiert und funktioniert nicht mehr. Noch dazu kommt, dass viele Frauen heutzutage auch arbeiten gehen wollen, weil sie nicht den ganzen Tag Zuhause sitzen und auf die Kinder aufpassen, sondern sich auch unabhängig von den Männern machen wollen oder müssen. Denn eine Ehe zu führen heißt lange nicht mehr: „Bis dass der Tod uns scheidet.“ Nach mehrjähriger Babypause wieder Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen ist schwer. Doch wie hat sich die Familie eigentlich im Wandel der Zeit entwickelt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deffinition „Familie“
- Vorwort
- Familien im Wandel der Zeit
- Die germanische Sippe
- Familien im Mittelalter
- Familien in der Neuzeit
- Familie im Kaiserreich
- Die bürgerliche Familie
- Die proletarische Familie
- Familie in der Weimarer Republik
- Familie im Nationalsozialismus
- Staatliches Eingreifen in Familie und Erziehung
- Familie in der Nachkriegszeit
- Familie in der Bundesrepublik Deutschland
- Familie in der Deutschen Demokratischen Republik
- Traditionelle Rollen
- Familie heute
- Wandlungsprozesse
- Familienzyklen
- Familiäre Interaktionsbeziehungen
- Prekäre Lebenssituationen
- Die Bedeutung und Definition der Familie
- Die Entwicklung der Familienstrukturen von der germanischen Sippe bis zur modernen Familie
- Die Auswirkungen gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Veränderungen auf die Familie
- Die verschiedenen Familienformen und ihre gesellschaftliche Akzeptanz
- Die Rolle der Familie in der modernen Gesellschaft
- Einleitung: Dieses Kapitel führt den Begriff "Familie" ein und definiert ihn. Es stellt zudem das Vorwort dar, in dem die Veränderungen des Stellenwerts der Familie in den letzten Jahrzehnten beleuchtet werden, einschließlich der steigenden Scheidungsraten, dem Rückgang von Eheschließungen und Geburten, sowie dem Anstieg von nichtehelichen Lebensgemeinschaften, Wohngemeinschaften und Einpersonenhaushalten.
- Die germanische Sippe: Das Kapitel beschreibt die Familienstruktur der germanischen Vorfahren, die in "Sippen" mit ihren Verwandten, Knechten und Sklaven zusammenlebten. Es erläutert die Bedeutung der Sippenhaft und die rituellen Handlungen, die mit Heirat und der Aufnahme von Kindern in die Sippe verbunden waren.
- Familien im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Familie im mittelalterlichen Kontext, der durch Zünfte und die mächtige römisch-katholische Kirche geprägt war. Es erklärt die Bedeutung der Ehe als heilige Verbindung, die durch die Kirche besiegelt wurde, und die lange Lebensdauer der Ehen aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und der geringen Lebenserwartung. Außerdem wird die Bedeutung der materiellen Sicherung für die Eheschließung und die begrenzten Möglichkeiten der Partnerwahl im Mittelalter hervorgehoben.
- Familien in der Neuzeit: Dieses Kapitel behandelt die Veränderungen der Familienstrukturen während der Neuzeit, die durch die Entstehung der Manufakturen, die Migration der Menschen in die Städte und die Auswirkungen der Aufklärung geprägt war. Es beleuchtet die Entstehung des Frühkapitalismus, die "soziale Frage" und die Landflucht, die durch die Fabriken in den Städten entstanden. Außerdem werden die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Familie, wie die Notwendigkeit, dass Frauen in den Fabriken mitarbeiten mussten, und die Kinderarbeit thematisiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch befasst sich mit der Sozialgeschichte der Familie und verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Familie im Wandel der Zeit aufzuzeigen. Es analysiert die Veränderungen, die Familienstrukturen, -rollen und -beziehungen im Laufe der Geschichte erfahren haben.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Buches sind Familie, Sozialgeschichte, Familienentwicklung, Familienstruktur, Familienformen, Familienrollen, Geschlechterverhältnisse, gesellschaftliche Veränderungen, politische Veränderungen, wirtschaftliche Veränderungen, Tradition, Moderne, Wandel, Individualisierung, Pluralisierung, Inklusion, Exklusion, gesellschaftliche Akzeptanz, gesellschaftliche Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Stellenwert der Familie in den letzten Jahrzehnten verändert?
Es gibt einen Trend zu höheren Scheidungsraten, weniger Eheschließungen und einer Zunahme alternativer Lebensformen wie Patchworkfamilien oder Einpersonenhaushalten.
Was war die „germanische Sippe“?
Eine frühe Familienstruktur, in der Verwandte, Knechte und Sklaven in einer Solidargemeinschaft (Sippenhaft) zusammenlebten.
Wie sah die Familie im Mittelalter aus?
Die Familie war stark durch die Kirche und Zünfte geprägt; die Ehe galt als heilige, oft materiell begründete Verbindung mit geringer Lebenserwartung.
Welchen Einfluss hatte die Industrialisierung auf die Familie?
Sie führte zur Landflucht, Frauenarbeit in Fabriken und Kinderarbeit, was die traditionellen Strukturen der proletarischen Familie massiv veränderte.
Was bedeutete Familie im Nationalsozialismus?
Der Staat griff massiv in die Familie und Erziehung ein, um sie ideologisch im Sinne des Regimes auszurichten.
Was versteht man unter „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ heute?
Es geht um die politische und wirtschaftliche Herausforderung, familienfreundliche Arbeitsplätze zu schaffen, da das klassische Hausfrauenmodell kaum noch existiert.
- Quote paper
- Ramona Munkenast (Author), 2017, Familie im Wandel. Die Sozialgeschichte der Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/432548