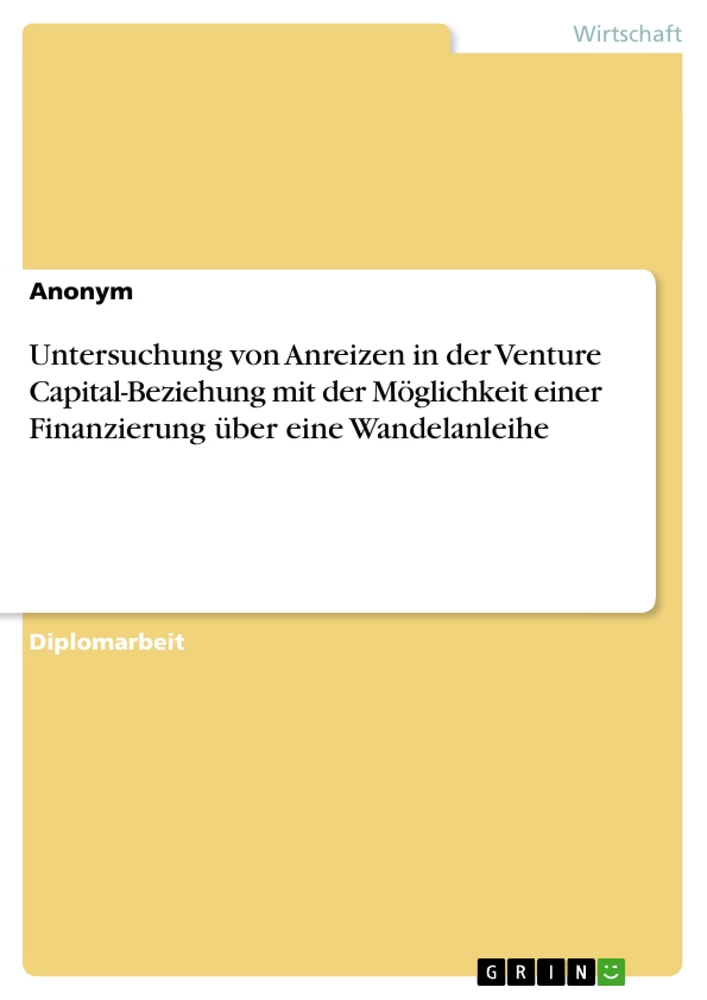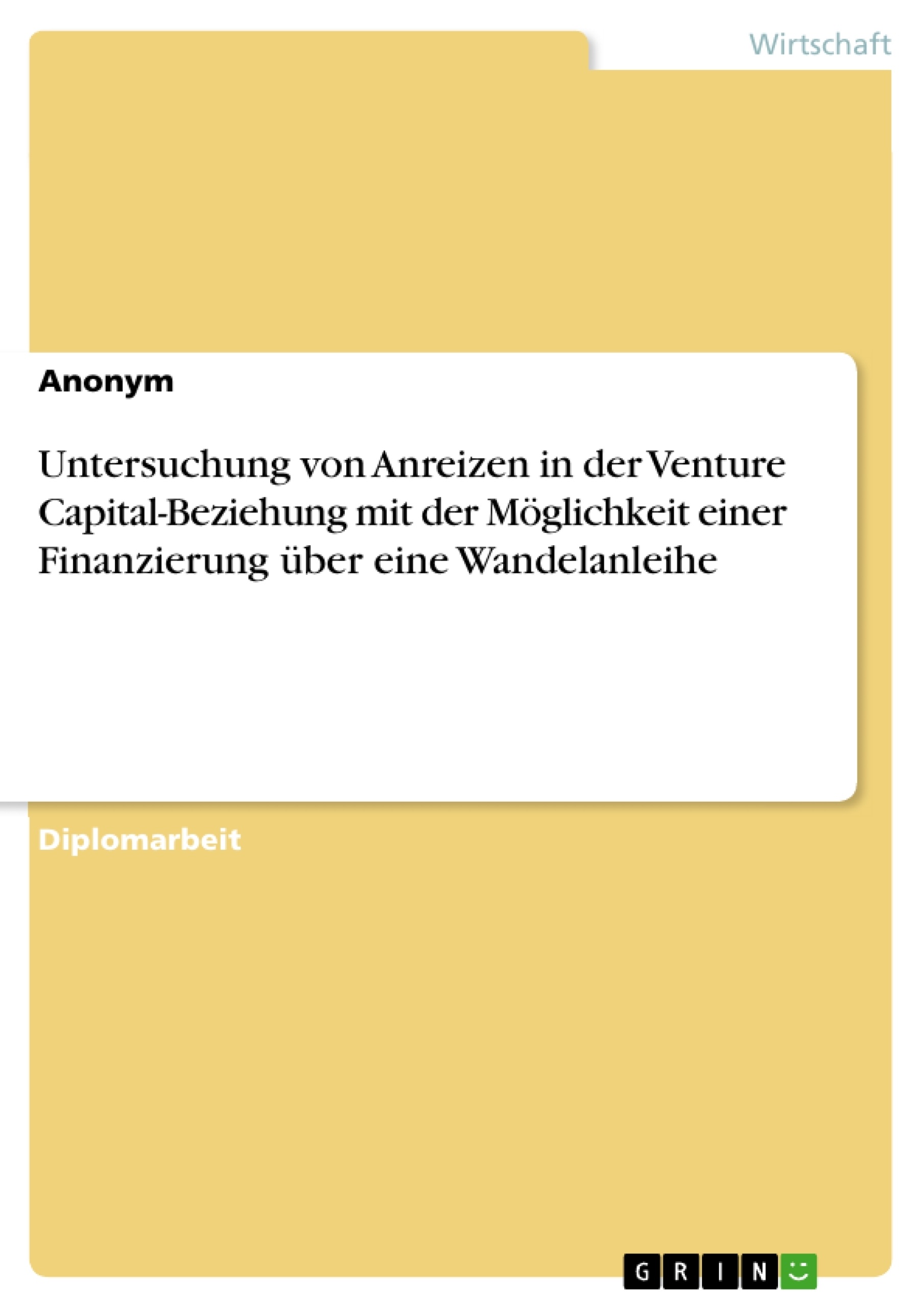Investoren sind bereit, für eine lange Zeitspanne ihr Kapital durch Venture Capital-Gesellschaften jungen innovativen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Die Kapitalgeber kennen deren Fähigkeiten und Verhaltensmuster nicht, da i.d.R. keine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit vorliegen. Die VCG investieren Kapital in Ventures, die keinen oder einen geringfügigen Cash Flow aufweisen können und deren Vermögen lediglich aus Prototypen von Produkten, Patenten oder Ideen besteht. Zudem ist dem Unternehmer zu unterstellen, dass er ein Interesse daran hat, möglichst wenig über sein Innovationsprojekt zu offenbaren, um eine Verbreitung seiner sensiblen Innovation zu verhindern. Bestehende Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeiten des Unternehmers, der Entwicklung von Technologien, Märkten und Desinvestitionsmöglichkeiten sind für die VC-Gesellschaften nur schwer einzuschätzen.
Diese schon für sich genommen erheblichen Unsicherheiten werden durch das momentane Marktumfeld und dem dadurch hervorgerufenen erhöhten Abschreibungsbedarf auf Beteiligungen noch einmal deutlich verstärkt.
In Deutschland werden bisher Möglichkeiten zur Reduzierung dieser Unsicherheiten außerhalb vertraglicher Konstruktionen nur unzureichend genutzt. Auch in der Literatur lassen sich bisher nur vereinzelte Lösungsansätze finden.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, die bestehenden Anreize zur Reduzierung der gravierenden Unsicherheiten einer VC-Finanzierung zu untersuchen und dabei Lösungsansätze zu entwickeln und zu überprüfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Finanzierungstheoretische Analyse einer Venture Capital-Finanzierung...
- 2.1. Neoklassische Finanzierungstheorie
- 2.1.1. Grundlagen der Neoklassik.
- 2.1.2. Irrelevanztheorem und die Separation........
- 2.1.3. Informationseffizienz der Märkte.
- 2.2. Neue Institutionenökonomik
- 3. Theorien der Neuen Institutionenökonomik
- 3.1. Property Rights-Ansatz als zentrales Element.
- 3.2. Transaktionskostentheorie……………………....
- 3.3. Agency-Theorie...
- 3.3.1. Überblick und Principal-Agent-Beziehung..\li>
- 3.3.2. Ansätze und Kosten der Agency-Problematik
- 3.4. Ex-ante und ex-post Analyse der Agency-Problematik.
- 3.4.1. Identifikationsproblem vor dem Vertragsabschluss.
- 3.4.1.1. Hidden Information ......
- 3.4.1.2. Adverse Selektion
- 3.4.2. Agency-Problematik nach dem Vertragsabschluss.
- 3.4.2.1. Hidden Action mit der Folge eines Moral Hazard..\li>
- 3.4.2.2. Holdup
- 3.4.2.3. Konsum von nicht-monetären Vorteilen.......
- 3.4.2.4. Konsum am Arbeitsplatz und die Reduktion\nder Arbeitsleistung.
- 4. Klassische Vertragsgestaltung zur Reduzierung von Agency-Problemen...
- 4.1. Venture Capital-Vertrag..\li>
- 4.2. Reduzierung der Informationsasymmetrien vor Vertragsabschluss.......
- 4.2.1. Direkte Informationsübertragung.
- 4.2.2. Indirekte Informationsübertragung
- 4.2.2.1. Signalling ..
- 4.2.2.2. Screening
- 4.3. Reduzierung der Informationsasymmetrien nach Vertragsabschluss
- 4.3.1. Kontrollmechanismen
- 4.3.2. Anreize durch Mitwirkungs- und Entscheidungsrechte.
- 4.3.3. Kapitalrationierung....
- 5. Anreizeffekte von Wandelanleihen in einer Venture Capital-Finanzierung
- 5.1. Marktanalyse.
- 5.2. Begriffsbestimmung und Ansätze einer Wandelanleihe.
- 5.3. Finanzierungskonzept...
- 5.3.1. Ausgangslage
- 5.3.2. Fremdkapitalbezogene Elemente
- 5.3.2.1. Anleihebetrag und Laufzeit
- 5.3.2.2. Kuponsatz und Emissionspreis
- 5.3.2.3. Rückzahlungs- und Tilgungsbedingungen..........\li>
- 5.3.2.4. Besicherung
- 5.3.3. Eigenkapitalbezogene Elemente
- 5.3.3.1. Wandelpreis.
- 5.3.3.2. Kapitalstruktur der Finanzierung ..
- Reduzierung von Informationsasymmetrien in VC-Beziehungen
- Anwendung der Agency-Theorie auf Venture Capital-Finanzierungen
- Analyse von Anreizsystemen zur Reduzierung von Unsicherheiten
- Bewertung des Potenzials von Wandelanleihen in der VC-Finanzierung
- Entwicklung eines Finanzierungskonzepts auf Basis der Wandelanleihe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Untersuchung von Anreizen in der Venture Capital-Beziehung und den Möglichkeiten, die Unsicherheiten in dieser Beziehung durch eine Wandelanleihe zu reduzieren. Der Fokus liegt darauf, Lösungsansätze für die Herausforderungen der Venture Capital-Finanzierung zu entwickeln und zu überprüfen. Die Arbeit betrachtet dabei verschiedene Theorien der Neuen Institutionenökonomik und deren Anwendung auf die VC-Finanzierung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik der Venture Capital-Finanzierung ein und beschreibt die besonderen Herausforderungen, die sich aus den Informationsasymmetrien zwischen Investoren und jungen Unternehmen ergeben. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die relevanten finanzierungstheoretischen Grundlagen, insbesondere die neoklassische Finanzierungstheorie und die Neue Institutionenökonomik. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den verschiedenen Theorien der Neuen Institutionenökonomik, insbesondere mit dem Property Rights-Ansatz und der Agency-Theorie. Kapitel 4 beleuchtet klassische Vertragsgestaltungsmechanismen zur Reduzierung von Agency-Problemen und diskutiert verschiedene Ansätze zur Informationsübertragung und Kontrollmechanismen. Kapitel 5 analysiert die Anreizeffekte von Wandelanleihen in einer Venture Capital-Finanzierung und stellt ein auf einer Wandelanleihe basierendes Finanzierungskonzept vor.
Schlüsselwörter
Venture Capital, Finanzierungstheorie, Neue Institutionenökonomik, Agency-Problematik, Informationsasymmetrie, Anreizeffekte, Wandelanleihe, Finanzierungskonzept, Vertragsgestaltung, Kontrollmechanismen, Kapitalrationierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit über Venture Capital-Beziehungen?
Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung von Anreizen zur Reduzierung der Unsicherheiten in einer Venture Capital-Finanzierung, insbesondere durch den Einsatz von Wandelanleihen.
Welche Rolle spielt die Agency-Theorie in der VC-Finanzierung?
Die Agency-Theorie hilft dabei, Informationsasymmetrien und Interessenkonflikte zwischen Investor (Principal) und Unternehmer (Agent) vor und nach Vertragsabschluss zu analysieren.
Was versteht man unter "Hidden Information" im Kontext von Startups?
Es beschreibt die Situation vor Vertragsabschluss, in der der Unternehmer mehr über die Qualität seines Projekts weiß als der Investor, was zu adverser Selektion führen kann.
Wie können Wandelanleihen Anreizprobleme lösen?
Wandelanleihen kombinieren Fremd- und Eigenkapitalaspekte, was flexible Rückzahlungs- und Wandlungsoptionen ermöglicht und so die Risiken für den VC-Geber mindert.
Was sind klassische Kontrollmechanismen in VC-Verträgen?
Dazu gehören Informationsübertragung durch Screening und Signalling sowie Mitwirkungsrechte, Entscheidungsrechte und die Kapitalrationierung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2003, Untersuchung von Anreizen in der Venture Capital-Beziehung mit der Möglichkeit einer Finanzierung über eine Wandelanleihe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43182