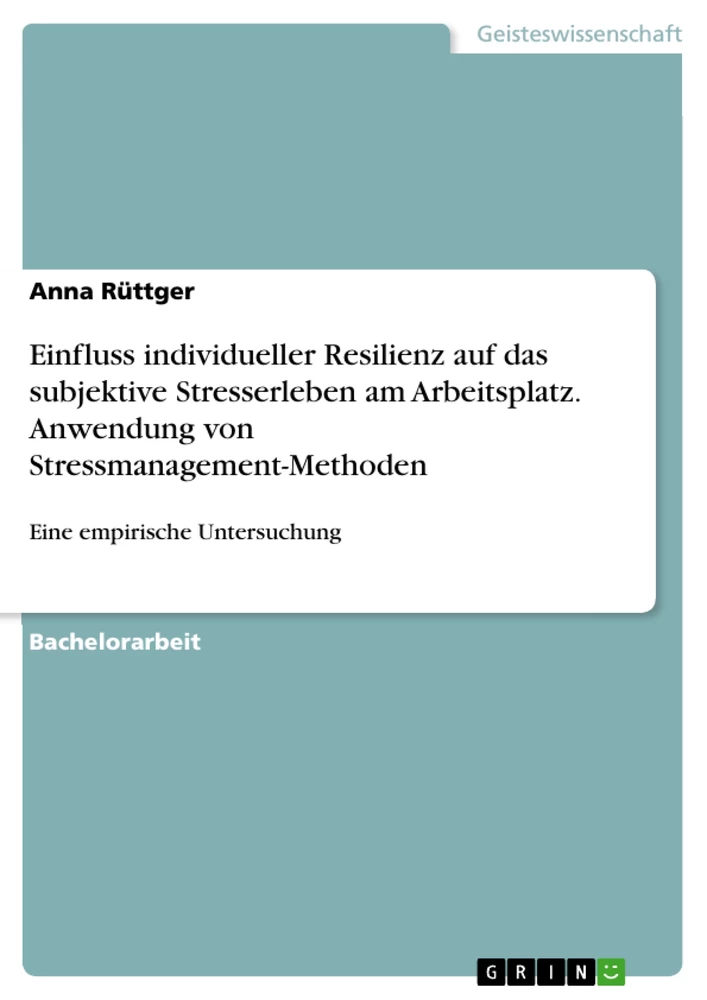Die Arbeit verfolgte primär das Ziel, herauszufinden, ob eine negative Korrelation zwischen Resilienz und dem individuellen Stresserleben am Arbeitsplatz besteht und ob ein möglicher Zusammenhang Unterschiede in der Belastbarkeit von Mitarbeitern erklären kann. Da Stressmanagement-Methoden im Hinblick auf Prävention und Intervention von Stress zunehmend in den Vordergrund rücken und Resilienz erweiterbar ist, wurde ebenso untersucht, welche Rolle die Anwendung von Stressmanagement-Methoden einnimmt und in welcher Beziehung Stressmanagement zu Resilienz und individuellem Stresserleben steht.
Darüber hinaus wurden auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse Ansätze zur Stressbewältigung am Arbeitsplatz abgeleitet, um kurz- und langfristige Stressfolgen weitestgehend beseitigen zu können oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Diese Handlungsempfehlungen richten sich besonders an Unternehmen beziehungsweise Arbeitgeber, da die vorliegende Arbeit sich mit Stress am Arbeitsplatz beschäftigt, welcher primär durch arbeitsbezogene Einflüsse ausgelöst wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Begriffsbestimmung
- Risiko- und Schutzfaktoren
- Entstehungsprozess und Entwicklung von Resilienz
- Stresserleben und -bewältigung
- Stress und arbeitsbedingter Stress
- Belastung und Beanspruchung
- Arbeitspsychologisches Stressmodell
- Stressmanagement
- Ursprünge und aktueller Forschungsstand
- Ableitung der Hypothesen
- Methodik
- Untersuchungsdesign
- Stichprobenkonstruktion
- Messinstrumente
- Resilienzskala RS-13
- Stress- und Coping-Inventar
- Datenanalyse
- Ergebnisse
- Allgemeine Angaben zur Befragung
- Beschreibung der Stichprobe
- Güteprüfung der Skalen zur Erfassung von Resilienz und Stresserleben
- Auswertung der Hypothesen
- Diskussion
- Methodisches Vorgehen
- Interpretation und Diskussion der deskriptiven Ergebnisse
- Interpretation und Diskussion der Hypothesen
- Beitrag der Studie
- Limitationen der Studie
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen hinsichtlich des Stressmanagements für Mitarbeiter
- Fazit und Ausblick für zukünftige Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss individueller Resilienz auf das subjektive Stresserleben am Arbeitsplatz. Die Arbeit analysiert die Anwendung von Stressmanagement-Methoden und untersucht deren Wirkung auf die Beziehung zwischen Resilienz und Stresserleben.
- Der Einfluss von Resilienz auf das Stresserleben am Arbeitsplatz
- Die Bedeutung von Stressmanagement-Methoden für die Bewältigung von Stress
- Die Interaktion zwischen Resilienz, Stressmanagement und Stresserleben
- Empirische Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den genannten Faktoren
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Förderung von Mitarbeiter-Resilienz und Stressbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Stress am Arbeitsplatz und die Rolle von Resilienz und Stressmanagement in diesem Kontext dar. Sie führt in die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit ein.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen und theoretische Konzepte zu den Begriffen Resilienz, Stress und Stressmanagement. Es analysiert die Entstehung und Entwicklung von Resilienz und verschiedene Ansätze zur Stressbewältigung.
- Ursprünge und aktueller Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Einfluss von Resilienz auf das Stresserleben am Arbeitsplatz. Es analysiert relevante Studien und Ergebnisse aus der Literatur zum Thema.
- Ableitung der Hypothesen: Basierend auf den theoretischen Grundlagen und dem Forschungsstand werden Hypothesen formuliert, die in der empirischen Untersuchung geprüft werden sollen.
- Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, einschließlich des Untersuchungsdesigns, der Stichprobenkonstruktion, der verwendeten Messinstrumente und der Datenanalyse.
- Ergebnisse: Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden dargestellt und analysiert. Die Untersuchungsergebnisse zu den Hypothesen werden präsentiert.
- Diskussion: Die Ergebnisse werden im Lichte der theoretischen Grundlagen und des Forschungsstandes diskutiert. Die Interpretation der Ergebnisse und die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis werden beleuchtet.
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für Unternehmen hinsichtlich des Stressmanagements für Mitarbeiter: Basierend auf den Ergebnissen der Studie werden Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Förderung von Mitarbeiter-Resilienz und Stressbewältigung abgeleitet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit den zentralen Themen Resilienz, Stresserleben und Stressmanagement. Sie analysiert den Einfluss individueller Resilienz auf das subjektive Stresserleben am Arbeitsplatz und die Rolle von Stressmanagement-Methoden in diesem Kontext. Dabei stehen Konzepte wie Resilienzfaktoren, Stressbewältigungsmechanismen, Arbeitspsychologie und empirische Forschung im Vordergrund. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Resilienz und Stressmanagement für die Arbeitswelt aufzuzeigen und Handlungsempfehlungen für Unternehmen zu entwickeln.
- Citation du texte
- Anna Rüttger (Auteur), 2018, Einfluss individueller Resilienz auf das subjektive Stresserleben am Arbeitsplatz. Anwendung von Stressmanagement-Methoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431811