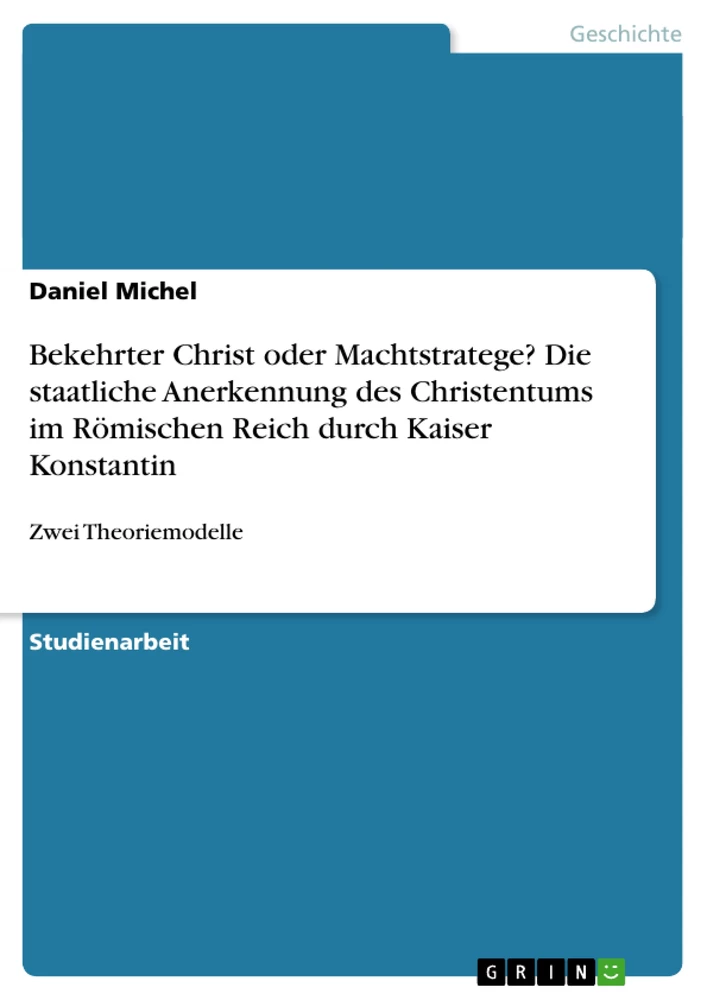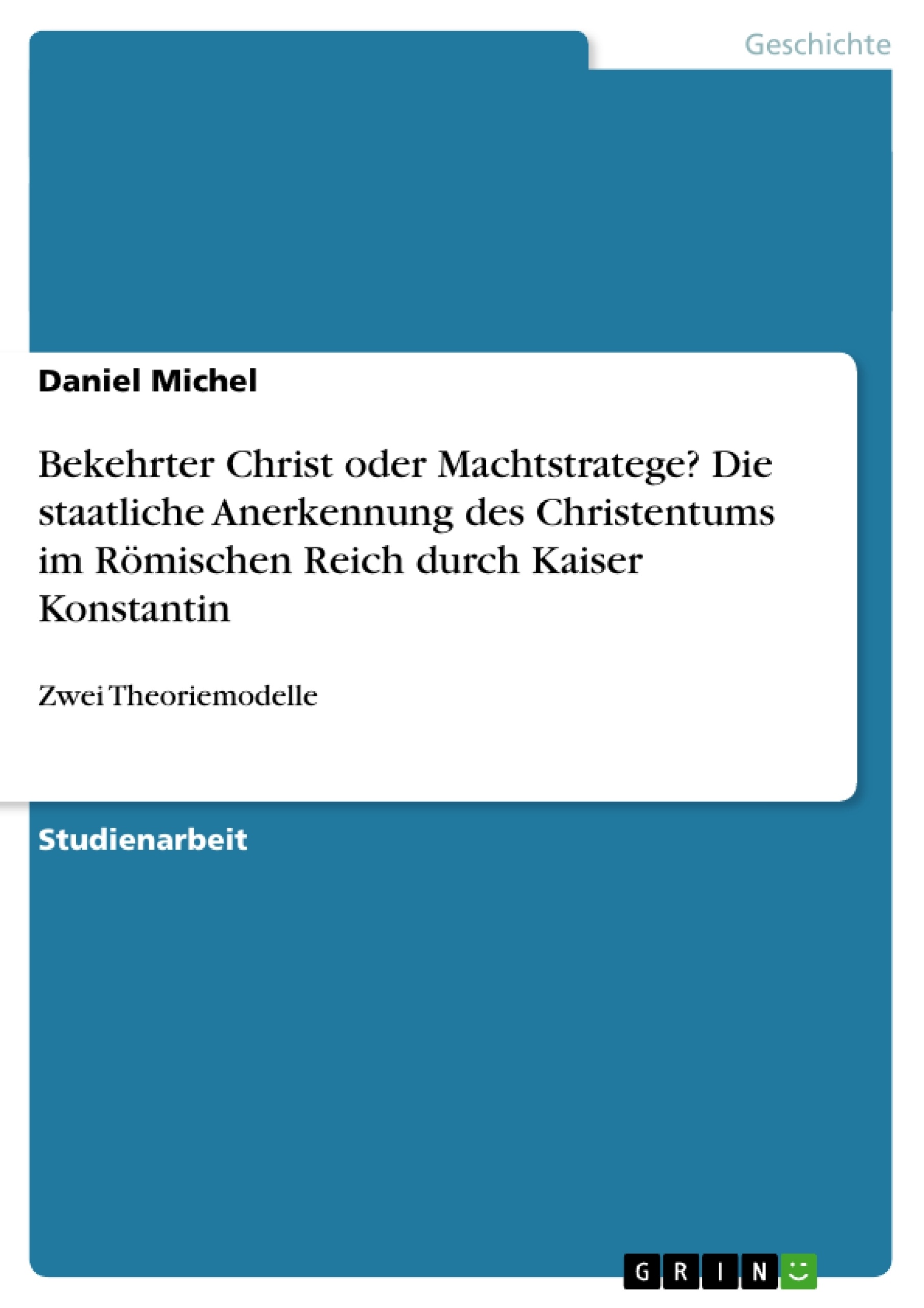Im Jahre 312 fand vor den Toren Roms eine erste Entscheidungsschlacht zwischen zwei Teilkaisern statt. Konstantin griff mit seinem Herr den Usurpator Maxentius an, um ihn aus Rom zu vertreiben. Konstantin siegte, und leitete damit seinen Weg zur Alleinherrschaft im Reich ein, die er 324 mit dem Endsieg über Licinius erreichte. Das Interessante für Geschichtswissenschaftler und Kirchenhistoriker bleibt bis heute zunächst der Oktober des Jahres 312, dem Sieg Konstantins in der Schlacht an der milvischen Brücke über Maxentius - die “konstantinische Wende“?
Hier setzt das Thema dieser Arbeit an. Sie geht zum einen dem Fragekomplex nach, ob, wann und inwieweit Kaiser Konstantin die Anerkennung und den Aufstieg des Christentums aus eigener religiöser Überzeugung ermöglichen wollte und konnte, zum anderen stellt sie parallel die Gegenfrage, ob der Kaiser hierbei ausschließlich mit machtpolitischem Kalkül vorging, um sich auf diese Weise schlussendlich auch den östlichen Teil des Imperiums zu sichern?
Viele und bedeutende Historiker haben sich bereits mit dieser immer wieder neu aufkommenden Frage detailreich auseinandergesetzt. Um hier den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wurden nur einige wenige Autoren aufgenommen, die stellvertretend für die geteilten Forschungsansichten stehen. Hervorzuheben ist in erster Linie das von Ekkehard Mühlenberg herausgegebene Buch “Die konstantinsche Wende“, in dem vor allem für Detailfragen dieses Themas viele Sekundärliteraturhinweise vorzufinden sind. Zusammenfassend für die Autoren der Contra-Seite einer religiösen Motivation Konstantins (u.a. Henri Grégoire, Joseph Vogt, Jakob Burckhardt) steht der Aufsatz von Jochen Bleicken “Konstantin der Große und die Christen“. Für die Beurteilung der konstantinschen Gesetzgebung wurde insbesondere der Kirchenhistoriker Dassmann herangezogen, für ein eher ausgeglichenes Urteil des Themenkomplexes der Althistoriker Bringmann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erklärungsmodelle zur staatlichen Anerkennung des Christentums im römischen Imperium
- Die persönliche Bekehrung Konstantins zum Christentum – die Berichte von Laktanz und Eusebius
- Konstantin als berechnender Machtstratege – die Christen im Osten des Reichs
- Das Pro und Contra zu den Quellenzeugnissen der Christenpolitik Konstantins
- Die Berichte von Laktanz und Eusebius und die Diskussion um das Christogramm
- Der Konstantinbogen und die Debatte um den Siegeseinzug in Rom 312
- Die Begutachtung der Münzprägung – das Silbermedaillon aus Ticinum
- Öffentliche Erklärungen und Schreiben im Rahmen des Donatistenstreits
- Die konstantinische Gesetzgebung
- Die Christen im Osten und ihr Machtpotenzial
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die staatliche Anerkennung des Christentums im römischen Imperium im Kontext der Herrschaft Kaiser Konstantins. Sie fokussiert sich auf die Frage, ob Konstantins Entscheidung, das Christentum zu fördern, auf einer persönlichen Bekehrung zum Glauben oder auf strategischem Machtdenken beruhte.
- Die Rolle der persönlichen Bekehrung Konstantins zum Christentum im Kontext der Schlacht an der milvischen Brücke.
- Die Bedeutung der Christen im Osten des römischen Reiches als machtpolitischer Faktor.
- Die Interpretation von Quellenzeugnissen, wie den Berichten von Laktanz und Eusebius sowie der konstantinischen Gesetzgebung, im Hinblick auf die konstantinische Wende.
- Die Analyse der konstantinischen Politik im Kontext des Donatistenstreits.
- Die Erörterung der Rolle des Christentums in der Sicherung der Macht Konstantins im Osten des Reiches.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt die Schlacht an der milvischen Brücke im Jahr 312 als Ausgangspunkt für die "konstantinische Wende" und stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor.
Das erste Kapitel präsentiert zwei Erklärungsmodelle für die staatliche Anerkennung des Christentums: die persönliche Bekehrung Konstantins und seine Rolle als machtpolitischer Stratege im Osten des Reiches.
Das zweite Kapitel diskutiert die verschiedenen Quellenzeugnisse im Hinblick auf die Christenpolitik Konstantins, einschließlich der Berichte von Laktanz und Eusebius, dem Christogramm, dem Siegeseinzug in Rom, der Münzprägung, Konstantins Schreiben und seiner Gesetzgebung.
Schlüsselwörter
Konstantin der Große, Christentum, römisches Imperium, konstantinische Wende, Bekehrung, Machtstrategie, Christen im Osten, Quellenzeugnisse, Laktanz, Eusebius, Christogramm, Konstantinbogen, Münzprägung, Donatistenstreit, Gesetzgebung.
- Quote paper
- Daniel Michel (Author), 2005, Bekehrter Christ oder Machtstratege? Die staatliche Anerkennung des Christentums im Römischen Reich durch Kaiser Konstantin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43176