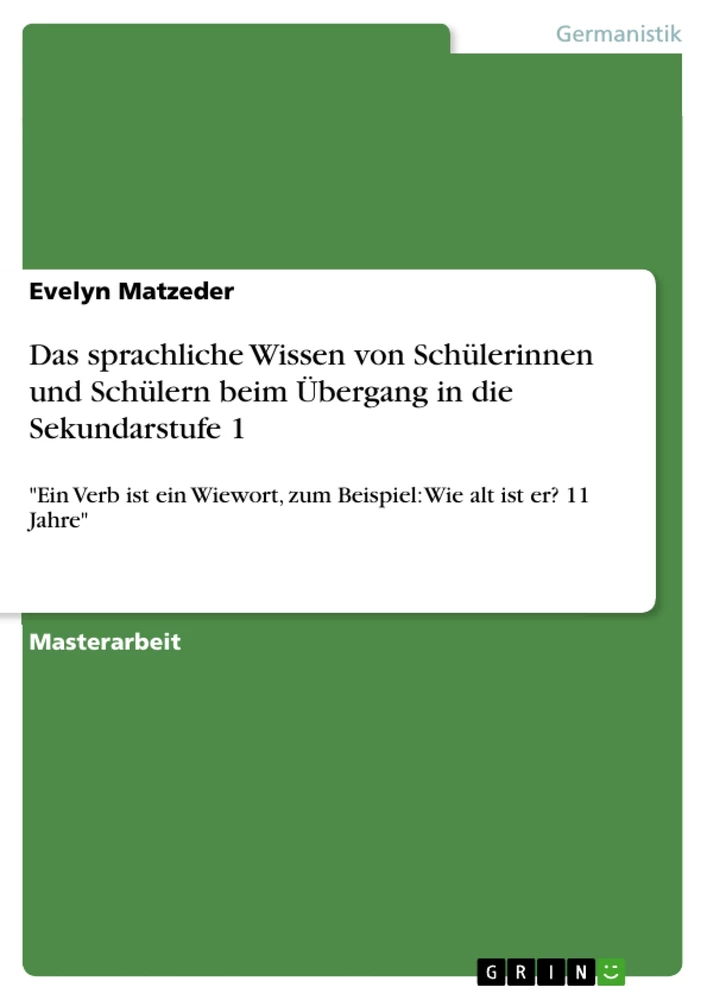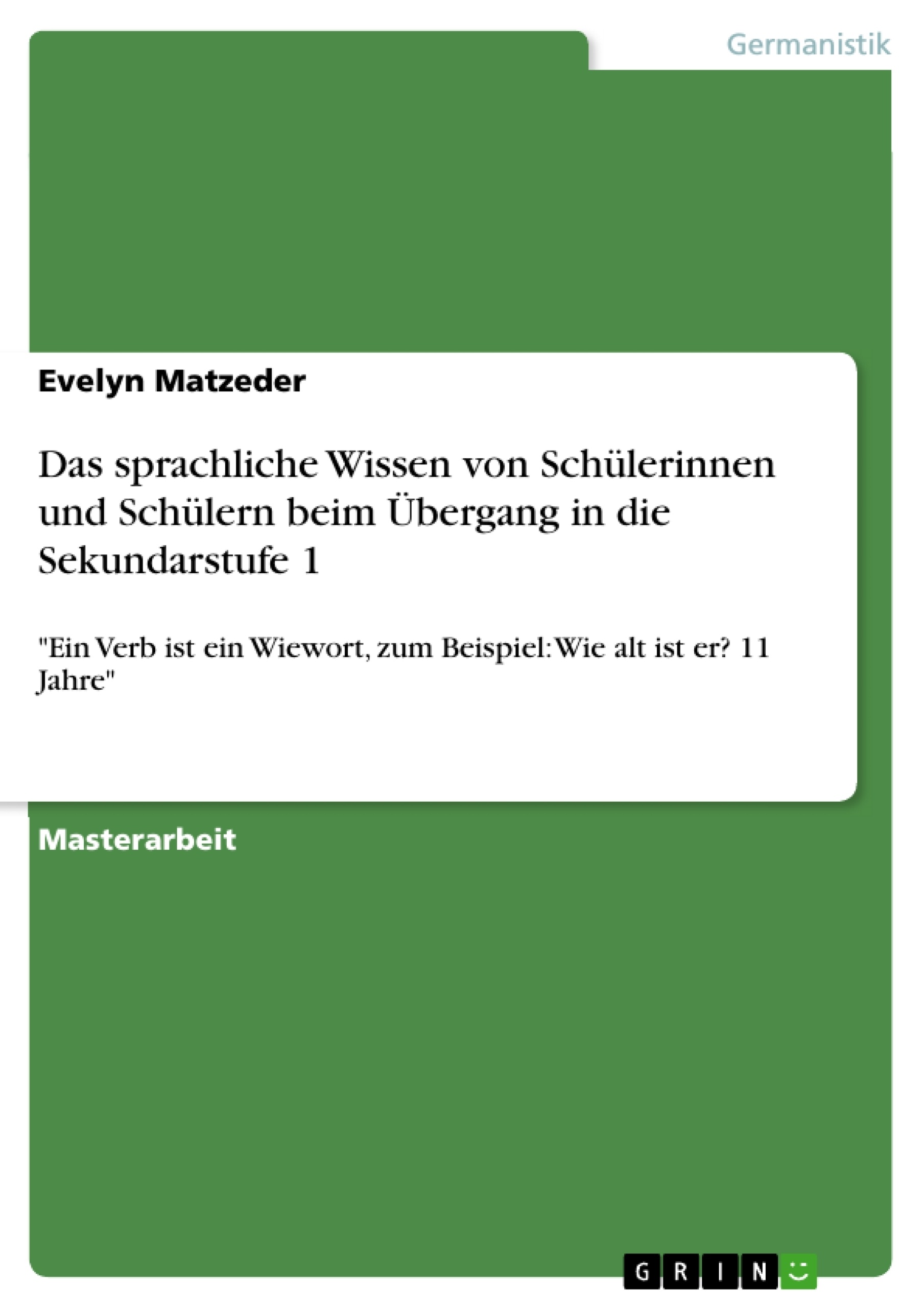"Ein Verb ist ein Wiewort, zum Beispiel wie alt ist er - 11 Jahre". Diese, auch im Titel dieser Arbeit angeführte, Antwort eines Viertklässlers auf die Frage "Was ist ein Verb?" lässt vermuten, dass es um das sprachliche Wissen von Schülern am Ende der Grundschule schlecht bestellt ist. Betrachtet man jedoch die Erklärung des Schülers etwas genauer, so steckt doch einiges an Wissen darin: Gut, der Schüler hat scheinbar die Wortarten Verb und Adjektiv vertauscht, doch die Aussage dass ein Adjektiv ein Wiewort ist, wie er es formuliert, ist so vermutlich in der Mehrzahl von Sprachbüchern aufzufinden. In diesem Zusammenhang konnte er sich wohl auch noch an die dazugehörige Fragetechnik erinnern, die ebenfalls in den meisten Lehrwerken für die Grundschule zu finden ist. Diese hat er dann nach bestem Wissen und Gewissen auf sein Beispiel angewandt und was dabei herauskam, das ist in den ersten Zeilen dieser Einleitung zu lesen: Der Eindruck, dass der Schüler so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann.
Die Frage, die sich aus dieser kleinen Analyse der Schüleräußerung ergibt, kann nicht mehr lauten: Was hat der Schüler falsch gemacht, denn er hat die ihm in der Schule vermittelten Wissensbestände angewandt, die so in vielen aktuellen Sprachbüchern und damit auch im Unterricht vermittelt werden. Vielmehr muss die Frage lauten: Was hat die Schule hier falsch gemacht? Wie kann es dazu kommen, dass Schüler im unterrichtlichen Kontext ein derart diffuses sprachliches Wissen aufbauen, das ihnen in der konkreten Problemsituation keine korrekte Lösung ermöglicht?
Das Ziel dieser Arbeit ist es, das sprachliche Wissen von Schülern am Übergang in die weiterführenden Schulen umfassend zu erheben. Das heißt, dass insbesondere die verschiedenen Wissensarten und deren Zusammenspiel im Sinne von Wissen, Können und Bewusstheit im Mittelpunkt stehen. Zudem soll geklärt werden, wie es im schulischen Kontext zu dem vorhandenen bzw. nicht vorhandenen sprachlichen Wissen kommen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG
- 1.2 VORGEHEN UND GLIEDERUNG
- 1.3 FORSCHUNGSSTAND
- 1.3.1 WISSENSPSYCHOLOGIE
- 1.3.2 SPRACHLICHES WISSEN ZU DEN WORTARTEN/ ZUM VERB
- 1.3.3 ZUSAMMENFASSUNG
- 2. SPRACHLICHES WISSEN
- 2.1 WAS IST ÜBERHAUPT WISSEN? - EIN EXKURS IN DIE WISSENSPSYCHOLOGIE
- 2.1.1 DEKLARATIVES WISSEN
- 2.1.2 PROBLEMLÖSEWISSEN
- 2.1.3 PROZEDURALES WISSEN
- 2.1.4 METAKOGNITIVES WISSEN
- 2.2 EINE DEFINITION - SPRACHLICHES WISSEN
- 2.2.1 DEKLARATIVES SPRACHWISSEN
- 2.2.2 SPRACHLICHES PROBLEMLÖSEWISSEN
- 2.2.3 PROZEDURALES SPRACHWISSEN
- 2.2.4 METAKOGNITIVES SPRACHWISSEN
- 2.3 ENTWICKLUNG SPRACHLICHEN WISSENS
- 2.3.1 IM EINSPRACHIGEN KONTEXT
- 2.3.2 IM MEHRSPRACHIGEN KONTEXT
- 2.4 NOTWENDIGKEIT SPRACHLICHEN WISSENS
- 2.1 WAS IST ÜBERHAUPT WISSEN? - EIN EXKURS IN DIE WISSENSPSYCHOLOGIE
- 3. KOMPETENZMODELLE UND -AUFFASSUNGEN DES DEUTSCHUNTERRICHTS
- 3.1 SPRACHLICHE KOMPETENZ NACH STEINIG UND HUNEKE
- 3.2 SPRACHLICHE KOMPETENZAUFFASSUNG DER DESI-STUDIE
- 3.3 KOMPETENZMODELL FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT NACH JAKOB OSSNER
- 3.4 FAZIT
- 4. DAS VERB
- 4.1 LINGUISTISCHE BETRACHTUNG
- 4.1.1 MORPHOLOGISCHE BETRACHTUNG
- 4.1.2 SEMANTISCHE BETRACHTUNG
- 4.1.3 SYNTAKTISCHE BETRACHTUNG
- 4.2 FACHDIDAKTISCHE BETRACHTUNG
- 4.3 UNTERRICHTSREALITÄT
- 4.3.1 CURRICULARE VORGABEN
- 4.3.1.1 Nationale Bildungsstandards
- 4.3.1.2 Bildungsplan Grundschule BW 2004
- 4.3.2 SPRACHBÜCHER
- 4.3.1 CURRICULARE VORGABEN
- 4.4 EINORDUNG DES VERBS IN DAS KOMPETENZMODELL NACH OSSNER
- 4.1 LINGUISTISCHE BETRACHTUNG
- 5. ZUSAMMENFASSUNG
- 6. FORSCHUNGSDESIGN DER QUANTITATIVEN ERHEBUNG
- 6.1 ANLAGE DER EMPIRISCHEN ERHEBUNG
- 6.1.1 STICHPROBE
- 6.1.1.1 Ein bürokratischer Exkurs
- 6.1.1.2 Die endgültige Stichprobe
- 6.1.2 DATENFORMAT
- 6.1.2.1 Test
- 6.1.2.2 Note
- 6.1.1 STICHPROBE
- 6.2 METHODISCHES VORGEHEN
- 6.2.1 DATENERHEBUNG
- 6.2.1.1 Test
- 6.2.1.2 Note
- 6.2.2 DATENAUFBEREITUNG
- 6.2.2.1 Test
- 6.2.2.2 Note
- 6.2.3 DATENAUSWERTUNG
- 6.2.4 GÜTEKRITERIEN
- 6.2.1 DATENERHEBUNG
- 6.1 ANLAGE DER EMPIRISCHEN ERHEBUNG
- 7. ERGEBNISSE DER QUANTITATIVEN ERHEBUNG
- 7.1 DEKLARATIVES SPRACHLICHES WISSEN
- 7.2 SPRACHLICHES PROBLEMLÖSEWISSEN
- 7.3 TYPENBILDUNG
- 7.4 ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das sprachliche Wissen von Schülerinnen und Schülern am Übergang zur Sekundarstufe I. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Ist-Zustand des sprachlichen Wissens zu erfassen und gleichzeitig Ansatzpunkte für einen verbesserten Sprachunterricht aufzuzeigen. Die Studie kombiniert quantitative und qualitative Methoden.
- Erhebung des Ist-Zustandes des sprachlichen Wissens von Schülern am Übergang zur Sekundarstufe I.
- Analyse der Wissensarten (deklarativ, prozedural, metakognitiv) im Kontext des sprachlichen Wissens.
- Untersuchung des Wissens über die Wortart Verb.
- Entwicklung von Implikationen für den Deutschunterricht.
- Evaluation verschiedener Kompetenzmodelle im Deutschunterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Masterarbeit ein, stellt die Forschungsfragen und die Zielsetzung vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz sprachlichen Wissens im Bildungskontext hervorgehoben und der Forschungsstand zum Thema kurz umrissen. Die anhaltende Kritik an den sprachlichen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen, insbesondere im Kontext der PISA-Studie, wird als Ausgangspunkt der Forschungsarbeit benannt.
2. Sprachliches Wissen: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff des sprachlichen Wissens aus wissenspsychologischer Perspektive. Die verschiedenen Wissensarten – deklaratives, prozedurales, und metakognitives Wissen – werden im Detail erklärt und im Hinblick auf ihre Bedeutung für den Spracherwerb und die Sprachverwendung analysiert. Der Abschnitt verdeutlicht die Komplexität des Konstrukts „sprachliches Wissen“ und liefert eine fundierte Grundlage für die weitere Analyse.
3. Kompetenzmodelle und -auffassungen des Deutschunterrichts: In diesem Kapitel werden verschiedene Kompetenzmodelle des Deutschunterrichts vorgestellt und kritisch diskutiert. Die Arbeit analysiert unterschiedliche Ansätze und Auffassungen zur sprachlichen Kompetenz, um ein umfassendes Bild der aktuellen didaktischen Diskussion zu zeichnen. Der Fokus liegt auf der Einordnung und dem Vergleich der verschiedenen Modelle, um die Grundlage für die spätere Analyse des empirischen Datenmaterials zu schaffen.
4. Das Verb: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Betrachtung der Wortart Verb. Es werden linguistische Aspekte wie Morphologie, Semantik und Syntax des Verbs erläutert. Zusätzlich werden fachdidaktische Überlegungen und die Unterrichtsrealität im Hinblick auf die Vermittlung von Wissen über das Verb diskutiert. Hier werden curriculare Vorgaben und die Verwendung des Verbs in gängigen Schulbüchern analysiert.
Schlüsselwörter
Sprachliches Wissen, Wortarten, Verb, Kompetenzmodelle, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, Wissenspsychologie, quantitative Forschung, empirische Studie, Bildungsforschung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Sprachliches Wissen von Schülern am Übergang zur Sekundarstufe I
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht das sprachliche Wissen von Schülerinnen und Schülern am Übergang zur Sekundarstufe I. Sie erfasst den Ist-Zustand des sprachlichen Wissens und sucht nach Ansatzpunkten für verbesserten Sprachunterricht. Die Studie kombiniert quantitative und qualitative Methoden.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Ist-Zustand des sprachlichen Wissens, analysiert verschiedene Wissensarten (deklarativ, prozedural, metakognitiv) im Kontext von Sprache, konzentriert sich auf das Wissen über die Wortart Verb und entwickelt Implikationen für den Deutschunterricht. Sie evaluiert außerdem verschiedene Kompetenzmodelle im Deutschunterricht.
Welche Wissensarten werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet deklaratives, prozedurales und metakognitives Wissen im Kontext des sprachlichen Wissens. Diese Wissensarten werden detailliert erklärt und auf ihre Bedeutung für Spracherwerb und -verwendung analysiert.
Welche Rolle spielt das Verb in der Arbeit?
Das Kapitel über das Verb untersucht linguistische Aspekte (Morphologie, Semantik, Syntax), fachdidaktische Überlegungen und die Unterrichtsrealität (curriculare Vorgaben, Schulbücher). Die Einordnung des Verbs in ein Kompetenzmodell wird ebenfalls behandelt.
Welche Kompetenzmodelle werden analysiert?
Die Arbeit stellt verschiedene Kompetenzmodelle des Deutschunterrichts vor und diskutiert sie kritisch. Der Fokus liegt auf der Einordnung und dem Vergleich der Modelle, um die Analyse des empirischen Datenmaterials zu ermöglichen. Genannt werden unter anderem die Modelle von Steinig und Huneke, die DESI-Studie und das Kompetenzmodell von Jakob Ossner.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Studie kombiniert quantitative und qualitative Methoden. Der quantitative Teil beinhaltet ein Forschungsdesign mit Stichprobenbeschreibung, Datenformat, Datenaufbereitung und -auswertung. Die Gütekriterien der quantitativen Methode werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst sieben Kapitel: Einleitung, Sprachliches Wissen, Kompetenzmodelle im Deutschunterricht, Das Verb, Zusammenfassung der quantitativen Ergebnisse, Forschungsdesign der quantitativen Erhebung und die Ergebnisse der quantitativen Erhebung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachliches Wissen, Wortarten, Verb, Kompetenzmodelle, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, Wissenspsychologie, quantitative Forschung, empirische Studie, Bildungsforschung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Ist-Zustand des sprachlichen Wissens von Schülern am Übergang zur Sekundarstufe I zu erfassen und Ansatzpunkte für einen verbesserten Sprachunterricht aufzuzeigen.
Wo findet man eine detaillierte Gliederung der Arbeit?
Eine detaillierte Gliederung mit allen Unterpunkten findet sich im Inhaltsverzeichnis der Arbeit. Dieses ist im HTML-Code enthalten.
- Quote paper
- Evelyn Matzeder (Author), 2014, Das sprachliche Wissen von Schülerinnen und Schülern beim Übergang in die Sekundarstufe 1, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431646