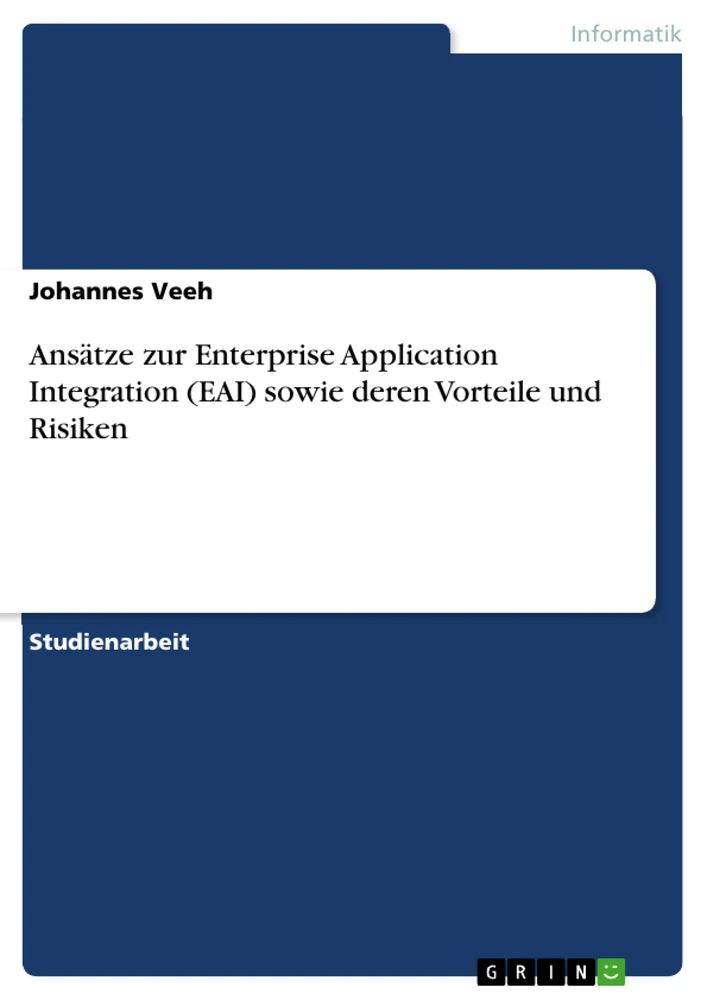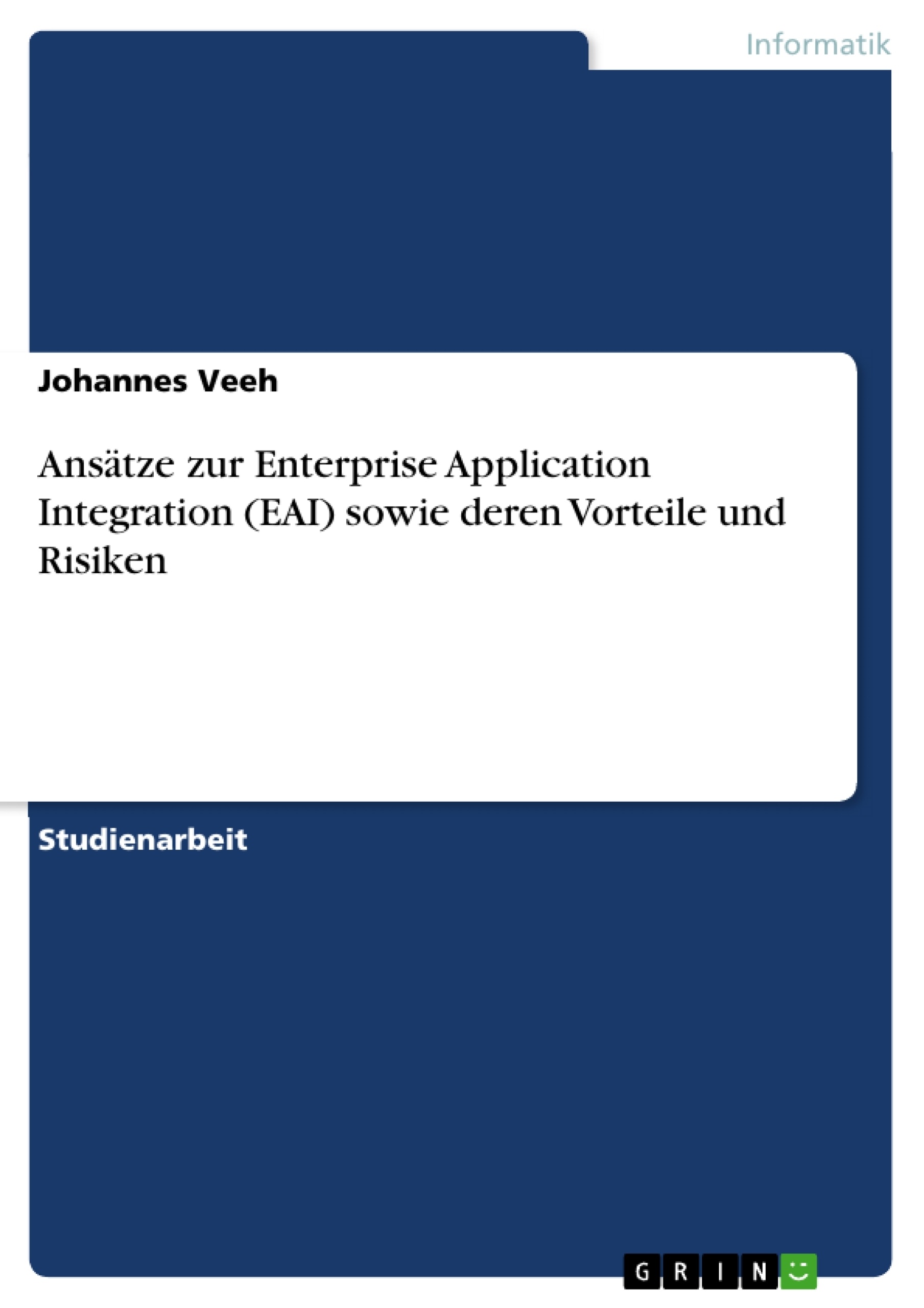Zunächst wird im allgemeinen Teil der vorliegenden Arbeit der Begriff EAI definiert und die mit diesem Konzept erwünschten Ziele erläutert. Daraufhin werden die drei Integrationsarten Präsentations-, Daten- und Funktionsintegration vorgestellt. Wegen des umfangreichen Themas setzt sich der Autor in Kapitel 3 das Ziel, sich mit dem Ablauf zur Einführung einer EAI-Lösung in einem mittelständischen Unternehmen auseinander zu setzen. Da eine EAI-Implementierung keinen Selbstzweck dar-stellt, sondern sich an der Geschäftsstrategie des Unternehmens orientieren muss, ist die richtige Vorgehensweise umso wichtiger, um einen entsprechenden Return on Investment (ROI) für das Projekt zu erreichen. Abschließend werden die Vorteile und die Risiken einer solchen Lösung aufgezeigt und ein Fazit über die vorliegende Arbeit gezogen.
Nicht erst seit der weltweit zunehmenden Globalisierung, durch die sich immer mehr Unternehmen zusammenschließen oder von Konzernen übernommen werden, ist Enterprise Application Integration (EAI) ein wichtiges Thema für die Wirtschaft geworden. Auch das Internet kann als Treiber für den EAI-Einsatz gesehen werden, da der Internetauftritt in vielen Branchen als Kommunikationskanal für weiterführende Services zunehmend an Bedeutung gewinnt. Außerdem sind im Rahmen des Supply Chain Managements (SCM) eine steigende Anzahl an Informationsaustauschbeziehungen zwischen Unternehmen wahrzunehmen, um Kosten- und Geschwindigkeitsvorteile gegenüber anderen Wertschöpfungsketten zu erzielen.
Historisch bedingt gibt es immer noch viele alte Anwendungssysteme, sogenannte Legacy-Systeme, die für wichtige Kernprozesse einer Unternehmung verantwortlich, aber nur unzureichend oder überhaupt nicht integriert sind. Es ist aber nicht immer zielführend sich durch Software-Reengineering dieser Altlasten zu befreien und die Anwendung auf eine neue integrierte Plattform umzustellen. So konnte noch niemand eindeutig beweisen, dass durch eine Umstellung das neue System leichter zu warten, weniger fehleranfällig, sicherer oder transparenter geworden ist. Die von der Wirtschaft geforderte hohe Flexibilität der Anwendungssysteme kann nur erreicht werden, wenn eine technische Lösung geschaffen wird, die es ermöglicht neue Anwendungen mit Legacy-Systemen, sowohl inner-, als auch zwischenbetrieblich zu verbinden, um den größtmöglichen Nutzen für die Geschäftsstrategie herausholen zu können. Eine Antwort für die Verknüpfung der Systeme bietet EAI an.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 2 Grundlagen zu EAI
- 2.1 Definition und Entstehung von EAI
- 2.2 Ziele von EAI
- 2.3 Integrationskonzepte
- 2.3.1 Präsentationsintegration
- 2.3.2 Datenintegration
- 2.3.3 Funktionsintegration
- 3 Vorgehensweise zur Einführung einer EAI-Lösung
- 3.1 Zielsetzung
- 3.2 IST-Analyse
- 3.3 Lösungskonzept
- 3.4 Realisierung
- 4 Vorteile und Risiken von EAI
- 4.1 Vorteile
- 4.2 Risiken
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Enterprise Application Integration (EAI) und deren Bedeutung in der modernen Wirtschaft. Ziel ist es, EAI zu definieren, die Integrationskonzepte zu erläutern und die Vorgehensweise bei der Einführung einer EAI-Lösung darzustellen. Zusätzlich werden die Vor- und Nachteile von EAI betrachtet.
- Definition und Entstehung von EAI
- Integrationskonzepte (Präsentations-, Daten- und Funktionsintegration)
- Vorgehensweise bei der Einführung einer EAI-Lösung
- Vorteile und Risiken von EAI
- Ziele von EAI in Bezug auf Geschäftsprozesse und Systemarchitektur
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Enterprise Application Integration (EAI) ein und erläutert die Motivation für dessen Einsatz. Die zunehmende Globalisierung, der wachsende Einfluss des Internets und die Herausforderungen des Supply Chain Managements (SCM) werden als treibende Kräfte für die Integration heterogener Anwendungssysteme genannt. Die Problematik veralteter Legacy-Systeme und der damit verbundenen Integrationsherausforderungen wird angesprochen. Das Kapitel legt die Zielsetzung der Arbeit fest, die darin besteht, den Ablauf der Einführung einer EAI-Lösung in einem mittelständischen Unternehmen zu untersuchen und die Vor- und Nachteile einer solchen Lösung aufzuzeigen.
2 Grundlagen zu EAI: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition von EAI, beschreibt dessen Entstehung und Entwicklung im Kontext der sich verändernden Systemlandschaften von Unternehmen. Es werden die Ziele von EAI erläutert, die in der Optimierung und Erweiterung von Geschäftsprozessen durch Konsolidierung und Koordination heterogener Anwendungssysteme liegen. Ein wichtiger Aspekt ist die Erreichung einer einheitlichen Datenzugriffsmöglichkeit und -konsistenz. Die drei wichtigen Integrationskonzepte – Präsentations-, Daten- und Funktionsintegration – werden vorgestellt und ihre Bedeutung für eine erfolgreiche EAI-Implementierung hervorgehoben. Das Kapitel betont die Bedeutung von EAI als ganzheitliche und prozessorientierte Lösung, die im Gegensatz zur klassischen Middleware auf einem höheren Abstraktionsniveau angesiedelt ist. Die Abbildung 1 verdeutlicht beispielhaft eine mögliche EAI-Architektur.
3 Vorgehensweise zur Einführung einer EAI-Lösung: Dieses Kapitel beschreibt den detaillierten Ablauf der Einführung einer EAI-Lösung in einem mittelständischen Unternehmen. Es wird eine strukturierte Vorgehensweise vorgestellt, die von der Definition der Ziele über die IST-Analyse bis hin zur Realisierung der Lösung reicht. Der Fokus liegt auf der Bedeutung einer an der Geschäftsstrategie orientierten Implementierung und der Erzielung eines entsprechenden Return on Investment (ROI).
4 Vorteile und Risiken von EAI: Dieses Kapitel beleuchtet die Vor- und Nachteile, die mit der Implementierung einer EAI-Lösung verbunden sind. Es wird detailliert auf die positiven Aspekte eingegangen, wie beispielsweise die Optimierung von Geschäftsprozessen, die verbesserte Datenkonsistenz und die gesteigerte Flexibilität. Gleichzeitig werden aber auch die potenziellen Risiken, wie beispielsweise hohe Implementierungskosten oder die Abhängigkeit von spezifischen Technologien, offen und umfassend diskutiert.
Schlüsselwörter
Enterprise Application Integration (EAI), Integrationskonzepte, Legacy-Systeme, Geschäftsprozesse, Middleware, Datenintegration, Funktionsintegration, Präsentationsintegration, Return on Investment (ROI), Globalisierung, Supply Chain Management (SCM).
Häufig gestellte Fragen zu "Enterprise Application Integration (EAI)"
Was ist das Thema dieser Arbeit und welche Ziele werden verfolgt?
Diese Arbeit befasst sich mit Enterprise Application Integration (EAI) und ihrer Bedeutung in der modernen Wirtschaft. Ziel ist die Definition von EAI, die Erläuterung der Integrationskonzepte und die Darstellung der Vorgehensweise bei der Einführung einer EAI-Lösung. Zusätzlich werden Vor- und Nachteile von EAI betrachtet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Entstehung von EAI, Integrationskonzepte (Präsentations-, Daten- und Funktionsintegration), die Vorgehensweise bei der Einführung einer EAI-Lösung, die Vorteile und Risiken von EAI sowie die Ziele von EAI in Bezug auf Geschäftsprozesse und Systemarchitektur.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Motivation und Zielsetzung), Grundlagen zu EAI (Definition, Ziele, Integrationskonzepte), Vorgehensweise zur Einführung einer EAI-Lösung (Zielsetzung, IST-Analyse, Lösungskonzept, Realisierung), Vorteile und Risiken von EAI und ein Fazit. Jedes Kapitel fasst seine Inhalte prägnant zusammen.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema EAI ein und erläutert die Motivation für dessen Einsatz (zunehmende Globalisierung, Internet, Supply Chain Management, Herausforderungen veralteter Legacy-Systeme). Sie legt die Zielsetzung der Arbeit fest: Untersuchung des Ablaufs der Einführung einer EAI-Lösung in einem mittelständischen Unternehmen und Aufzeigen der Vor- und Nachteile.
Welche Grundlagen zu EAI werden behandelt?
Das Kapitel "Grundlagen zu EAI" liefert eine umfassende Definition von EAI, beschreibt dessen Entstehung und Entwicklung, erläutert die Ziele (Optimierung und Erweiterung von Geschäftsprozessen), und stellt die drei Integrationskonzepte (Präsentations-, Daten- und Funktionsintegration) vor. Es betont die Bedeutung von EAI als ganzheitliche und prozessorientierte Lösung.
Wie wird die Vorgehensweise zur Einführung einer EAI-Lösung beschrieben?
Das Kapitel zur Einführung einer EAI-Lösung beschreibt einen detaillierten Ablauf, von der Zieldefinition über die IST-Analyse bis zur Realisierung. Der Fokus liegt auf einer an der Geschäftsstrategie orientierten Implementierung und dem Return on Investment (ROI).
Welche Vor- und Nachteile von EAI werden diskutiert?
Das Kapitel zu den Vor- und Nachteilen von EAI beleuchtet positive Aspekte wie die Optimierung von Geschäftsprozessen, verbesserte Datenkonsistenz und gesteigerte Flexibilität. Es diskutiert aber auch potenzielle Risiken wie hohe Implementierungskosten oder Abhängigkeit von spezifischen Technologien.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Enterprise Application Integration (EAI), Integrationskonzepte, Legacy-Systeme, Geschäftsprozesse, Middleware, Datenintegration, Funktionsintegration, Präsentationsintegration, Return on Investment (ROI), Globalisierung, Supply Chain Management (SCM).
- Quote paper
- Johannes Veeh (Author), 2015, Ansätze zur Enterprise Application Integration (EAI) sowie deren Vorteile und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431159