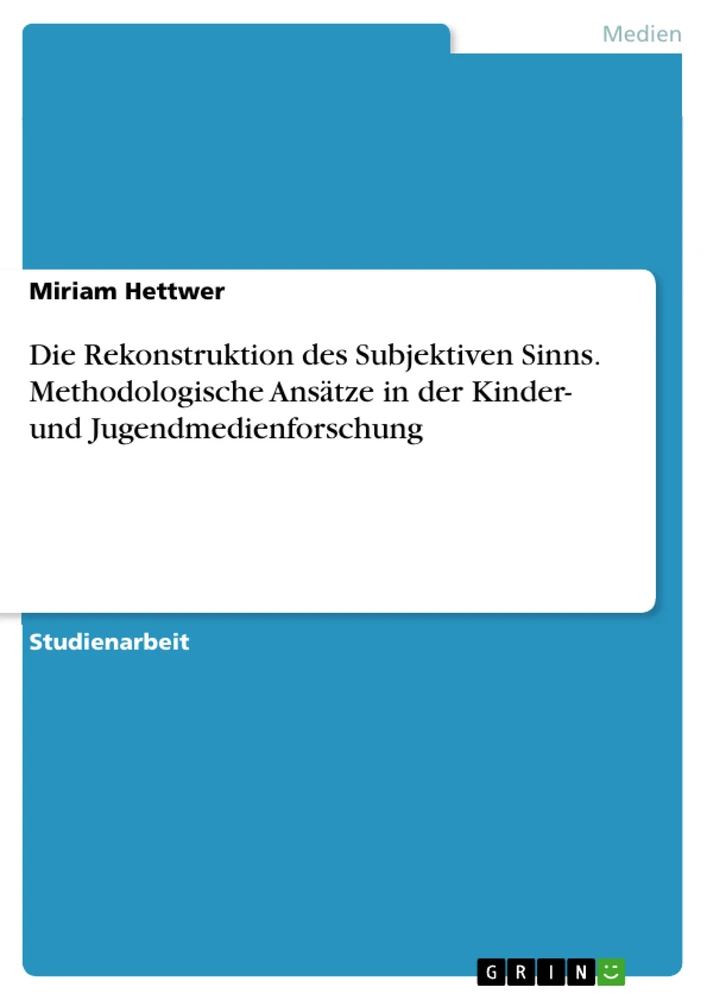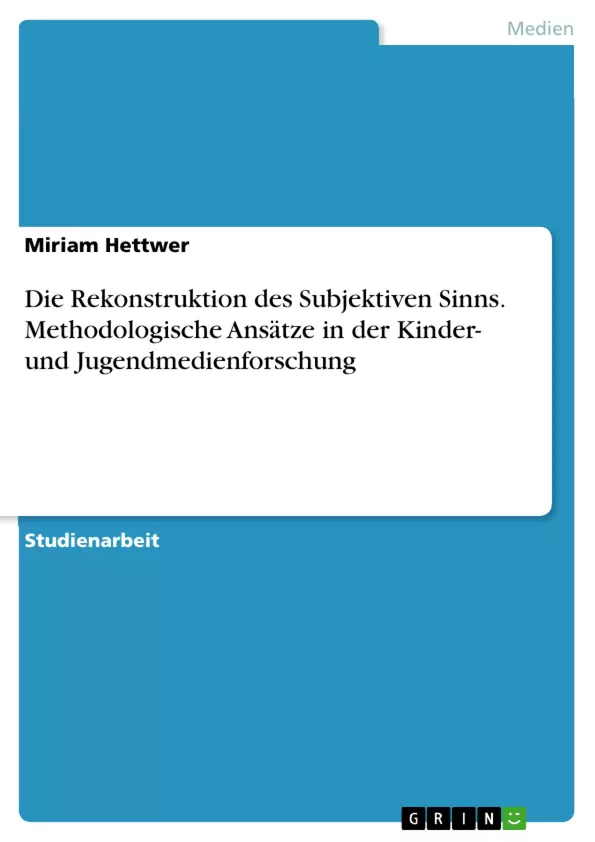Es besteht keine Frage mehr, dass Medien heutzutage eine entscheidende Rolle nicht nur in unserem alltäglichem Handeln, sondern auch in unserer Sozialisation und in der Weise wie wir die Welt wahrnehmen spielen. Doch auch umgekehrt beeinflusst unser alttägliches Erleben, unsere Werte und Normen, welchen Sinn wir Medieninhalten verleihen. Bereits im Kleinkindalter sind Kinder von medialen Produkten oder crossmedialen Vermarktungsstrategien quasi allgegenwärtig umgeben. Aufmerksamkeit und Begeisterung sind durch Fernseher und Computer garantiert. Dagmar Hoffmann betont jedoch, dass diese Rolle der Medien von soziologisch orientierten Sozialisationstheoretikern erst sehr spät in die Forschung Einzug gefunden hat. Oftmals wurde den Medien nicht die gleiche Bedeutung wie den traditionellen Faktoren der Sozialisation anerkannt, da die Rolle und letztendlich auch der Einfluss der Medien anders als bei Freunden, Familie oder Schule nicht direkt erkennbar und zu benennen ist. Die unmittelbare Reaktion auf Medieninhalte bleibt aus, weil „sie im Grunde anonym und unverbindlich sind, [und, M.H.] keine symmetrische Form der Interaktion und Kommunikation erlauben“. Erst vor knapp 20 Jahren etablierten sich die Medien als bedeutender und entwicklungspsychologisch ernstzunehmender Bereich der Sozialwissenschaften, vor allem in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Nach Römer wurde die Medienrezeptionsforschung zuvor lange Zeit anderen Forschungsdisziplinen untergeordnet. Erst mit der Digitalisierung und der vorschreitenden Mediatisierung des Alltags hat sich dies Ende der 1990er Jahre schrittweise geändert. In der 2000er-Jahren erfuhr die qualitative Medienrezeptionsforschung und das verstehen von Medienhandeln schließlich einen enormen Aufschwung. Jüngere Entwicklungen wie die wachsende Bedeutung von Social Media oder Smartphones werden diesen Wachstum sicherlich weiter beschleunigen.
Inhaltsverzeichnis
- Kinder- und Jugendmedienforschung
- Theoretischer Rahmen
- Symbolischer Interaktionismus
- Uses-and-Gratification Ansatz
- Entwicklungspsychologischer Ansatz
- Methode
- Der subjektive Sinn
- Sinnenhaftes Handeln nach Max Weber
- Der subjektive Sinn und Handlungsleitenden Thema
- Herausforderungen in der Forschung mit Heranwachsenden
- Besonderheiten in der Kinder- und Jugendmedienforschung
- Crossmediale Aneignung in der konvergenten Medienwelt
- Methodologische Ansätze in der Kinder- und Jugendmedienforschung
- Quantitative Befragungen mit Kindern
- Qualitative Zugänge
- Kontextuelles Verstehen von Medienaneignung
- Mediale Erscheinungs- und Äußerungsformen
- Wie ticken Kinder? - Vorüberlegungen zur Erhebung
- Alter und Entwicklungsstand - Handlungsorientierte Zugänge
- Einen umfassenden Blick bekommen - Multiperspektive Zugänge
- Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die methodischen Herausforderungen der Rekonstruktion des subjektiven Sinns in der Kinder- und Jugendmedienforschung. Sie beleuchtet den Einfluss von Medien auf die Sozialisation Heranwachsender und erforscht, wie die komplexen Prozesse der crossmedialen Medienaneignung in der Forschung angemessen erfasst werden können.
- Die Rolle von Medien in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen
- Die Rekonstruktion des subjektiven Sinns in Bezug auf Medieninhalte
- Methodische Ansätze zur Erfassung von crossmedialer Medienaneignung
- Die Bedeutung von konvergenter Mediennutzung für die Forschung
- Herausforderungen und Chancen der Forschung mit Kindern und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Kinder- und Jugendmedienforschung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Medien in der Sozialisation von Kindern und Jugendlichen und die Herausforderungen, die sich aus der medialen Prägung der Lebenswelt ergeben. Es wird betont, dass die Medienforschung mit Kindern und Jugendlichen spezifische methodische Herausforderungen beinhaltet.
- Kapitel 2: Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel stellt drei theoretische Ansätze vor, die für das Verständnis von Medienaneignung und subjektivem Sinn relevant sind: den symbolischen Interaktionismus, den Uses-and-Gratification Ansatz und den entwicklungspsychologischen Ansatz.
- Kapitel 3: Methode: Dieses Kapitel widmet sich den methodischen Herausforderungen in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen und thematisiert die Besonderheiten der Erhebung von Daten in dieser Zielgruppe. Es werden verschiedene methodische Ansätze vorgestellt und diskutiert.
- Kapitel 4: Der subjektive Sinn: Dieses Kapitel behandelt den Begriff des subjektiven Sinns im Sinne von Max Weber und zeigt seine Relevanz für die Analyse von Medienaneignung auf. Es wird untersucht, wie Handlungsleitende Themen mit dem subjektiven Sinn in Verbindung stehen.
- Kapitel 5: Herausforderungen in der Forschung mit Heranwachsenden: Dieses Kapitel beleuchtet die besonderen Herausforderungen, die die Forschung mit Kindern und Jugendlichen mit sich bringt. Es werden die spezifischen Aspekte der Kinder- und Jugendmedienforschung sowie die Besonderheiten der crossmedialen Medienaneignung in der konvergenten Medienwelt diskutiert.
- Kapitel 6: Methodologische Ansätze in der Kinder- und Jugendmedienforschung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene methodische Ansätze, die sich für die Erforschung von crossmedialer Medienaneignung bei Kindern und Jugendlichen eignen. Es werden sowohl quantitative als auch qualitative Methoden vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen im Kontext der Kinder- und Jugendmedienforschung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Kinder- und Jugendmedienforschung, crossmediale Medienaneignung, subjektiver Sinn, konvergente Medienwelten und methodische Ansätze in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen. Die wichtigsten Konzepte sind der symbolische Interaktionismus, der Uses-and-Gratification Ansatz und der entwicklungspsychologische Ansatz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Rekonstruktion des subjektiven Sinns“?
Es ist der methodische Versuch zu verstehen, welche individuelle Bedeutung Kinder und Jugendliche Medieninhalten aufgrund ihrer eigenen Lebenswelt und Werte zuschreiben.
Welche Rolle spielen Medien in der Sozialisation?
Medien beeinflussen, wie Heranwachsende die Welt wahrnehmen und sich in ihr positionieren, wobei dieser Prozess oft anonym und unverbindlich abläuft.
Was bedeutet „crossmediale Medienaneignung“?
Es beschreibt, wie Kinder Inhalte über verschiedene Plattformen hinweg (z.B. TV, Smartphone, Spielzeug) nutzen und in ihren Alltag integrieren.
Was ist der „Uses-and-Gratification“-Ansatz?
Dieser Ansatz fragt nicht, was Medien mit Menschen machen, sondern was Menschen mit Medien machen, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Forschung mit Kindern?
Forscher müssen den Entwicklungsstand berücksichtigen und oft handlungsorientierte oder qualitative Methoden nutzen, da klassische Befragungen bei Kindern an Grenzen stoßen.
- Quote paper
- Miriam Hettwer (Author), 2016, Die Rekonstruktion des Subjektiven Sinns. Methodologische Ansätze in der Kinder- und Jugendmedienforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429787