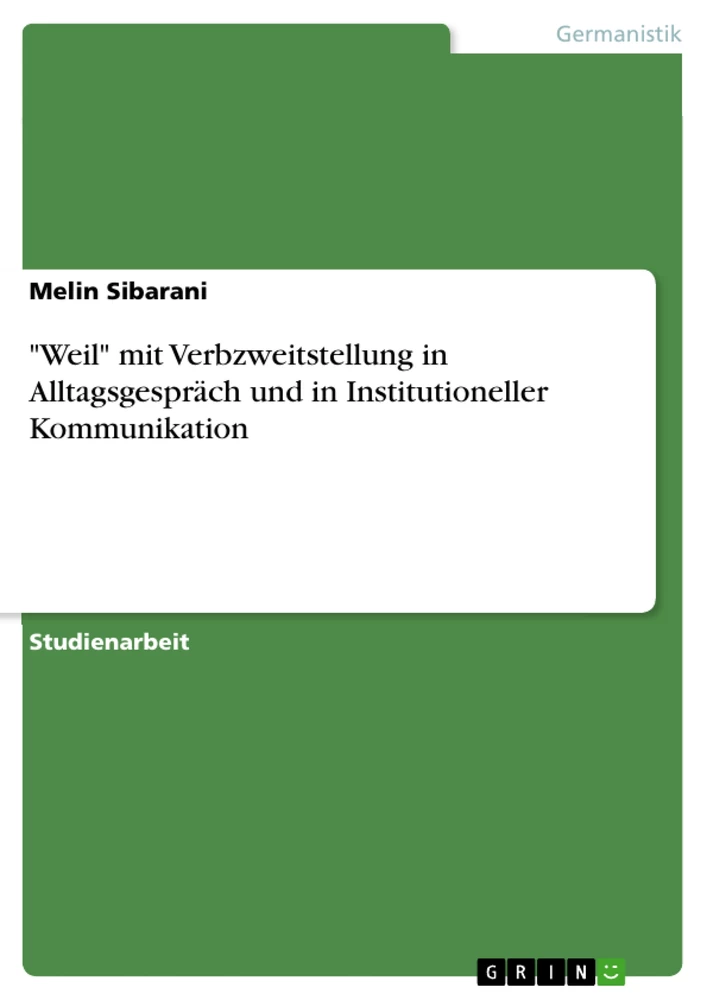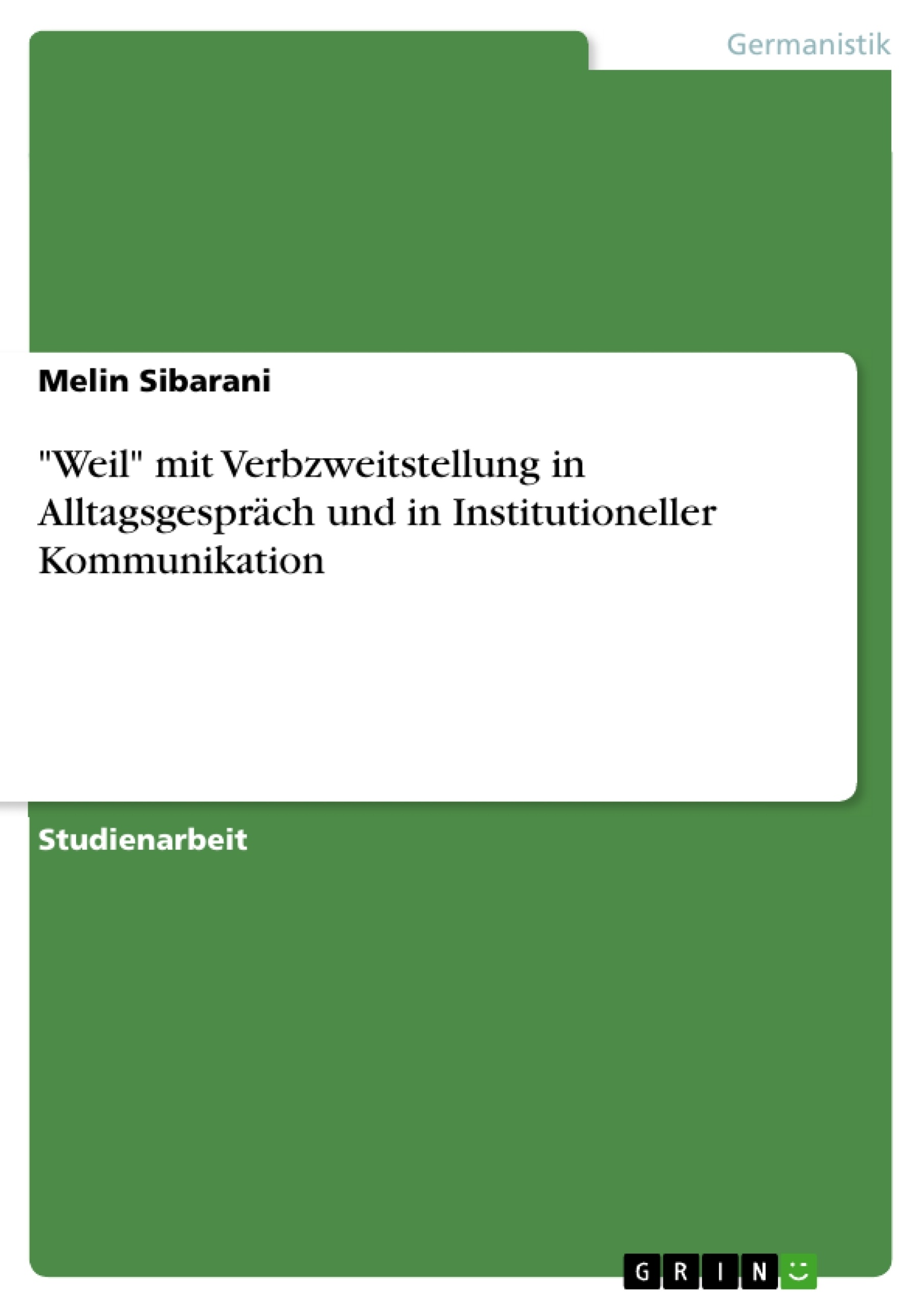Zunächst werden in dieser Hausarbeit Eigenschaften und Lesart des WV2s vorgestellt. Dabei befasst sich diese Arbeit ebenfalls mit Darstellungen von Alltagsgespräch und Institutionelle Kommunikation. Danach werden die Untersuchungs, -sowie Analysemethode der Korpora untersucht, die aus der Datenbank für Gesprochenes Deutsch IDS entnommen werden. Die Gespräche, die ausgewählt werden, sind zum einen Alltagsgespräch: „Unter Freunden“ und „Studentisches Alltagsgespräch“ und zum anderen sind Institutionelle Kommunikation: “Feedback unter den Lehrkräften“ und „Tutorium“. Darauffolgend wird in dieser Hausarbeit analysiert, welche Lesart des WV2s von den beiden Gesprächssorten am häufigsten vorkommen. Anhand dieser Fragestellungen werden einige Theorien über Eigenschaften und Lesarten von WV2, sowie Darstellungen über Alltagsgespräch und Institutionelle Kommunikation als Grundlage verwendet. Zuletzt werden die Ergebnisse dieser Arbeit in einem Fazit zusammenfasssend veranschaulicht und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Die Eigenschaften von Weil mit Verbzweitstellung
- Die Lesarten von Weil mit Verbzweitstellung
- Faktische oder Propositionale Begründung
- Epistemische Begründung
- Sprechaktbezogene Begründung
- Alltagsgespräch und Institutionelle Kommunikation
- Methodisches Vorgehen
- Ergebnisse
- Weil mit Verbzweitstellung und deren Lesart in Alltagsgespräch: „Unter Freunden“ und „Studentisches Alltagsgespräch“
- Weil mit Verbzweitstellung und deren Lesart in Alltagsgespräch: „Unter Freunden“
- Weil mit Verbzweitstellung und deren Lesart in „Studentisches Alltagsgespräch“
- Weil mit Verbzweitstellung und deren Lesart in Institutionelle Kommunikation: „Feedbackgespräch unter Lehrkräften“ und „Tutorium“
- Weil mit Verbzweitstellung und deren Lesart in institutioneller Kommunikation „Feedbackgespräch unter Lehrkräften“
- Weil mit Verbzweitstellung und deren Lesart in institutioneller Kommunikation „Tutorium“
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen von "Weil-Sätzen mit Verbzweitstellung" (WV2) im Deutschen, insbesondere deren Vorkommen und Interpretation in Alltagsgesprächen und institutioneller Kommunikation. Die Arbeit analysiert die Eigenschaften und Lesarten von WV2 und vergleicht deren Häufigkeit in verschiedenen Kommunikationssituationen.
- Eigenschaften von Weil-Sätzen mit Verbzweitstellung
- Lesarten von WV2 (propositional, epistemisch, sprechaktbezogen)
- Vergleich des Vorkommens von WV2 in Alltagsgesprächen und institutioneller Kommunikation
- Analyse der Korpora aus der Datenbank für Gesprochenes Deutsch (IDS)
- Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Weil-Sätze mit Verbzweitstellung (WV2) ein und verweist auf deren hohe Verbreitung im gesprochenen Deutsch. Sie nennt relevante Studien zur Häufigkeit und Interpretation von WV2 und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer genaueren Untersuchung der verschiedenen Lesarten von WV2 in unterschiedlichen Kommunikationssituationen, um ein umfassenderes Verständnis dieses linguistischen Phänomens zu erlangen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten gelegt, die von propositionaler über epistemische bis hin zu sprechaktbezogener Begründung reichen.
Theorie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Eigenschaften und Lesarten von WV2. Es werden verschiedene Theorien und Studien vorgestellt, die die syntaktischen Merkmale und semantischen Interpretationen von WV2 beschreiben. Besonders hervorgehoben werden die Unterschiede zwischen WV2 und Weil-Sätzen mit Verbletztstellung (WVL). Die Analyse der Eigenschaften beleuchtet Aspekte wie die Satzstellung, die Möglichkeit der Koordination mit anderen Nebensätzen und den Einfluss von Negationen. Die verschiedenen Lesarten (propositionale, epistemische und sprechaktbezogene Begründung) werden detailliert erläutert und ihre Bedeutung für das Verständnis von WV2 im Kontext von Kommunikationsprozessen herausgestellt. Die Kapitel legen den Grundstein für die spätere empirische Analyse, indem es ein solides theoretisches Fundament für die Interpretation der Ergebnisse liefert.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: "Weil-Sätze mit Verbzweitstellung im Deutschen"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Phänomen von "Weil-Sätzen mit Verbzweitstellung" (WV2) im Deutschen. Der Fokus liegt auf dem Vorkommen und der Interpretation von WV2 in Alltagsgesprächen und institutioneller Kommunikation. Die Arbeit analysiert die Eigenschaften und Lesarten von WV2 und vergleicht deren Häufigkeit in verschiedenen Kommunikationssituationen.
Welche Ziele verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung umfasst die Analyse der Eigenschaften von Weil-Sätzen mit Verbzweitstellung, die Unterscheidung verschiedener Lesarten (propositional, epistemisch, sprechaktbezogen), den Vergleich des Vorkommens von WV2 in Alltagsgesprächen und institutioneller Kommunikation, die Analyse von Korpora aus der Datenbank für Gesprochenes Deutsch (IDS) und eine zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse.
Welche Aspekte der Theorie werden behandelt?
Das theoretische Kapitel befasst sich mit den Eigenschaften und Lesarten von WV2. Es werden verschiedene Theorien und Studien vorgestellt, die die syntaktischen Merkmale und semantischen Interpretationen von WV2 beschreiben. Die Unterschiede zwischen WV2 und Weil-Sätzen mit Verbletztstellung (WVL) werden hervorgehoben. Die Analyse beleuchtet Satzstellung, Koordination mit anderen Nebensätzen und den Einfluss von Negationen. Die verschiedenen Lesarten (propositional, epistemisch, sprechaktbezogen) werden detailliert erläutert und ihre Bedeutung für das Verständnis von WV2 im Kontext von Kommunikationsprozessen herausgestellt.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Hausarbeit beschreibt das methodische Vorgehen, das die Analyse von Korpora aus der Datenbank für Gesprochenes Deutsch (IDS) beinhaltet. Genaueres zum methodischen Vorgehen wird im entsprechenden Kapitel erläutert.
Welche Daten werden analysiert?
Die Analyse basiert auf Korpora aus der Datenbank für Gesprochenes Deutsch (IDS). Die Daten umfassen Alltagsgespräche ("Unter Freunden", "Studentisches Alltagsgespräch") und institutionelle Kommunikation ("Feedbackgespräch unter Lehrkräften", "Tutorium").
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse präsentieren eine vergleichende Analyse der Lesarten von WV2 in den verschiedenen Kommunikationssituationen (Alltagsgespräche und institutionelle Kommunikation). Die Ergebnisse werden detailliert in den entsprechenden Kapiteln vorgestellt.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist strukturiert in Einleitung, Theorie, Methodisches Vorgehen, Ergebnisse, Fazit und Literaturverzeichnis. Die Einleitung führt in die Thematik ein. Das Theorie-Kapitel behandelt die Eigenschaften und Lesarten von WV2. Das Kapitel "Methodisches Vorgehen" beschreibt die angewandte Methodik. Die Ergebnisse präsentieren die Analyse der Korpora. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen. Das Literaturverzeichnis listet die verwendeten Quellen auf.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit der Hausarbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen über das Vorkommen und die Interpretation von WV2 in verschiedenen Kommunikationssituationen. Es wird ein umfassendes Verständnis des linguistischen Phänomens angestrebt.
- Citation du texte
- Melin Sibarani (Auteur), 2018, "Weil" mit Verbzweitstellung in Alltagsgespräch und in Institutioneller Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429246