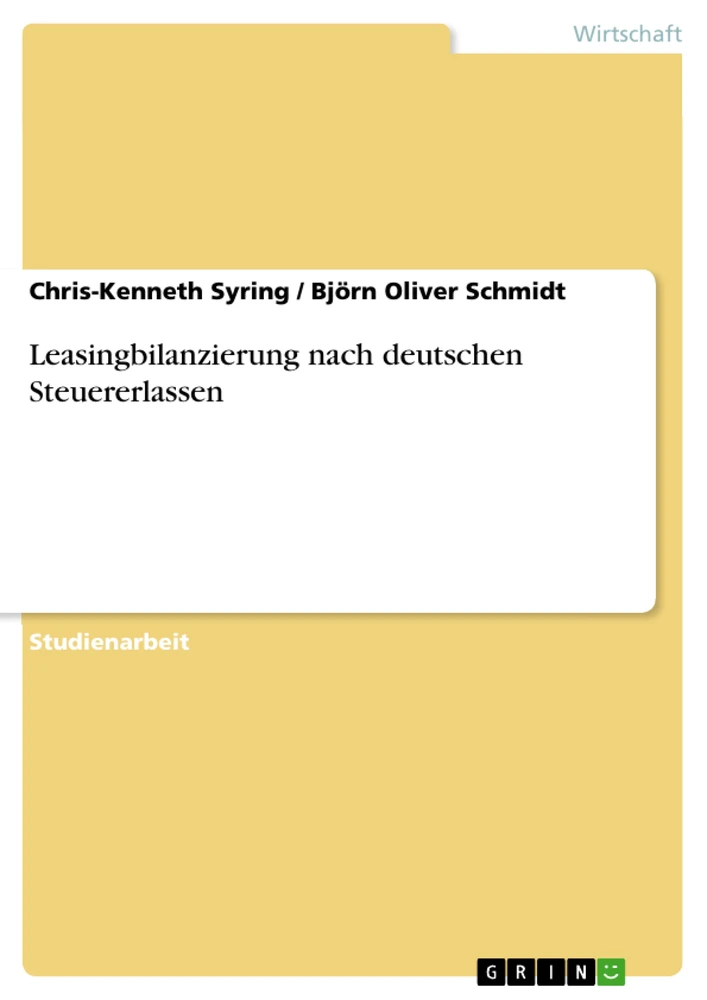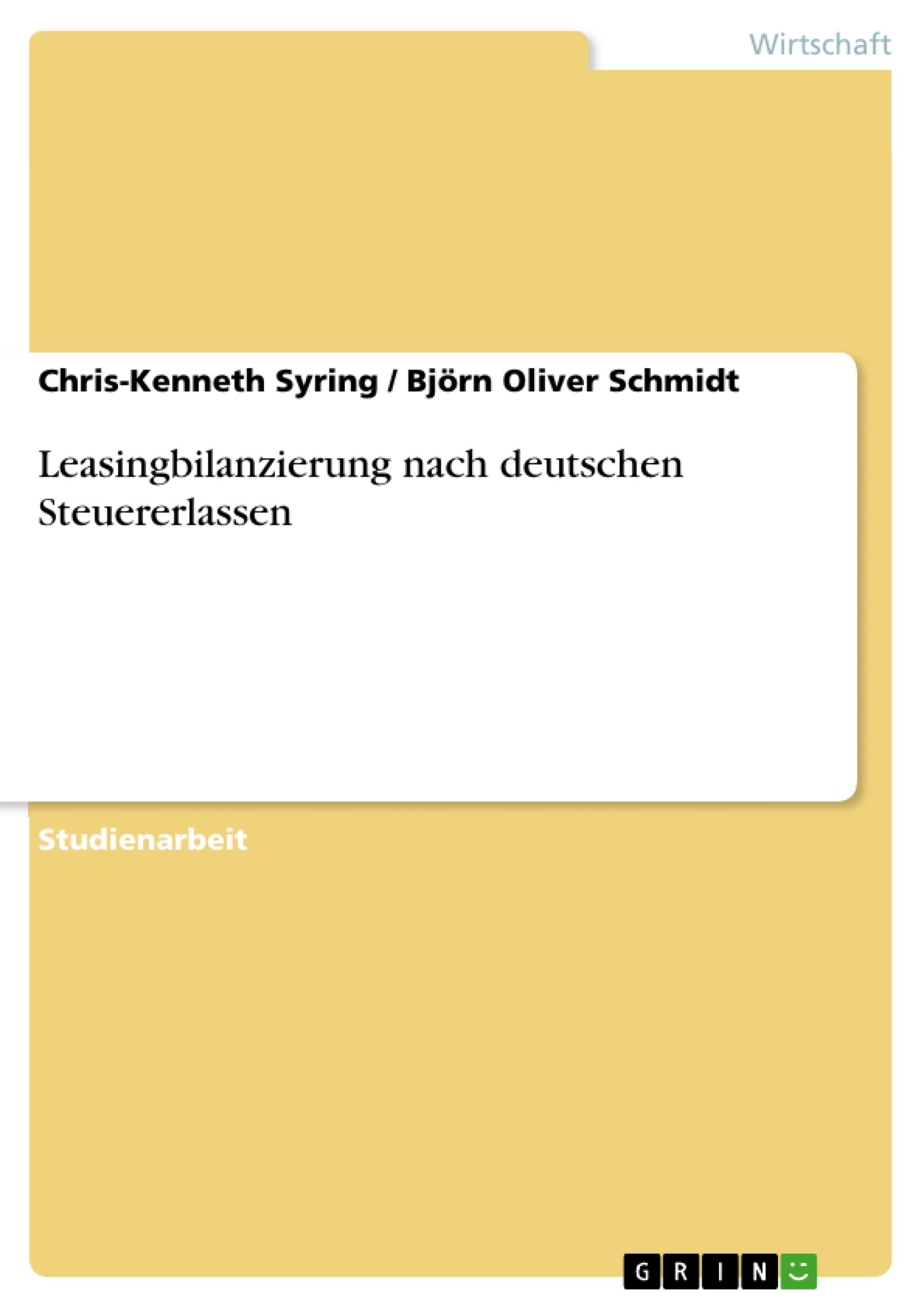Das Leasing-Geschäft stellt in Deutschland eine häufig genutzte Form der Finanzierung dar. Dies zeigt die Anzahl von rund 2200 Leasing-Gesellschaften in Deutschland, von denen jedoch nur knapp 200 sich 90% des Marktes teilen. Diese Seminararbeit handelt von der Leasingbilanzierung nach deutschen Steuererlassen. Fokussiert wird sich hierbei auf das Mobilien-Leasing, sprich dem Leasing-Geschäft mit beweglichen Wirtschaftsgütern. Ziel ist es, die Bilanzierungsmöglichkeiten von mobilen Leasinggegenständen gemäß dem deutschen Handelsrecht sowie deutschen Steuererlassen darzustellen. Die Bedeutung des Leasings in Deutschland wird durch die Leasing-Quote, worunter man den Anteil der Leasing-Investitionen eines Jahres an den gesamten Bruttoanlageinvestitionen der Wirtschaft ohne den Wohnungsbau versteht, unterstützt.
Während die Leasing-Quote für das Mobilien-Leasing, auf welchem der Fokus dieser Arbeit liegt, im Jahr 1975 noch 5% betrug, konnte sie sich bis 2016 auf knapp 24% nahezu durchgehend steigern. Mit einem Neugeschäftsvolumen von 46,5 Milliarden Euro wurden im Jahr 2011 rund 53% aller außenfinanzierten Ausrüstungsinvestitionen durch das Leasing-Geschäft realisiert. Dies zeigt die Präsenz des Leasings in Deutschland für Mobilien. Die größte Objektgruppe des Mobilien-Leasings bilden Pkw und Nutzfahrzeuge. 2012 stellten diese ca. 69% aller Mobilien-Neugeschäfte im Leasing dar. In Deutschland gibt es weder einen speziellen Rechtsrahmen, noch eine exakte gesetzliche Definition für das Leasing. Für die Behandlung von Leasing-Geschäften sind jedoch die Leasing-Erlasse von wesentlicher Bedeutung. Durch diese konnten Probleme der Steuerstundungen begrenzt sowie grundlegende Rahmenbedingungen für Leasingverträge und die daraus resultierenden, bilanziellen Zurechnungen geschaffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff und Bedeutung des Leasings
- Finanzierungsleasing mit Vollamortisation
- Finanzierungsleasing mit Teilamortisation
- Operatives Leasing
- Unterschied zwischen wirtschaftlichen und juristischem Eigentum
- Einordnung der Vertragstypen
- Finanzierungsleasing mit Vollamortisation
- Mit Kaufoption des Leasingnehmers
- Ohne Kauf– oder Verlängerungsoption des Leasingnehmers
- Mit Mietverlängerungsoption
- Teilamortisation
- Mit Andienungsrecht des Leasing-Gebers
- Mit Aufteilung des Mehrerlöses
- Als kündbarer Mietvertrag
- Operatives Leasing
- Finanzierungsleasing mit Vollamortisation
- Bilanzierung und Zurechnung
- Bilanzierung beim Finanzierungsleasing
- Zurechnung beim Leasing-Geber
- Zurechnung beim Leasing-Nehmer
- Bilanzierung beim Operativem Leasing
- Bilanzierung beim Finanzierungsleasing
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Leasingbilanzierung nach deutschen Steuererlassen, wobei der Fokus auf das Mobilien-Leasing, also dem Leasing von beweglichen Wirtschaftsgütern, liegt. Ziel ist es, die Bilanzierungsmöglichkeiten von mobilen Leasinggegenständen gemäß dem deutschen Handelsrecht und deutschen Steuererlassen darzustellen.
- Definition und Einordnung von Leasingarten (Finanzierungsleasing, Operatives Leasing)
- Unterschiede zwischen juristischem und wirtschaftlichem Eigentum im Leasing
- Bilanzierung des Finanzierungsleasings (Vollamortisation und Teilamortisation)
- Bilanzierung des Operativen Leasings
- Zurechnung des Leasing-Objektes zum Leasinggeber oder Leasingnehmer
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Leasing ein und erklärt dessen Bedeutung in Deutschland. Es beleuchtet verschiedene Vertragskonstellationen im Leasinggeschäft und die Unterschiede zwischen Kauf und Leasing. Kapitel 2 erläutert die verschiedenen Leasingarten, insbesondere Finanzierungsleasing mit Voll- und Teilamortisation sowie Operatives Leasing. Es beleuchtet die Unterschiede zwischen juristischem und wirtschaftlichem Eigentum und deren Bedeutung für die bilanzielle Zurechnung. Kapitel 3 widmet sich der Einordnung verschiedener Vertragstypen innerhalb des Finanzierungsleasings mit Voll- und Teilamortisation. Es beschreibt die Merkmale und Zurechnungskriterien für die jeweiligen Vertragstypen. Das vierte Kapitel behandelt die Bilanzierung des Finanzierungsleasings, wobei die Zurechnung des Leasingobjektes zum Leasinggeber und Leasingnehmer im Vordergrund steht. Die verschiedenen Bilanzierungsmöglichkeiten und -methoden werden erklärt. Kapitel 4 beleuchtet auch die Bilanzierung des Operativen Leasings, welches aufgrund seiner mietähnlichen Charakteristika den Regelungen über schwebende Geschäfte folgt. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Seminararbeit zusammen und beleuchtet die Bedeutung der Zurechnung des Leasing-Objektes für die Bilanzierung in beiden Leasingarten.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Seminararbeit sind: Leasing, Finanzierungsleasing, Operatives Leasing, Vollamortisation, Teilamortisation, Bilanzierung, Zurechnung, juristisches Eigentum, wirtschaftliches Eigentum, Leasing-Geber, Leasing-Nehmer, Steuererlasse, Handelsrecht, Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, Abschreibung.
- Quote paper
- Chris-Kenneth Syring (Author), Björn Oliver Schmidt (Author), 2017, Leasingbilanzierung nach deutschen Steuererlassen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428879