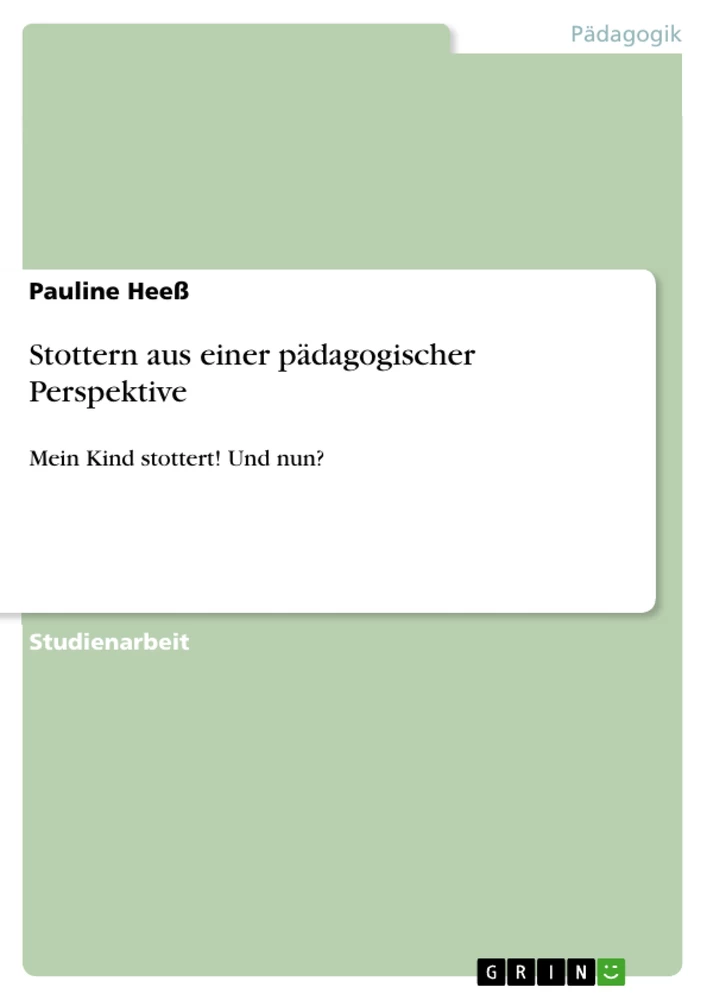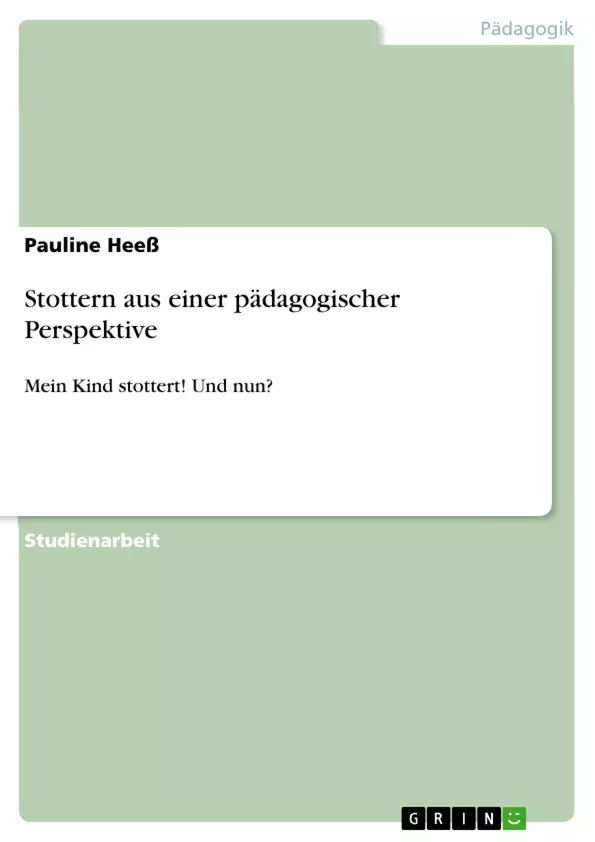Beginnend wird in dieser Ausarbeit das Erscheinungsbild „Stottern“ und seine Symptomatik dargestellt. Weiterführend werden die Ursachen des Stotterns geklärt. Hier stellt sich vorweg die spannende Frage, ob die Schuld des Stotterns bei den Eltern oder den Bezugspersonen liegen kann. Es bestehen drei Präventionsmaßnahmen, welche im weiteren Verlauf kurz aufgezeigt werden. Auch die Frage, mit welchen Therapieansätzen das Stottern behandelt werden kann, soll nicht offen bleiben. Im zweiten Teil dieser Ausarbeitung wird der Frage nachgegangen, welche Auswirkungen die sprachliche Beeinträchtigung auf das Kind hat und was Eltern tun können, wenn ihr Kind zu stottern beginnt. Hierzu werden die allgemeinen Komponenten, welche zur Bestimmung der Sprachlichkeit des Menschen beitragen, aufgeführt. Abschließend wird auf die Frage
eingegangen, ob Eltern mit ihren Kindern über das Stottern sprechen sollten und welche positiven Verhaltensweisen das Leben des stotternden Kindes erleichtern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erscheinungsbild
- Ursachen
- Prävention
- Diagnostik
- Therapie
- Indirekte Therapie
- Direkte Therapie
- Therapieansätze
- Mein Kind stottert! Und nun?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Sprachstörung „Stottern“ und analysiert seine Erscheinungsformen, Ursachen und Präventionsmaßnahmen. Neben der Erörterung der verschiedenen Therapieansätze wird auch die Frage behandelt, welche Auswirkungen das Stottern auf das Kind hat und wie Eltern ihr Kind dabei unterstützen können.
- Erscheinungsbild und Symptomatik des Stotterns
- Ursachen und Risikofaktoren für das Stottern
- Mögliche Präventionsmaßnahmen
- Therapieansätze zur Behandlung des Stotterns
- Auswirkungen des Stotterns auf das Kind und die Rolle der Eltern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Stotterns ein und beschreibt das Erscheinungsbild dieser Sprachstörung. Im zweiten Kapitel wird die Symptomatik des Stotterns näher beleuchtet und eine Unterscheidung zwischen normaler Sprechunflüssigkeit und echtem Stottern vorgenommen. Das dritte Kapitel untersucht die Ursachen für das Stottern und beleuchtet die Rolle von Risikofaktoren und auslösenden Faktoren. Die Prävention des Stotterns wird im vierten Kapitel behandelt, wobei drei Ebenen der Prävention unterschieden werden: Primäre, Sekundäre und Tertiäre Prävention.
Schlüsselwörter
Stottern, Sprachstörung, Redefluss, Kommunikation, Symptomatik, Ursachen, Prävention, Therapie, Elternrolle, Auswirkungen, Sprechunflüssigkeit, Kernsymptome, Begleitsymptome, Risikofaktoren, auslösende Faktoren, Kontinuitätshypothese, Primäre Prävention, Sekundäre Prävention, Tertiäre Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Kernsymptome des Stotterns?
Dazu gehören Wiederholungen von Lauten und Silben, Dehnungen und Blockierungen im Redefluss.
Sind Eltern schuld am Stottern ihres Kindes?
Nein, die Forschung zeigt, dass Stottern meist eine Kombination aus genetischen und neurologischen Faktoren ist. Eltern sind nicht die Verursacher, können aber den Umgang damit positiv beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen direkter und indirekter Therapie?
Indirekte Therapie setzt am Umfeld des Kindes an, während direkte Therapie direkt mit dem Kind an seiner Sprechweise arbeitet.
Wie sollten Eltern reagieren, wenn ihr Kind stottert?
Eltern sollten ruhig zuhören, Blickkontakt halten, das Kind ausreden lassen und nicht versuchen, Sätze für das Kind zu beenden.
Welche Präventionsebenen gibt es beim Stottern?
Man unterscheidet primäre Prävention (Aufklärung), sekundäre Prävention (Früherkennung) und tertiäre Prävention (Vermeidung von Folgeschäden).
- Citation du texte
- Pauline Heeß (Auteur), 2017, Stottern aus einer pädagogischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428816