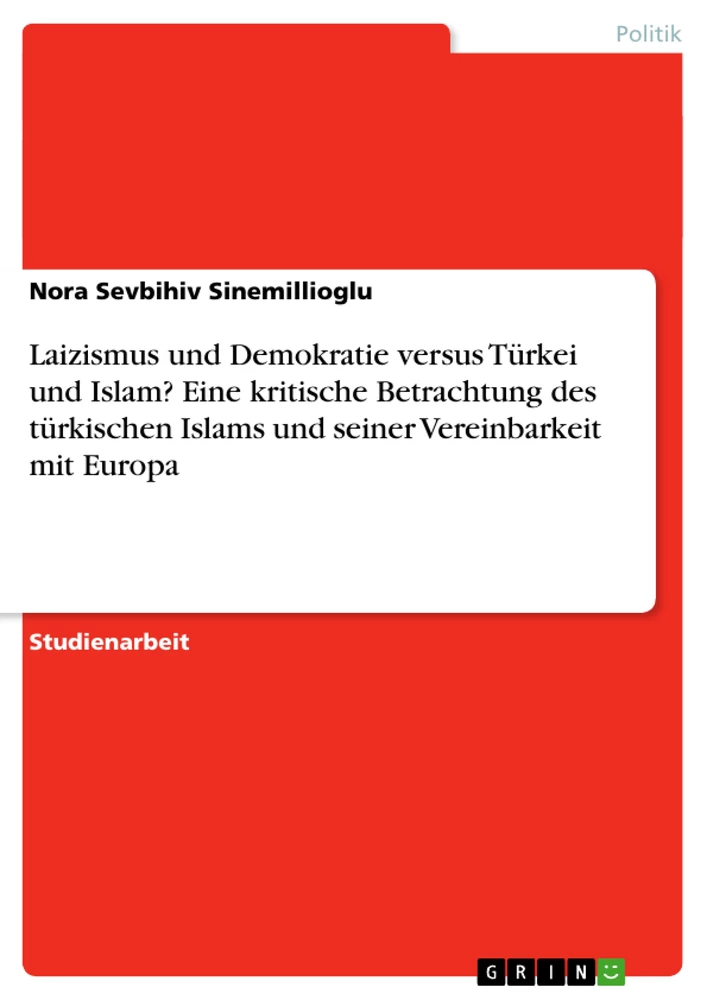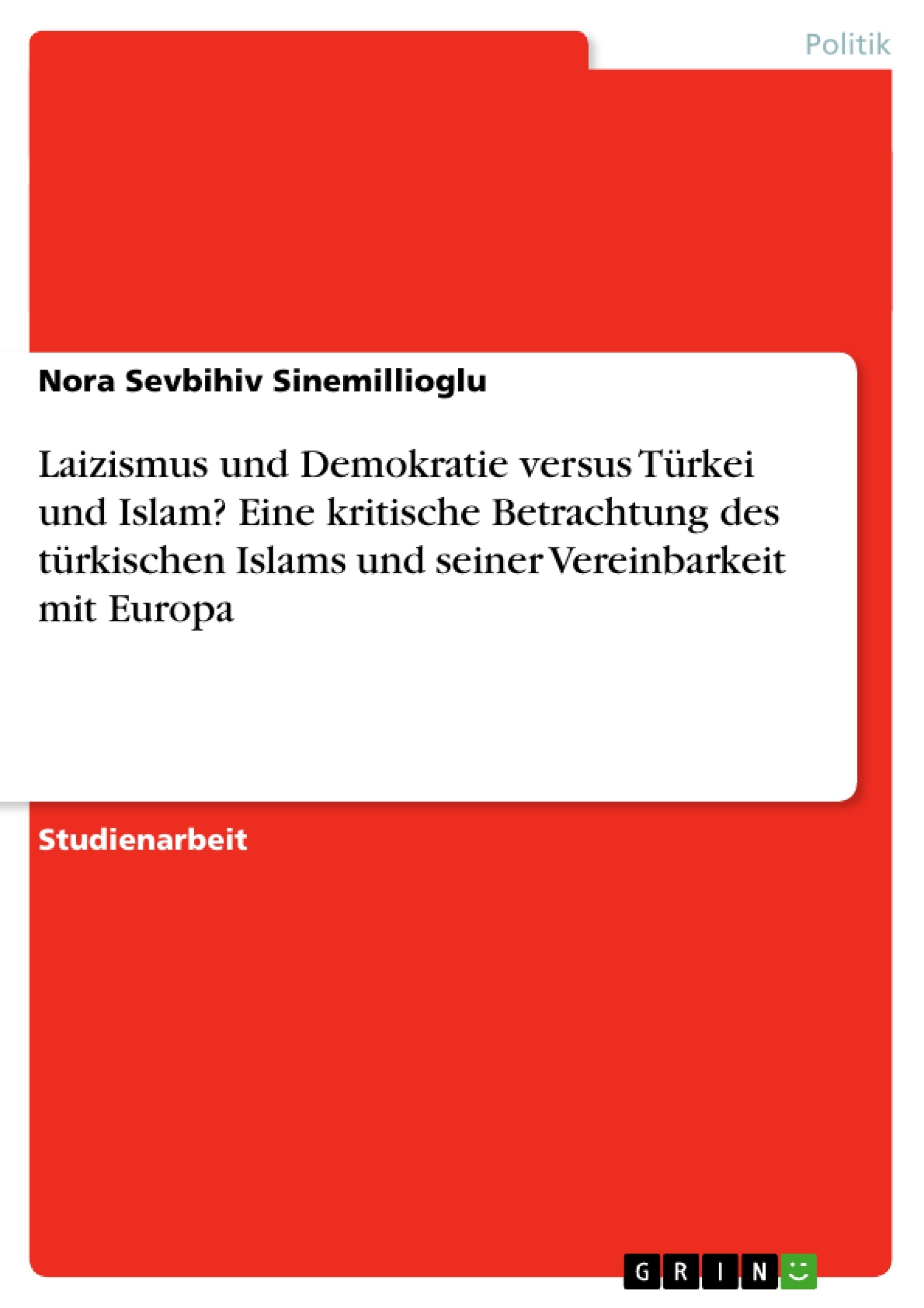Seitdem die EU der Türkei im Jahr 1999 den Beitrittskandidatenstatus verliehen hat und spätestens seitdem die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen für den 3. Oktober 2005 festgelegt wurde, scheint der langfristige Beitritt des ersten Staates mit hauptsächlich muslimischer Bevölkerung zur Europäischen Union immer denkbarer. Die islamisch- konservative Gerechtigkeits- und Entwicklungs-Partei (Adalet ve Kalkınma partisi, AKP) von Ministerpräsident Recep Tayyıp Erdoğan hat die Türkei durch eine Vielzahl von Reformen innerhalb nur weniger Jahre Regierungsarbeit ein gutes Stück in Richtung Westen gerückt. Dadurch hat sie die Türkei auch der Verwirklichung eines der grundlegenden Ziele des Kemalismus, der türkischen Staatsideologie, näher gebracht: der durch Anpassung an und Eingliederung in den Westen erreichten Modernisierung der Türkei.
Die neuesten Entwicklungen in der Türkei und die ihr vorangegangen Reformen, die aus türkischer Sicht reformistisch, ja fast revolutionistisch sind, werden in Europa häufig mit Skepsis betrachtet. Kritiker warnen, die Reformen bestünden nur auf dem Papier und Erdoğan täusche seine westliche Orientierung vor, um schließlich, nach Sicherung des Regierungsbodens, ausreichenden Zugeständnissen der EU und einer griffigen Kontrolle über das Militär, seinen traditionellen Kurs wieder hervorzukramen und die alte Linie des Necmettin Erbakan und der im Zuge des 28. Februar Prozesses verbotenen islamistischen Wohlfahrtspartei (Refah-Partisi) wieder einzuschlagen. Insbesondere das in den letzten Monaten zu beobachtende Desinteresse der türkischen Regierung an weiteren Reformen bzw. an der Durchsetzung bereits verabschiedeter Gesetze bläst den Türkei-Kritikern wieder neuen Wind in die Segel. Nicht zuletzt sei die Türkei ein vom Islam geprägter Staat, der eine Gefährdung für die Rechtsordnung in der EU darstelle. So formuliert Reinhold Bocklet etwa:
Da aber im Islam die Emanzipation einer zivilen, säkularisierten Sphäre vom Totalitätsanspruch der Religion nicht stattgefunden hat und wo es sie – wie in der Türkei – gibt, sie auf staatlich-militärischem Oktroy beruht, bestehen nicht zuletzt im Blick auf die Entwicklungen in der Türkei während der letzen Jahrzehnte berechtigte Zweifel, ob die jüngsten demokratischen Reformen und die rechtliche Festschreibung der westlichen Werte gesellschaftlichen Bestand haben und nicht wieder von einem islamisch-fundamentalistischen Sturm hinweg gefegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Die Türkische Republik: Neudefinitionen der Beziehungen zum Islam
- Das Amt für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet Isleri Bakanligi, DIB): ein Überblick
- Kritik und Bewertung des DIB
- Islam in der Türkei vs. Demokratie und Modernisierung?
- Der Laizismus in der Türkei – eine Einordnung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Türkei als muslimisch geprägter Staat mit der europäischen Idee des Laizismus und der Demokratie vereinbar ist. Sie analysiert die türkischen Staatsstrukturen, insbesondere die Institution des Amtes für Religiöse Angelegenheiten (DIB), und betrachtet die Beziehung zwischen Islam, Modernisierung und dem türkischen Laizismus. Die Arbeit untersucht, ob die Türkei tatsächlich einen religiös motivierten Staat darstellt oder ob der türkische Laizismus seinen Anspruch auf Säkularisierung einlöst.
- Die Beziehung zwischen Staat und Islam in der Türkei
- Das Amt für Religiöse Angelegenheiten (DIB) und seine Rolle in der türkischen Gesellschaft
- Die Vereinbarkeit von Laizismus, Demokratie und Islam in der Türkei
- Die Bedeutung des türkischen Laizismus für die Modernisierung des Landes
- Die Türkei im Kontext des EU-Beitritts
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Einleitung und Fragestellung der Arbeit, indem es den Hintergrund des EU-Beitritts der Türkei und die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Türkei darlegt. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Gründung der Türkischen Republik und den Veränderungen in der Beziehung zwischen Staat und Islam. Es analysiert den Kemalismus als Staatsideologie und die Rolle des Laizismus in der türkischen Gesellschaft.
Das dritte Kapitel behandelt das Amt für Religiöse Angelegenheiten (DIB) und dessen Organisation, Aufgaben und Bedeutung in der türkischen Gesellschaft. Es betrachtet die Kritik am DIB und die Frage der Vereinbarkeit des DIB mit dem türkischen Laizismus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themenbereiche Laizismus, Demokratie, Islam, Türkei, EU-Beitritt, Kemalismus, Diyanet Isleri Bakanligi (DIB), Modernisierung, Kopftuchdebatte und die Vereinbarkeit von Religion und Politik in der Türkei. Sie analysiert den türkischen Laizismus und seine Rolle in der türkischen Gesellschaft sowie die Entwicklung des türkischen Staates im Kontext des EU-Beitritts.
- Quote paper
- Nora Sevbihiv Sinemillioglu (Author), 2005, Laizismus und Demokratie versus Türkei und Islam? Eine kritische Betrachtung des türkischen Islams und seiner Vereinbarkeit mit Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42682