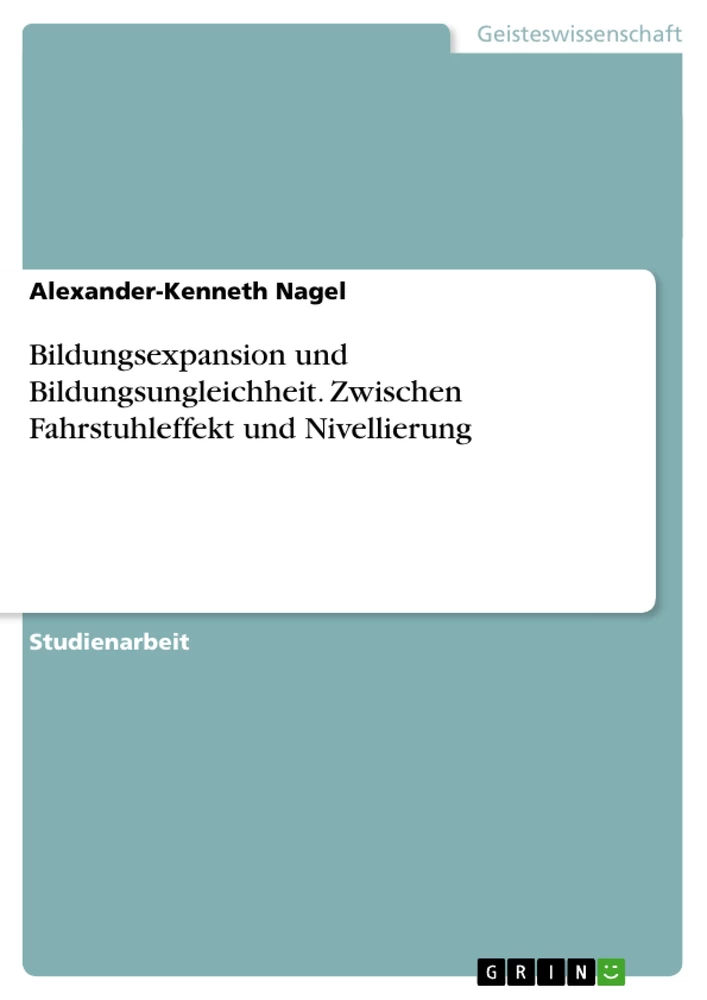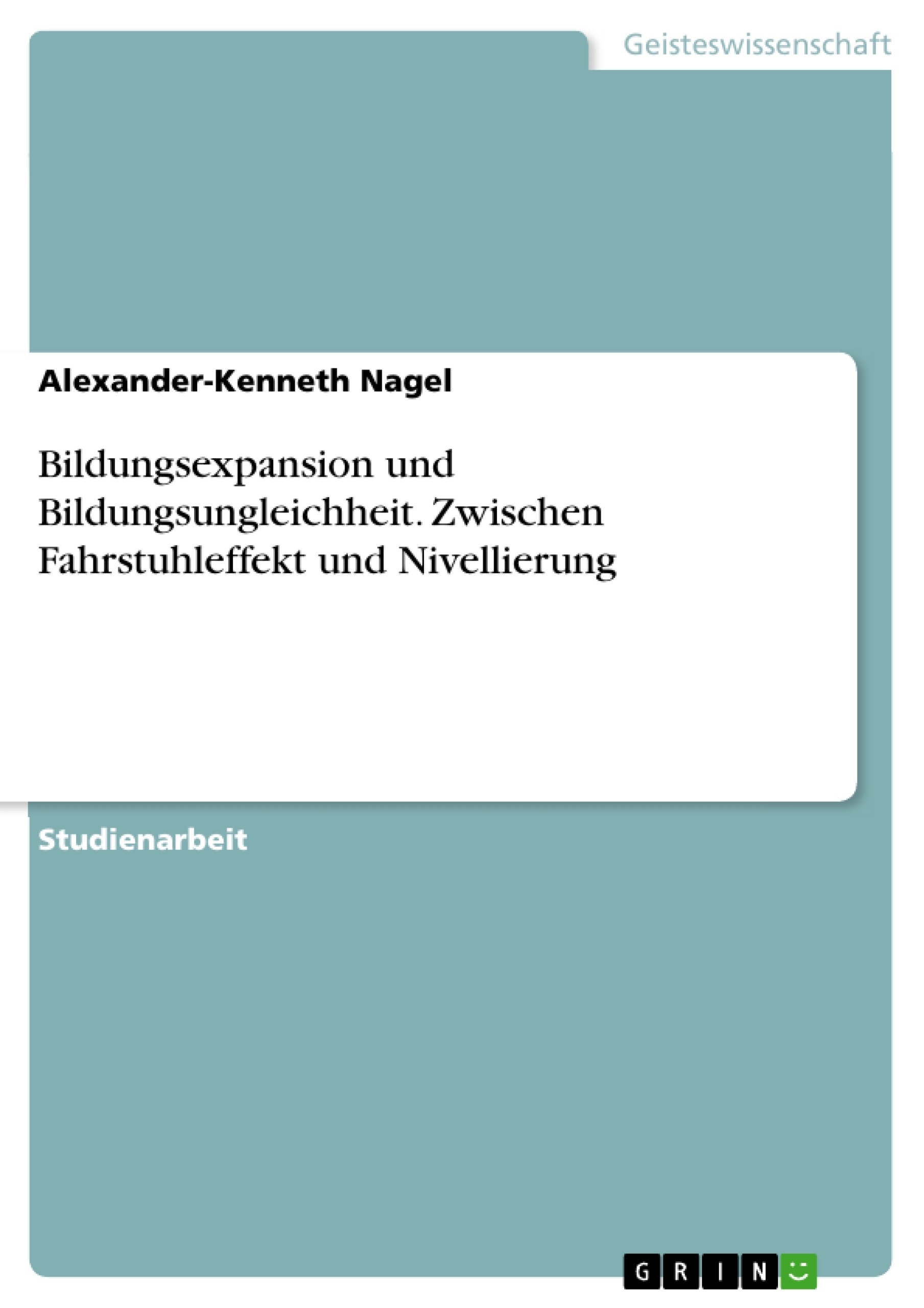Problemstellung
Bildungsexpansion, Life-Long-Learning und Wissensgesellschaft. Diese Schlagwörter zwischen Feuilleton und bildungssoziologischer Fachdebatte haben in den letzten Jahren eine politische Dimension (zurück- )gewonnen, welche sie erneut ins Rampenlicht einer akademischen Betrachtung rückt. Dabei gilt es, von einer stark programmatischen Diskussion über Bildungsexpansion als Allheilmittel für soziale Ungleichheit zu einer empirisch fundierten Kenntnis ihrer Mechanismen und Folgen zu gelangen und ihre Wechselwirkung mit anderen sozialen Bereichen, etwa dem Arbeitsmarkt oder Institutionen der politischen Teilhabe zu ergründen.
In dieser Arbeit will ich dem Problem der egalisierenden Potenz der Bildungsexpansion nachgehen. Führt die Ausweitung von Bildungsteilhabe zu einer Verringerung von Bildungsungleichheit ? – Welches sind die Mechanismen, über die sich Bildungsungleichheit trotz Bildungsexpansion reproduziert ?
Vor dem Hintergrund einer Erörterung zweier konträrer Bildungsverständnisse werde ich zunächst die bildungspolitische Diskussion der 60er und 70er Jahre abrissartig darstellen, welche zahlreiche Schlagwörter, die heute in einem Atemzug mit Bildungsexpansion genannt werden (etwa Bildungsbeteiligung und Lebenslanges Lernen), hervorgebracht hat. Im vierten Abschnitt sollen theoretische Modelle von Bildungsexpansion und Bildungsungleichheit vorgestellt werden. Während Boudon, Erikson/Jonsson und Esser hier als Vertreter des methodologischen Individualismus gelten können, vertritt Becker einen neoinstitutionstheoretischen Ansatz. Die Spezifika der jeweiligen Ansätze werden begleitend in einem fortlaufenden Beispiel illustriert und abschließend im Hinblick auf die Ausgangsfrage zusammengeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis und Gliederung
- Problemstellung
- Paradigmatische Bildungsverständnisse
- Bildung als Konsum- und Investitionsgut
- Bildung als positionales Gut
- Zwischenfazit
- Die bildungspolitische Diskussion der 60er und 70er Jahre
- „Schule als soziale Dirigierungsstelle“ - Schelsky
- „Bildung als Bürgerrecht“ – Dahrendorf
- Zwischenfazit
- Modelle von Bildungsexpansion und Bildungsungleichheit
- Boudon - Reproduktion von Bildungsungleichheit
- Becker - Erweiterung um institutionelle Faktoren
- WE-Modell I (Erikson und Jonsson)
- WE-Modell II (Esser)
- Mehrebenenmodell (Becker)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die egalisierende Potenz von Bildungsexpansion. Sie fragt, ob die Ausweitung der Bildungsteilhabe zu einer Verringerung von Bildungsungleichheit führt und welche Mechanismen die Reproduktion von Bildungsungleichheit trotz Bildungsexpansion ermöglichen. Die Arbeit analysiert verschiedene bildungstheoretische Perspektiven und präsentiert relevante Modelle zur Erklärung der Zusammenhänge zwischen Bildungsexpansion und sozialer Ungleichheit.
- Konträre Bildungsverständnisse (Konsumgut, Investitionsgut, positionales Gut)
- Bildungspolitische Diskussion der 60er und 70er Jahre
- Theoretische Modelle von Bildungsexpansion und Bildungsungleichheit (Boudon, Becker, Erikson/Jonsson, Esser)
- Mechanismen der Reproduktion von Bildungsungleichheit
- Egalisierende Potenz von Bildungsexpansion
Zusammenfassung der Kapitel
Problemstellung: Die Arbeit untersucht die Frage, ob Bildungsexpansion zu einer Verringerung von Bildungsungleichheit führt. Sie setzt sich kritisch mit der programmatischen Diskussion um Bildungsexpansion als Allheilmittel auseinander und strebt eine empirisch fundierte Analyse der Mechanismen und Folgen an, einschließlich der Wechselwirkung mit Arbeitsmarkt und politischer Teilhabe.
Paradigmatische Bildungsverständnisse: Dieses Kapitel präsentiert zwei gegensätzliche Perspektiven auf Bildung: zum einen die mikroökonomische Sichtweise von Bildung als Konsum- und Investitionsgut, die auf Nutzenmaximierung und Renditeerwartungen basiert. Zum anderen wird die Perspektive der Signaltheorie und konflikttheoretischer Ansätze beleuchtet, die Bildung als Selektionsmechanismus und Instrument der Elitenreproduktion verstehen, wobei Bildung ihren Wert durch zunehmende Verbreitung verlieren kann (Bildungsinflation).
Die bildungspolitische Diskussion der 60er und 70er Jahre: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die bildungspolitische Debatte der 60er und 70er Jahre. Er beleuchtet gegensätzliche Positionen wie die von Schelsky, der die Schule als soziales Dirigierungssystem sieht, und Dahrendorfs Vorstellung von Bildung als Bürgerrecht. Es werden die zentralen Schlagworte dieser Zeit im Kontext der heutigen Debatte um Bildungsexpansion diskutiert.
Modelle von Bildungsexpansion und Bildungsungleichheit: Dieses Kapitel stellt verschiedene theoretische Modelle vor, die die Beziehung zwischen Bildungsexpansion und Bildungsungleichheit erklären. Es werden die Ansätze von Boudon (methodologischer Individualismus) und Becker (neoirtitutioneller Ansatz) sowie deren Varianten (WE-Modelle von Erikson/Jonsson und Esser, Mehrebenenmodell von Becker) verglichen und anhand eines fortlaufenden Beispiels illustriert.
Schlüsselwörter
Bildungsexpansion, Bildungsungleichheit, Egalisierung, Humankapital, positionales Gut, Signaltheorie, methodologischer Individualismus, Neointitutionelle Theorie, Reproduktion von Ungleichheit, Bildungsinflation.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Bildungsexpansion und Bildungsungleichheit
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht die egalisierende Wirkung von Bildungsexpansion. Zentral ist die Frage, ob eine Ausweitung der Bildungsteilhabe zu weniger Bildungsungleichheit führt und welche Mechanismen die Ungleichheit trotz Bildungsexpansion aufrechterhalten. Analysiert werden verschiedene bildungstheoretische Perspektiven und Modelle, die den Zusammenhang zwischen Bildungsexpansion und sozialer Ungleichheit erklären.
Welche bildungstheoretischen Perspektiven werden betrachtet?
Der Text vergleicht gegensätzliche Bildungsverständnisse: Bildung als Konsum- und Investitionsgut (mikroökonomische Perspektive, Nutzenmaximierung) und Bildung als positionales Gut (Signaltheorie, konflikttheoretische Ansätze, Bildung als Selektionsmechanismus und Instrument der Elitenreproduktion).
Welche bildungspolitische Diskussion wird behandelt?
Der Text beleuchtet die bildungspolitische Debatte der 1960er und 1970er Jahre, insbesondere die gegensätzlichen Positionen von Schelsky ("Schule als soziale Dirigierungsstelle") und Dahrendorf ("Bildung als Bürgerrecht"). Die zentralen Schlagworte dieser Zeit werden im Kontext der heutigen Debatte um Bildungsexpansion diskutiert.
Welche Modelle zur Erklärung von Bildungsexpansion und Bildungsungleichheit werden vorgestellt?
Der Text präsentiert und vergleicht verschiedene Modelle: Boudons Ansatz (methodologischer Individualismus), Beckers neoirtitutioneller Ansatz und dessen Varianten (WE-Modelle von Erikson/Jonsson und Esser, Mehrebenenmodell von Becker). Diese Modelle werden anhand eines fortlaufenden Beispiels illustriert.
Welche Mechanismen der Reproduktion von Bildungsungleichheit werden analysiert?
Der Text analysiert die Mechanismen, die trotz Bildungsexpansion zur Reproduktion von Bildungsungleichheit beitragen. Dies beinhaltet die Untersuchung der Wechselwirkung von Bildungsexpansion mit Arbeitsmarkt und politischer Teilhabe.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text untersucht kritisch, ob Bildungsexpansion tatsächlich zu einer Verringerung von Bildungsungleichheit führt und analysiert die dahinterliegenden Mechanismen. Er geht über eine einfache programmatische Diskussion hinaus und strebt eine empirisch fundierte Analyse an.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Schlüsselwörter sind: Bildungsexpansion, Bildungsungleichheit, Egalisierung, Humankapital, positionales Gut, Signaltheorie, methodologischer Individualismus, Neoirtitutionelle Theorie, Reproduktion von Ungleichheit, Bildungsinflation.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Struktur ist klar und systematisch aufgebaut, um die komplexe Thematik übersichtlich darzustellen.
- Citation du texte
- Alexander-Kenneth Nagel (Auteur), 2004, Bildungsexpansion und Bildungsungleichheit. Zwischen Fahrstuhleffekt und Nivellierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42512