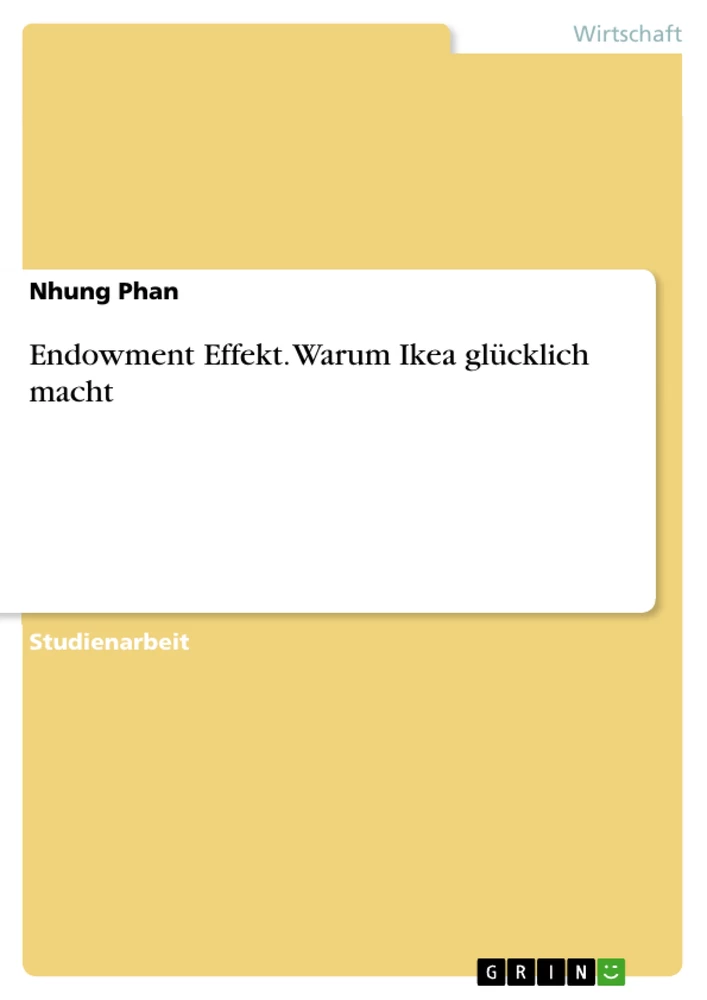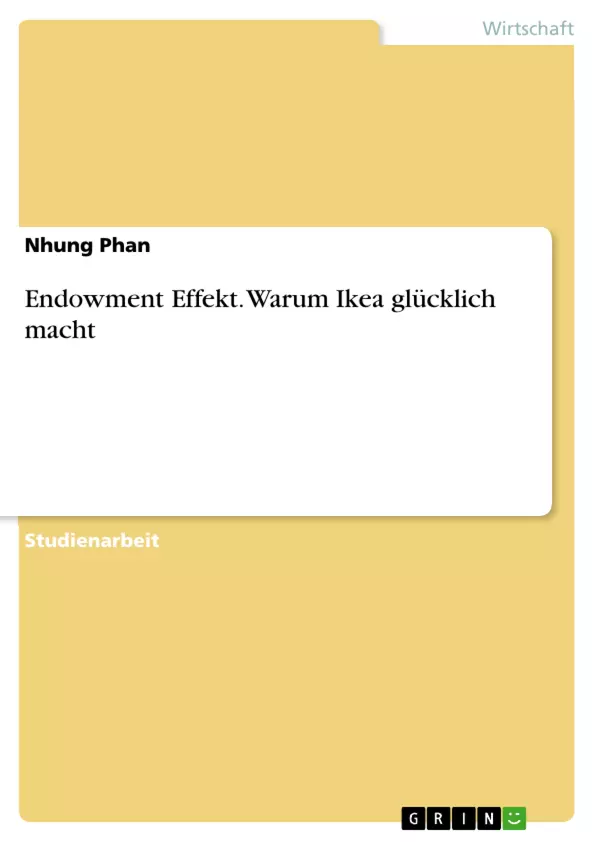Im Rahmen dieser Seminararbeit wird eine Untersuchung des Möbelherstellers Ikea hinsichtlich des Endowment-Effekts angestrebt. Von besonderem Interesse sind hierbei, unter welchen Aspekten Konsumenten eine emotionale Bindung zu ihren Ikea-Möbeln aufbauen und weshalb der Besitztumseffekt bei Ikea Möbeln besonders stark ausgeprägt ist.
Als Ingvar Kamprad vor mehr als 70 Jahren Ikea gegründet hat, hätte der Gründer damals wohl nicht damit gerechnet, dass aus der damaligen kleinen schwedischen Versandfirma heute ein globales Netzwerk, mit einschließlich 403 Möbelhäusern, entsteht, welche in insgesamt 49 Ländern platziert sind. Mittels einer durchdachten Strategie verführt Ikea geschickt seine Konsumenten mit eindrucksvollen, inspirierenden Wohnungseinrichtungen in eine eigene Welt, die die Besucher ungern verlassen. Hinter dem Verkauf der bekannten Ikea-Hot-Dogs steckt unter anderem eine Verkaufsstrategie, die den Kunden dazu verleitet mehr Geld und Stunden im Möbelhaus zu investieren, als geplant. Kaum ein anderer Möbelhersteller hat es durch sein strategisches Unternehmenskonzept und vor allem durch seine Kaufpsychologie geschafft, zum beliebtesten Einrichtungshaus der Welt zu werden. Im Vergleich zu einem vorgefertigten Produkt, sorgt die eigene Arbeitsleistung, sprich die Selbstmontage bei Ikea dafür, dass anschließend die Wertschätzung und der Nutzen des Produktes seitens der Konsumenten höher und wertvoller bewertet wird als bei einem fertig gekauften Möbelstück. Dies kann damit begründet werden, dass der Konsument während der Produktzusammenstellung gleichzeitig zu diesem auch eine emotionale Bindung aufbaut. Infolge dessen schätzt dieser den Wert des Gutes höher, als den tatsächlichen Preis. Insbesondere zeigt es sich beim Wiederverkauf der Möbelstücke, dass diese zu einem höheren Wert verkauft werden, als man es bei gebrauchten, relativ günstigen Möbelstück erwarten würde. In der Verhaltensökonomie wird der Zuwachs an Wertschätzung durch den Besitz eines Gutes auch als Besitztumseffekt (engl.: Endowment-Effect) definiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ziele der Seminararbeit
- 1.2 Elemente der Seminararbeit
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Prospect Theory von Kahnemann und Tversky
- 2.2. Begriffsdefinition „Endowment-Effekt“
- 2.3. Die Verlustaversion
- 3. Der Endowment-Effekt bei Ikea
- 3.1. Der Kaufentscheidungsprozess bei Ikea
- 3.2. Warum Ikea glücklich macht
- 3.3. Der „Ikea Effekt“ nach Norton, Mochon und Ariely
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Endowment-Effekt am Beispiel des Möbelherstellers Ikea. Das Hauptziel ist es, zu analysieren, wie Konsumenten eine emotionale Bindung zu Ikea-Möbeln aufbauen und warum der Besitztumseffekt bei diesen Produkten besonders stark ausgeprägt ist. Die Arbeit beleuchtet die relevanten theoretischen Grundlagen, insbesondere die Prospect Theory und den Einfluss der Verlustaversion.
- Der Endowment-Effekt und seine psychologischen Grundlagen
- Die Prospect Theory und ihre Anwendung auf Konsumverhalten
- Der Einfluss der Selbstmontage auf die Wertschätzung von Ikea-Produkten
- Der Kaufentscheidungsprozess bei Ikea und seine psychologischen Aspekte
- Analyse des "Ikea-Effekts"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den globalen Erfolg von Ikea. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem starken Endowment-Effekt bei Ikea-Produkten und der Entstehung emotionaler Bindung der Konsumenten an diese Möbel. Der Fokus liegt auf dem Unterschied zwischen dem Wert eines selbstmontierten und eines fertig gekauften Möbelstücks. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die darin behandelten Aspekte.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es die Prospect Theory von Kahnemann und Tversky erläutert. Es wird der Unterschied zwischen der Prospect Theory und der Erwartungsnutzentheorie erklärt und die Bedeutung der Verlustaversion für den Endowment-Effekt hervorgehoben. Das Kapitel liefert ein umfassendes Verständnis der psychologischen Mechanismen, die dem Endowment-Effekt zugrunde liegen, und bildet damit die Basis für die spätere Analyse des Ikea-Falls.
3. Der Endowment-Effekt bei Ikea: Dieses Kapitel analysiert den Endowment-Effekt im Kontext von Ikea. Es untersucht den Kaufentscheidungsprozess bei Ikea, beleuchtet die Faktoren, die zu einer emotionalen Bindung der Kunden an ihre Möbel führen, und erklärt, warum der Besitztumseffekt bei Ikea-Produkten besonders stark ausgeprägt ist. Die Rolle der Selbstmontage und die emotionale Investition des Kunden während des Zusammenbaus werden ausführlich diskutiert, um den erhöhten wahrgenommenen Wert des Produkts zu erklären. Der „Ikea Effekt“ wird im Detail beschrieben und eingeordnet.
Schlüsselwörter
Endowment-Effekt, Prospect Theory, Verlustaversion, Ikea, Kaufentscheidungsprozess, Selbstmontage, emotionale Bindung, Konsumentenverhalten, Verhaltensökonomie, Wertschätzung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Der Endowment-Effekt bei IKEA
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Endowment-Effekt, also den Effekt des Besitzes, am Beispiel des Möbelherstellers IKEA. Sie analysiert, wie Konsumenten eine emotionale Bindung zu IKEA-Möbeln aufbauen und warum der Besitztumseffekt bei diesen Produkten besonders stark ausgeprägt ist.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse der Entstehung emotionaler Bindung zu IKEA-Möbeln und die Erklärung des starken Endowment-Effekts bei diesen Produkten. Die Arbeit beleuchtet die relevanten theoretischen Grundlagen, insbesondere die Prospect Theory und den Einfluss der Verlustaversion.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf die Prospect Theory von Kahneman und Tversky. Es wird der Unterschied zwischen der Prospect Theory und der Erwartungsnutzentheorie erklärt und die Bedeutung der Verlustaversion für den Endowment-Effekt hervorgehoben. Der Endowment-Effekt und seine psychologischen Grundlagen werden umfassend erläutert.
Welche Rolle spielt die Selbstmontage bei IKEA-Produkten?
Die Seminararbeit untersucht den Einfluss der Selbstmontage auf die Wertschätzung von IKEA-Produkten. Die emotionale Investition des Kunden während des Zusammenbaus und die damit verbundene erhöhte wahrgenommene Wert des Produkts werden ausführlich diskutiert.
Was ist der „IKEA-Effekt“?
Die Arbeit beschreibt und ordnet den „IKEA-Effekt“ (nach Norton, Mochon und Ariely) ein, der sich auf die erhöhte Wertschätzung selbstgebauter Produkte bezieht.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (Prospect Theory, Verlustaversion, Endowment-Effekt), ein Kapitel zur Analyse des Endowment-Effekts bei IKEA (Kaufentscheidungsprozess, emotionale Bindung, Selbstmontage, IKEA-Effekt) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Endowment-Effekt, Prospect Theory, Verlustaversion, IKEA, Kaufentscheidungsprozess, Selbstmontage, emotionale Bindung, Konsumentenverhalten, Verhaltensökonomie, Wertschätzung.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Thematik, zentrale Forschungsfrage, Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 (Theoretische Grundlagen): Erläuterung der Prospect Theory, Verlustaversion und deren Bedeutung für den Endowment-Effekt.
Kapitel 3 (Der Endowment-Effekt bei IKEA): Analyse des Endowment-Effekts bei IKEA, Kaufentscheidungsprozess, emotionale Bindung, Rolle der Selbstmontage, „IKEA-Effekt“.
Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse.
- Citar trabajo
- Nhung Phan (Autor), 2018, Endowment Effekt. Warum Ikea glücklich macht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424594