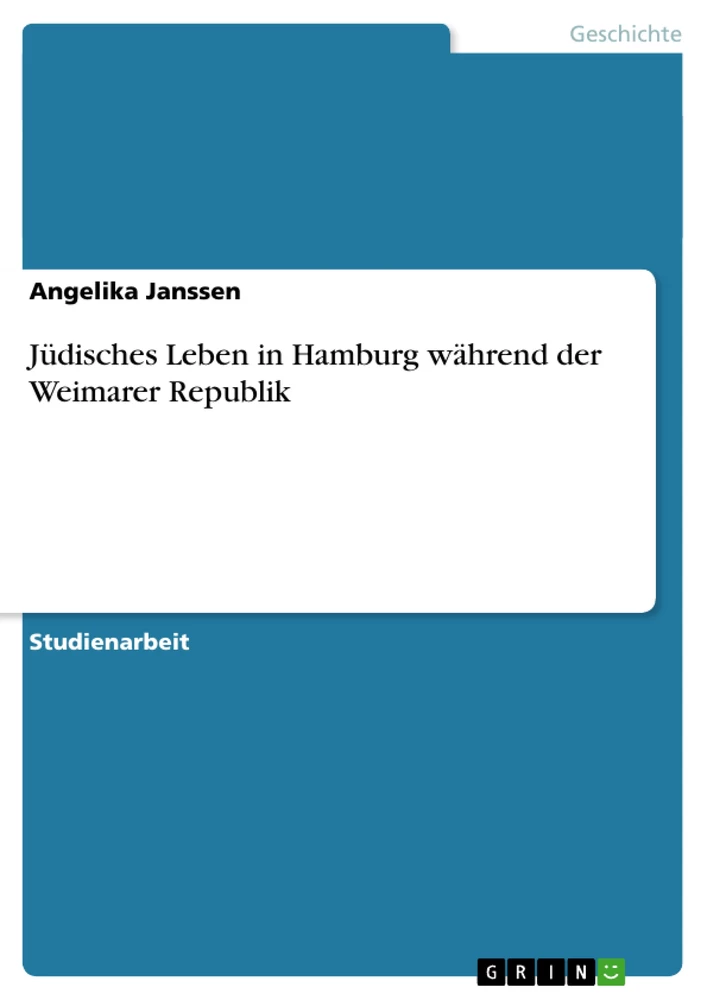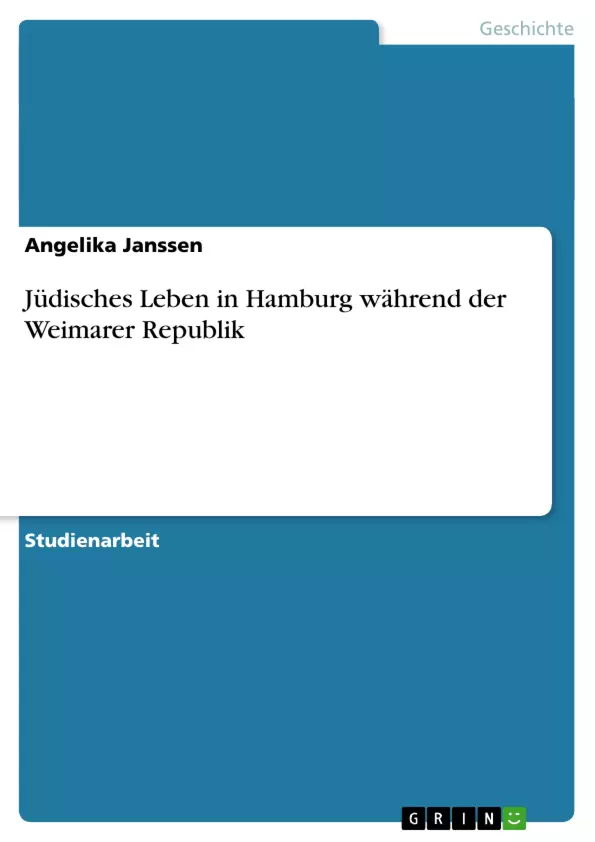Einleitung
Heute leben laut Angabe des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden etwa 1500 Juden in Hamburg; 1933 waren es 24 000. Von dem einst so vielfältigen jüdischen Leben sind nur noch wenige Spuren in Form von Denkmalen, Gedenktafeln oder Gebäuden erhalten, die mittlerweile längst einem anderen als ihrem ursprünglichen Zweck dienen. Diese Hausarbeit möchte in ausgewählten Bereichen einen Überblick geben, wie jüdisches Leben zwischen 1919 und 1939 in Hamburg gestaltet wurde. Wandsbek und Altona, wo sich schon seit dem 17. Jahrhundert Juden angesiedelt hatten, gehörten erst nach der Eingemeindung 1937 zu Hamburg. Nachdem in der Hamburger Verfassung von 1860 die rechtliche Basis für die Gleichstellung der Juden geschaffen wurde und mit dem Recht auf freie Wohnortwahl der jüdischen Bevölkerung innerstädtische Mobilität zugebilligt wurde, bildete sich die Neustadt und nach deren Übervölkerung der „Grindel“ als bevorzugte Wohngegend der Hamburger Juden heraus.
Mit Blick sowohl auf die absoluten Zahlen jüdischer Bewohner als auch auf die prozentual an der Gesamtbevölkerung gemessenen Anteile konzentriert sich diese Darstellung im wesentlichen auf den Stadtteil, in dem im zu betrachtenden Zeitraum die meisten Juden lebten: ein etwa einen Quadratkilometer messendes Areal zwischen den Straßen Grindelhof, Grindelallee und Hallerstraße: den Grindel. Verwaltungsrechtlich gab es nie einen Stadtteil „Grindel“; das Gebiet zählt zu den benachbarten Stadtteilen Rotherbaum, Harvestehude und Eimsbüttel. Der Begriff ist jedoch jedem Hamburger geläufig und wird nach wie vor zur Bezeichnung des heutigen Universitätsviertels verwendet. Wo es der Stellenwert der Gegenstände erfordert, werden andere Stadtbereiche miteinbezogen.
Neben der deutsch-israelitischen Gemeinde bestand in Hamburg bereits seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine portugiesisch-jüdische Gemeinde. Wegen ihrer geringen Mitgliederzahl im Betrachtungszeitraum dieser Arbeit (1935: 170 Mitglieder) wird auf eine Darstellung ihres Gemeindelebens, dessen Mittelpunkt mit der Synagoge in der Innocentiastraße in Harvestehude lag, hier verzichtet...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziodemographische Einordnung der Hamburger Juden
- Institutionen
- Synagogen und Tempel
- Die Neue Dammtor-Synagoge
- Die Synagoge am Bornplatz
- Der Tempel in der Poolstraße und der Tempel in der Oberstraße
- Synagoge Heinrich-Barth-Straße
- Alte und Neue Klaus
- Schulen
- Die Talmud-Tora-Realschule
- Die Israelitische Töchterschule in der Karolinenstraße
- Die Israelitische höhere Mädchenschule
- Jüdische Einrichtungen zur Förderung und Vorbereitung der Auswanderung: „Hechaluz“ und „Hachscharah“
- Synagogen und Tempel
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das jüdische Leben in Hamburg während der Weimarer Republik (1919-1939) und beleuchtet die vielfältigen Facetten des jüdischen Lebens in dieser Zeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die soziodemographischen Aspekte der Hamburger Juden, die wichtigsten Institutionen der jüdischen Gemeinde und die Entwicklung der jüdischen Auswanderung.
- Soziodemographische Entwicklung der Hamburger Juden
- Institutionen des jüdischen Lebens: Synagogen, Schulen, Vereine
- Jüdische Auswanderung: „Hechaluz“ und „Hachscharah“
- Der Einfluss von Tradition und Moderne auf das jüdische Leben
- Die Herausforderungen des jüdischen Lebens in der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und gibt einen Überblick über die historische Entwicklung des jüdischen Lebens in Hamburg. Das zweite Kapitel befasst sich mit der soziodemographischen Einordnung der Hamburger Juden und betrachtet die demographischen Veränderungen der jüdischen Bevölkerung in der Weimarer Republik. Das dritte Kapitel beleuchtet die wichtigsten Institutionen des jüdischen Lebens in Hamburg, darunter Synagogen, Schulen und Vereine.
Schlüsselwörter
Jüdisches Leben, Hamburg, Weimarer Republik, Soziodemographie, Institutionen, Synagogen, Schulen, Auswanderung, „Hechaluz“, „Hachscharah“, Tradition, Moderne, Antisemitismus, Nationalsozialismus.
Häufig gestellte Fragen
Wo lebten die meisten Juden in Hamburg während der Weimarer Republik?
Das Zentrum jüdischen Lebens war das "Grindel-Viertel" (Rotherbaum/Harvestehude), wo sich eine dichte Infrastruktur aus Synagogen, Schulen und Geschäften entwickelte.
Welche Bedeutung hatte die Talmud-Tora-Schule?
Die Talmud-Tora-Realschule im Grindelhof war das bedeutendste Bildungszentrum für jüdische Jungen in Hamburg und verband religiöse Lehre mit moderner Bildung.
Was war die Bornplatzsynagoge?
Sie war die größte Synagoge Norddeutschlands und das religiöse Herzstück der deutsch-israelitischen Gemeinde in Hamburg, bevor sie 1938 zerstört wurde.
Was versteht man unter "Hechaluz" und "Hachscharah"?
Dies waren Organisationen und Vorbereitungskurse für die jüdische Auswanderung (Alijah), insbesondere nach Palästina, um junge Menschen auf das landwirtschaftliche Leben dort vorzubereiten.
Wie viele Juden lebten 1933 in Hamburg?
Im Jahr 1933 lebten etwa 24.000 Juden in Hamburg. Heute sind es im Vergleich dazu nur noch etwa 1.500.
- Quote paper
- Angelika Janssen (Author), 1999, Jüdisches Leben in Hamburg während der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42450