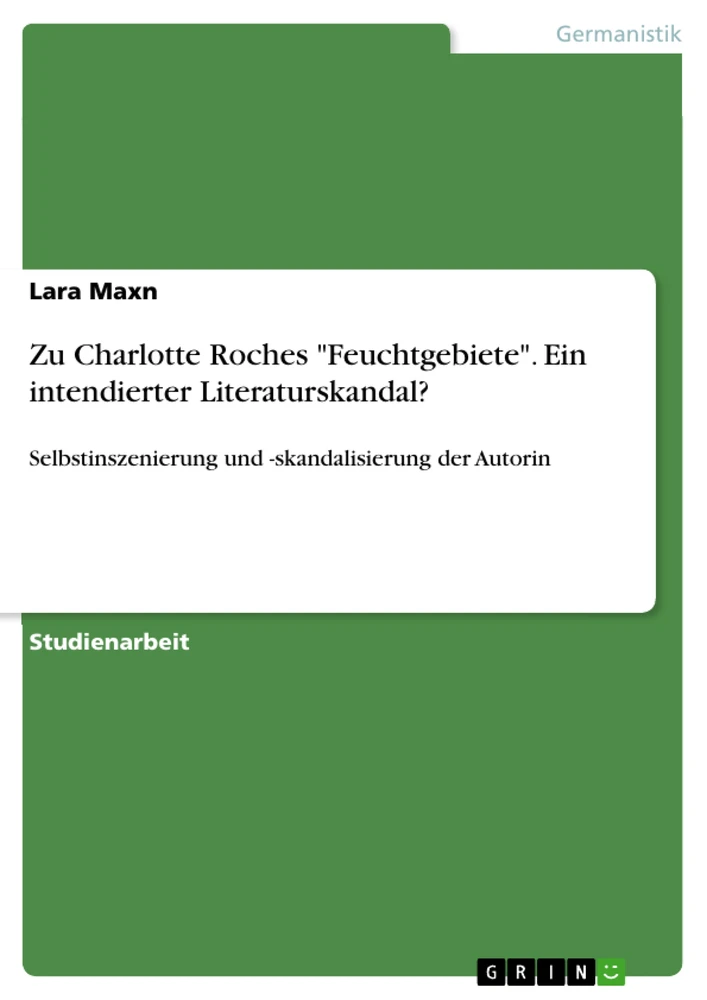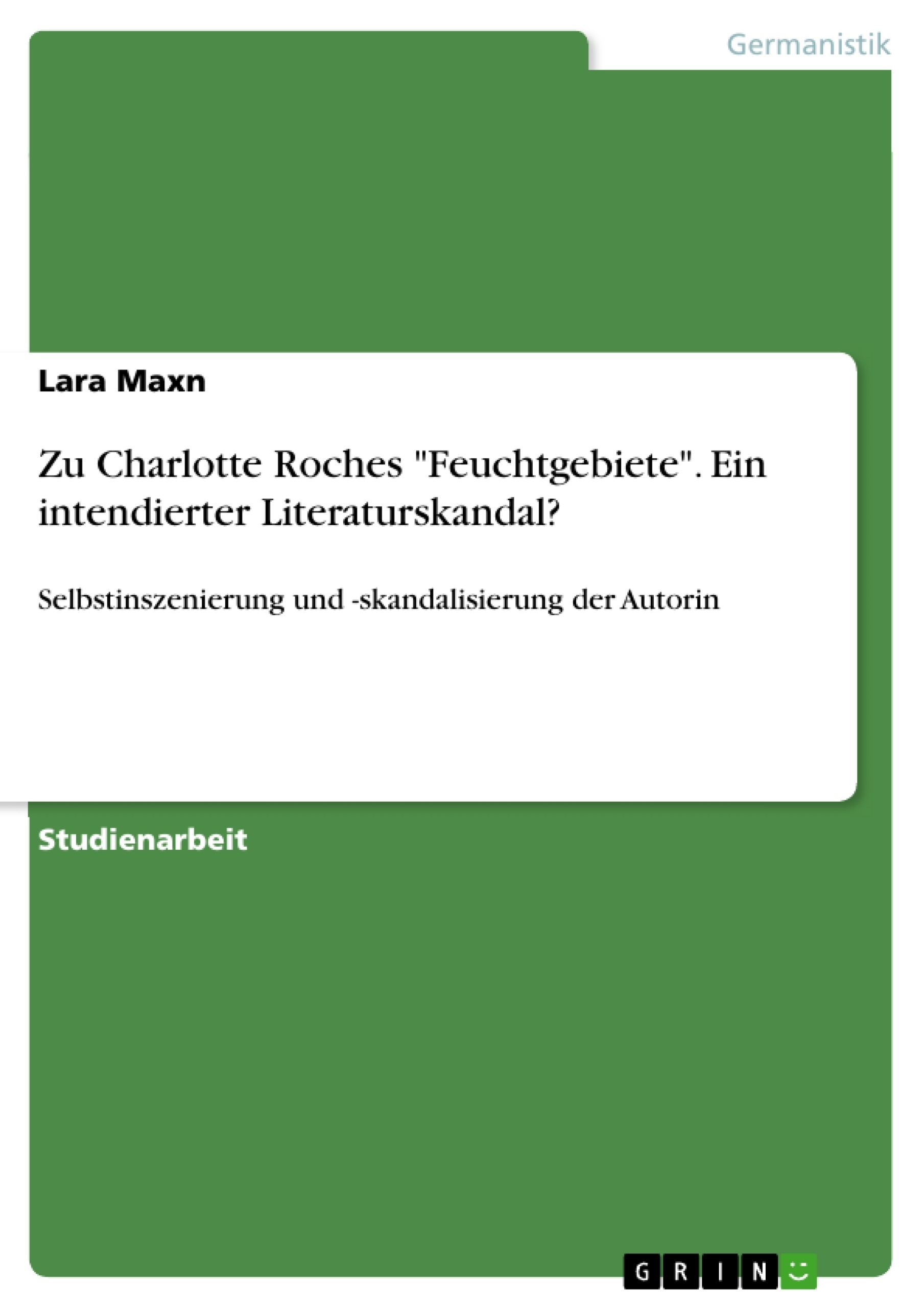Gepaart mit dem raschen Erfolg des Romans, dessen Inhalt sich einer derben Thematik, Mitteln der Provokation und der
Erzeugung von Ekel bedient, lässt sich fragen ob Charlotte Roche bewusst mit den gesellschaftlichen Tabus gespielt hat, um mit Feuchtgebiete einen Skandal zu erzeugen.
Ausgehend von der notwendigen begrifflichen Klärung gehe ich zunächst auf der Grundlage der Forschungsliteratur der Frage nach, was im eigentlichen Sinne einen Skandal ausmacht. Anschließend werden die Modelle zur Analyse von Medienskandalen
aufgezeigt und die Ziele intendierter Skandale dargelegt. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll herausgearbeitet werden ob es sich bei Feuchtgebiete um einen intendierten Skandal handelt. Dazu wird zunächst die mediale Selbstdarstellung von Charlotte Roche näher beleuchtet und anschließend ihre Vorgehensweise in Interviews analysiert. Die Schlussbetrachtung fasst schließlich die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Skandal - Ein Einstieg
- Zur Etymologie des Skandalbegriffs
- Was ist ein Skandal?
- Modelle zur Analyse von Skandalen
- Feuchtgebiete – Ein intendierter Literaturskandal?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob Charlotte Roches Roman „Feuchtgebiete“ einen intendierten Literaturskandal darstellt. Die Analyse basiert auf einer begrifflichen Klärung des Skandalbegriffs und der Betrachtung von Modellen zur Analyse von Medienskandalen. Die mediale Selbstdarstellung der Autorin und ihre Interviewstrategien werden kritisch beleuchtet.
- Definition und Charakterisierung von Skandalen
- Analyse von Medienskandalen und deren intendierter Natur
- Die Rolle der Medien bei der Produktion und Verstärkung von Skandalen
- Charlotte Roches mediale Selbstdarstellung und ihre Strategien
- Die Frage nach der Intentionalität des Skandals um "Feuchtgebiete"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den immensen Erfolg von Charlotte Roches Roman „Feuchtgebiete“ und die gleichzeitig entstandene öffentliche Empörung beschreibt. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Intentionalität des Skandals und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das Zitat von Charlotte Roche dient als provokanter Aufhänger und verdeutlicht die kontroverse Natur des Romans und der Autorin selbst. Die Einleitung verbindet den kommerziellen Erfolg mit der gleichzeitig starken öffentlichen Kritik, um den Kontext des Skandals zu etablieren.
Zum Skandal - Ein Einstieg: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff „Skandal“ aus etymologischer und soziologischer Perspektive. Es wird die historische Entwicklung des Begriffs nachgezeichnet, beginnend mit der griechischen Bedeutung als „Stellholz einer Tierfalle“ bis hin zur modernen Konnotation von „Erregung öffentlichen Ärgernisses“. Der Abschnitt definiert Skandale als aufsehen erregende Ereignisse, die durch die Verletzung gesellschaftlicher Normen entstehen und durch die Medien verstärkt werden. Die Rolle der Medien als „Skandalproduzenten“ wird betont und der dynamische, zeitlich begrenzte Charakter von Skandalen wird hervorgehoben. Es wird auch die Paradoxie diskutiert, dass Skandale häufiger in demokratischen Gesellschaften vorkommen, da sie einen freien Diskurs über Normen ermöglichen und somit zur Stärkung oder Korrektur gesellschaftlicher Normen beitragen.
Schlüsselwörter
Literaturskandal, Feuchtgebiete, Charlotte Roche, Medienskandal, Selbstinszenierung, gesellschaftliche Normen, Tabubruch, Medienwirkung, öffentliche Empörung, Intentionalität.
Häufig gestellte Fragen zu "Feuchtgebiete" - Literaturskandal oder inszenierte Provokation?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob der Roman "Feuchtgebiete" von Charlotte Roche einen absichtlich herbeigeführten Literaturskandal darstellt. Die Analyse umfasst die begriffliche Klärung des Skandalbegriffs, die Betrachtung von Modellen zur Analyse von Medienskandalen und eine kritische Auseinandersetzung mit der medialen Selbstdarstellung der Autorin und ihren Interviewstrategien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Charakterisierung von Skandalen; Analyse von Medienskandalen und deren intendierter Natur; die Rolle der Medien bei der Produktion und Verstärkung von Skandalen; Charlotte Roches mediale Selbstdarstellung und Strategien; und die Frage nach der Intentionalität des Skandals um "Feuchtgebiete".
Wie wird der Skandalbegriff definiert?
Der Begriff "Skandal" wird etymologisch und soziologisch beleuchtet. Es wird seine historische Entwicklung nachgezeichnet und seine moderne Konnotation als "Erregung öffentlichen Ärgernisses" definiert. Skandale werden als aufsehen erregende Ereignisse beschrieben, die durch die Verletzung gesellschaftlicher Normen entstehen und durch die Medien verstärkt werden. Die Rolle der Medien als "Skandalproduzenten" und der dynamische, zeitlich begrenzte Charakter von Skandalen werden hervorgehoben.
Welche Rolle spielen die Medien?
Die Arbeit betont die entscheidende Rolle der Medien bei der Produktion und Verstärkung von Skandalen. Die mediale Selbstdarstellung von Charlotte Roche und ihre Interviewstrategien werden kritisch untersucht, um deren Beitrag zum öffentlichen Aufschrei zu analysieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsklärung des Skandals, ein Kapitel zu Modellen der Skandal-Analyse, ein Kapitel zur Analyse von "Feuchtgebiete" im Kontext eines möglichen intendierten Literaturskandals und eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlussfolgerung wird angestrebt?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit ist, ob der Skandal um "Feuchtgebiete" von Charlotte Roche intendiert war. Die Analyse zielt darauf ab, diese Frage durch die Betrachtung verschiedener Aspekte, darunter die mediale Inszenierung und die begriffliche Einordnung des Skandals, zu beantworten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Literaturskandal, Feuchtgebiete, Charlotte Roche, Medienskandal, Selbstinszenierung, gesellschaftliche Normen, Tabubruch, Medienwirkung, öffentliche Empörung, Intentionalität.
Was ist der Inhalt der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt den immensen Erfolg von "Feuchtgebiete" und die gleichzeitig entstandene öffentliche Empörung. Sie formuliert die zentrale Forschungsfrage nach der Intentionalität des Skandals und skizziert den Aufbau der Arbeit. Ein Zitat von Charlotte Roche dient als provokanter Aufhänger.
Wie wird das Kapitel "Zum Skandal - Ein Einstieg" beschrieben?
Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff "Skandal" aus etymologischer und soziologischer Sicht. Es verfolgt die historische Entwicklung des Begriffs nach und definiert Skandale als aufsehen erregende Ereignisse, die durch den Bruch gesellschaftlicher Normen entstehen und von den Medien verstärkt werden. Es wird auch die Paradoxie diskutiert, dass Skandale häufiger in demokratischen Gesellschaften vorkommen.
- Quote paper
- Lara Maxn (Author), 2017, Zu Charlotte Roches "Feuchtgebiete". Ein intendierter Literaturskandal?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424489