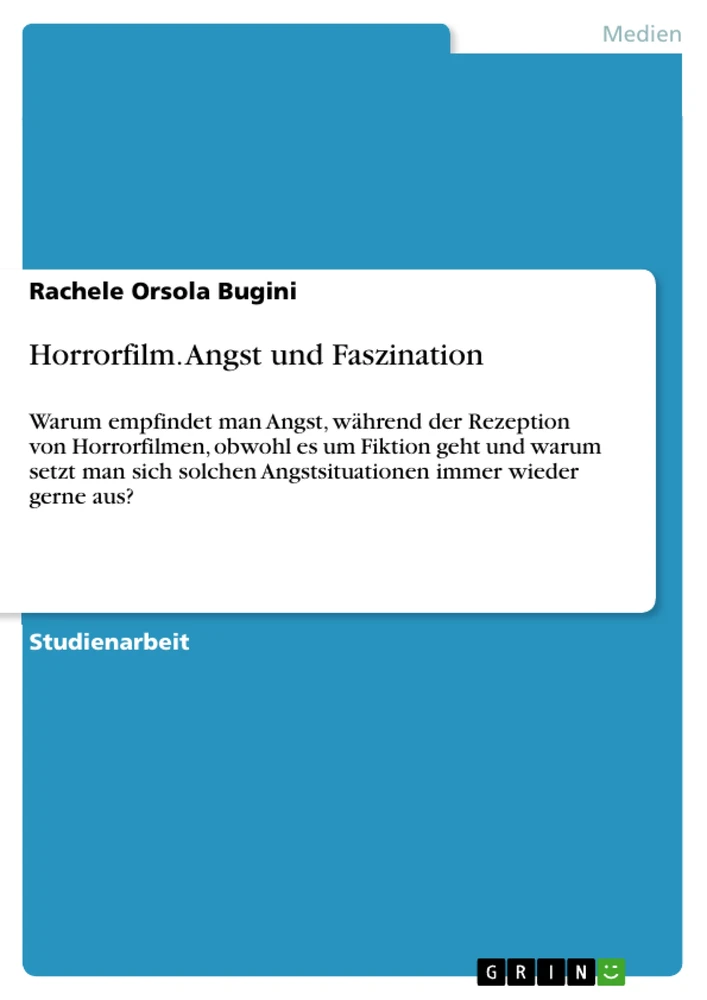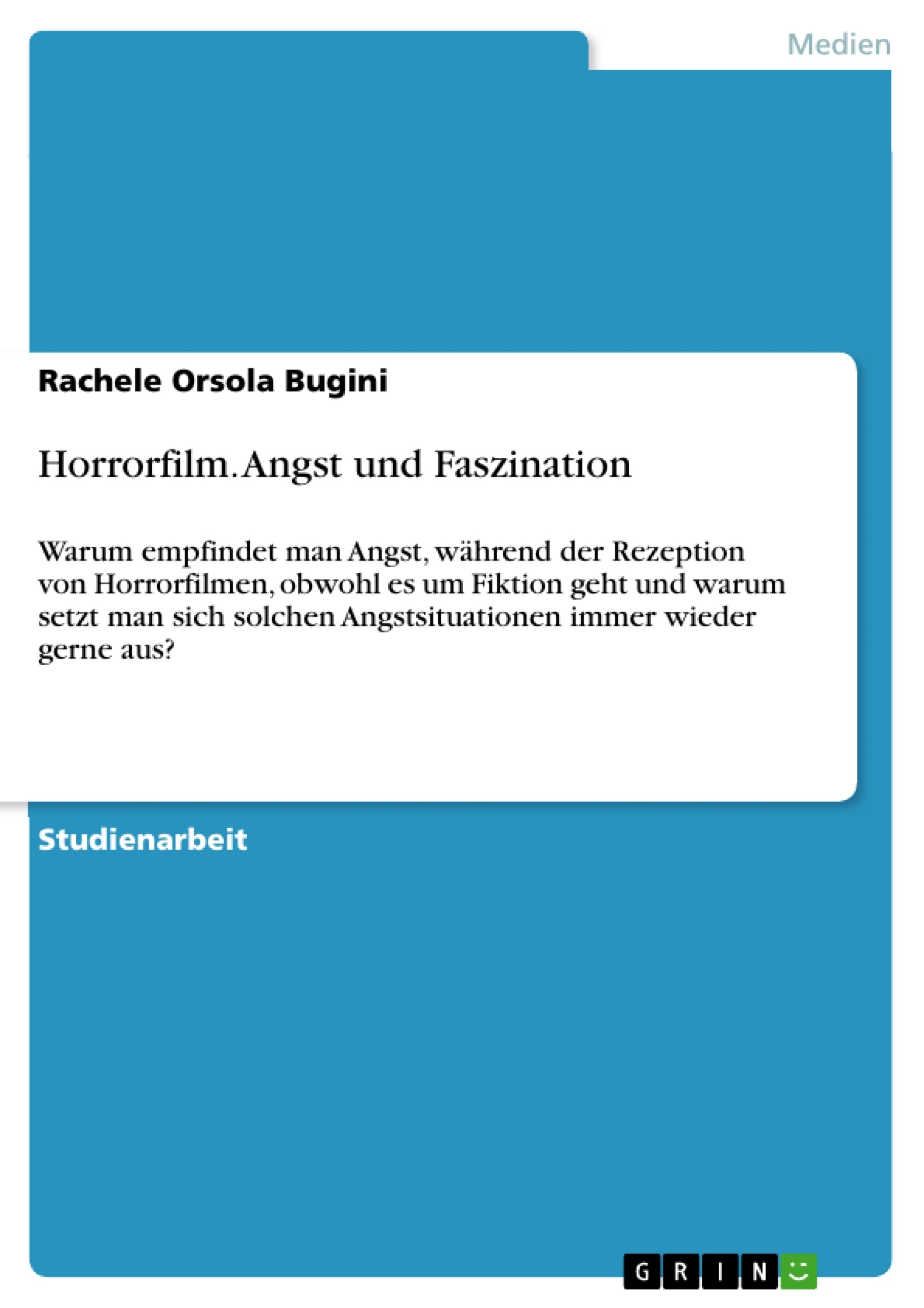Warum empfindet man Angst, während der Rezeption von Horrorfilmen, obwohl es um Fiktion geht und warum setzt man sich solchen Angstsituationen immer wieder gerne aus? Mit diesem Thema, der Frage nach dem Hervorrufen von Angst und dem Vergnügen am Horrorfilm beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Diese Analyse der Angstreaktion auf den Film muss als filmphänomenologische Arbeit definiert werden, da es um eine Aufwertung der sinnlichen Wahrnehmung von audiovisuellen Bewegtbildern geht, deren Untersuchung meistens auf dem phänomenologischen Ansatz Maurice Merleau-Pontys aufbaut. Zentral für diese Arbeit ist die von Vivian Sobchack vertretenen Variante der Phänomenologie, in der der Bezug auf den Körper von zentraler Bedeutung ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Begriff "Angst"
- 2. Horrorfilme
- 3. Angst und filmische Fiktion: affektive und emotionale Antworten
- 3.1 Zuschauer-Mechanismen
- 4. Lust in der Rezeption von Horrorfilmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexen affektiven Reaktionen, insbesondere Angst, die durch den Konsum von Horrorfilmen ausgelöst werden. Sie analysiert das Phänomen, dass Zuschauer trotz des Wissens um die Fiktionalität des Dargestellten intensive Angst empfinden und dennoch wiederholt Horrorfilme rezipieren. Die Arbeit stützt sich auf einen phänomenologischen Ansatz, der die körperliche und sinnliche Wahrnehmung des Zuschauers betont.
- Definition und Abgrenzung von Angst und Furcht
- Charakteristika des Horrorfilms als Genre
- Der Zuschauer als "kinästhetisches Subjekt" und dessen emotionale Reaktion
- Erklärung des Genusses am Horrorfilm trotz Angst
- Analyse der Rolle des Mediums Film bei der Angstinduktion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die komplexen affektiven Reaktionen, die Horrorfilme beim Zuschauer auslösen können. Sie hebt die scheinbare Paradoxie hervor: das gleichzeitige Wissen um die Fiktionalität und die intensive, körperliche Angst. Die Arbeit wird als filmphänomenologische Untersuchung definiert, welche die sinnliche Wahrnehmung und den körperlichen Bezug des Zuschauers betont und sich auf die phänomenologische Herangehensweise von Vivian Sobchack stützt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die zentralen Fragen, die behandelt werden.
1. Der Begriff "Angst": Dieses Kapitel widmet sich der Klärung des Begriffs „Angst“. Es untersucht dessen etymologische Wurzeln, beleuchtet psychologische Definitionen und grenzt den Begriff von „Furcht“ ab. Unter Bezugnahme auf Kierkegaard und Blumenberg wird der Unterschied zwischen der gegenstandslosen Angst und der auf ein konkretes Objekt bezogenen Furcht herausgearbeitet. Die Bedeutung dieser Unterscheidung für das Verständnis der Angstreaktion auf Horrorfilme wird angedeutet, wobei die Rolle der „Rhetorik der Darstellung“ im Film hervorgehoben wird. Angst-Effekte als Verfahren zum Aufbau bedrohlicher Stimmung, ohne explizit Bedrohliches zu zeigen, werden erwähnt.
2. Horrorfilme: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und den Charakteristika des Genres „Horrorfilm“. Es untersucht die etymologischen Wurzeln des Begriffs „Horror“ und beleuchtet die Unterschiede zur literarischen Verwendung. Es wird die zentrale Funktion des Horrorfilms als Medium, das Angst und Schrecken beim Publikum auslösen soll, betont. Hierbei wird die Nähe des Zuschauers zu den fiktiven Charakteren hervorgehoben, sowie der idealtypische Verlauf der emotionalen Reaktionen des Publikums im Vergleich zu den Emotionen der Protagonisten. Die Merkmale des Horrorfilms werden als Bedrohung des menschlichen Geistes und der Infragestellung der Naturbeherrschung des Menschen definiert.
Schlüsselwörter
Angst, Furcht, Horrorfilm, Filmphänomenologie, kinästhetisches Subjekt, affektive Reaktionen, emotionale Reaktion, Genre, Fiktion, Rhetorik der Darstellung, Medienwirkung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Angst und Horrorfilme
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die komplexen affektiven Reaktionen, insbesondere Angst, die durch den Konsum von Horrorfilmen ausgelöst werden. Sie analysiert das Phänomen, dass Zuschauer trotz des Wissens um die Fiktionalität des Dargestellten intensive Angst empfinden und dennoch wiederholt Horrorfilme rezipieren.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf einen phänomenologischen Ansatz, der die körperliche und sinnliche Wahrnehmung des Zuschauers betont. Sie verwendet eine filmphänomenologische Herangehensweise, die den körperlichen Bezug des Zuschauers in den Mittelpunkt stellt und sich auf die phänomenologische Herangehensweise von Vivian Sobchack stützt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Angst und Furcht, die Charakteristika des Horrorfilms als Genre, den Zuschauer als "kinästhetisches Subjekt" und dessen emotionale Reaktion, die Erklärung des Genusses am Horrorfilm trotz Angst und die Analyse der Rolle des Mediums Film bei der Angstinduktion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu dem Begriff "Angst", Horrorfilmen, Angst und filmische Fiktion (inkl. Zuschauer-Mechanismen), Lust in der Rezeption von Horrorfilmen und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Was wird im Kapitel "Der Begriff 'Angst'" behandelt?
Dieses Kapitel klärt den Begriff "Angst", untersucht dessen etymologische Wurzeln und psychologische Definitionen, grenzt ihn von "Furcht" ab (unter Bezugnahme auf Kierkegaard und Blumenberg) und deutet die Bedeutung dieser Unterscheidung für das Verständnis der Angstreaktion auf Horrorfilme an. Die "Rhetorik der Darstellung" im Film und Angst-Effekte werden ebenfalls thematisiert.
Was wird im Kapitel "Horrorfilme" behandelt?
Dieses Kapitel definiert und charakterisiert das Genre "Horrorfilm", untersucht die etymologischen Wurzeln des Begriffs "Horror", beleuchtet Unterschiede zur literarischen Verwendung und betont die Funktion des Horrorfilms als Angst- und Schrecken auslösendes Medium. Die Nähe des Zuschauers zu den fiktiven Charakteren und der typische Verlauf der emotionalen Reaktionen werden analysiert. Die Merkmale des Horrorfilms werden als Bedrohung des menschlichen Geistes und Infragestellung der Naturbeherrschung definiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind Angst, Furcht, Horrorfilm, Filmphänomenologie, kinästhetisches Subjekt, affektive Reaktionen, emotionale Reaktion, Genre, Fiktion, Rhetorik der Darstellung und Medienwirkung.
Welche zentralen Fragen werden in der Arbeit gestellt?
Die Arbeit befasst sich mit der scheinbaren Paradoxie, dass Zuschauer trotz des Wissens um die Fiktionalität von Horrorfilmen intensive Angst empfinden und dennoch diese Filme wiederholt rezipieren. Sie untersucht die Mechanismen der Angstinduktion durch das Medium Film und den Genuss, der aus dieser Erfahrung resultiert.
- Quote paper
- Rachele Orsola Bugini (Author), 2017, Horrorfilm. Angst und Faszination, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424451