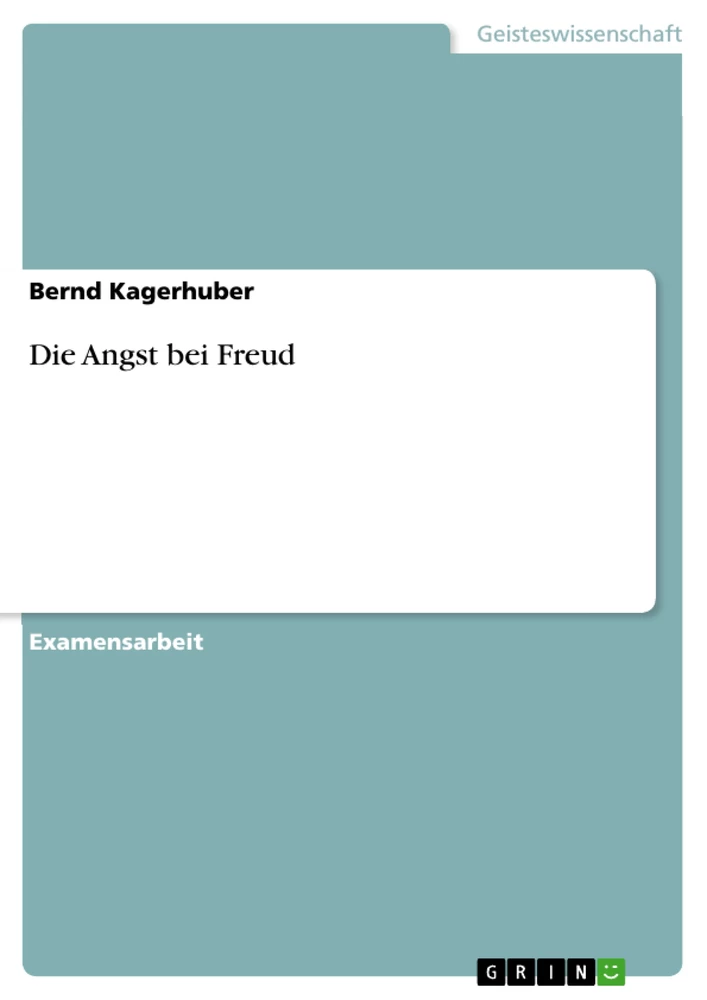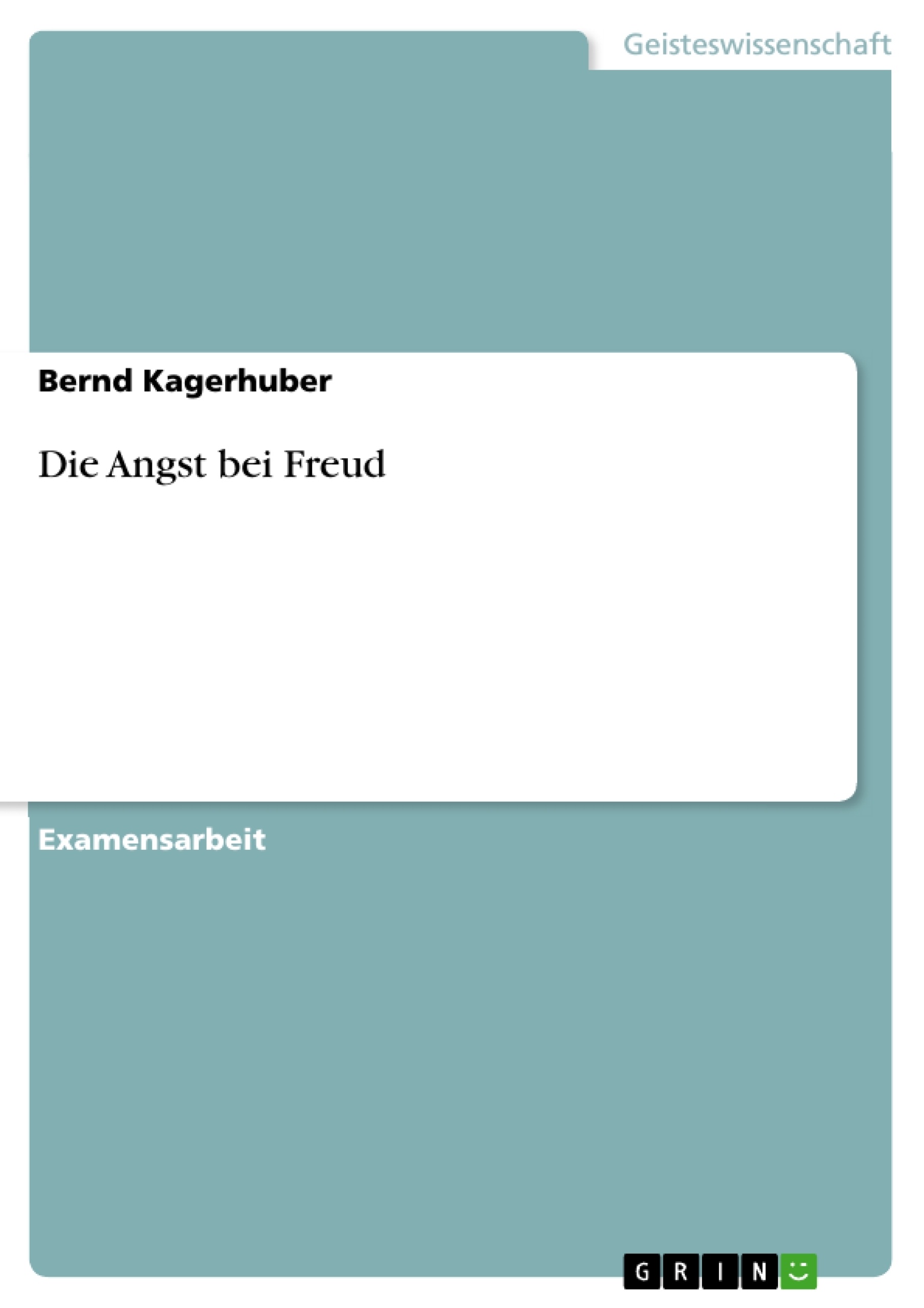Eines der größten Probleme, mit dem Sigmund Freud während seiner gesamten Forschungstätigkeit konfrontiert wurde, war das der Angst. Immer wieder stellte er sich dieser Problematik, und schon deshalb erweist es sich als schwierig, all die Spuren, die sie in seinen Werken hinterlassen hat, mit ihren vielen Verästelungen und gelegentlichen scharfen Kehren aufzuzeigen. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Art und Weise, wie Freud sich um die Klärung des Wesens der Angst bemühte. Da er versuchte, sich von den verschiedenen Seiten in immer neuen oder korrigierten Ansätzen dem Angstproblem zu nähern, fällt es schwer eine systematische Darstellung seiner Gedankengänge zu geben. So taucht ein Gedankengang, der abgeschlossen scheint, an anderer Stelle erneut wieder auf, um nun, eventuell in abgewandelter Form, einen anderen Verlauf zu nehmen. Oder er bestreitet in einem Absatz eine These, die er im nächsten Satz wieder aufnimmt, als hätte er sie nie verworfen. Ein Grund für diese Haltung dürfte wohl die Tatsache sein, daß er sich über die Probleme klar werden wollte. Wegen dieser Eigenart Freuds sah ich mich berechtigt, kritische Anmerkungen an Ort und Stelle einzufügen. Ich bin mir bewußt, daß der Ablauf dadurch manchmal gehemmt wird, dies erscheint mir jedoch weniger gravierend als eine am Ende angefügte, nicht mehr im direkten Zusammenhang stehende Kritik. Um den Umfang der vorliegenden Arbeit einzugrenzen, wird bewußt auf die Darstellung der Freudschen Abhandlungen über die hysterischen und phobischen Ängste verzichtet. Jedoch werden die Erkenntnisse, die er aus diesen Studien gewonnen hat, soweit erforderlich, berücksichtigt. Aus demselben Grunde werden auch die psychoanalytischen Grundbegriffe wie „Es“, „Ich“, „Über-Ich“, „Verdrängung“ u.a. als bekannt vorausgesetzt und im Hinblick auf ihre Aussagen im Zusammenhang mit dem Begriff der Angst abgegrenzt.
So kann die vorliegende Arbeit nur ein Versuch sein, „die Angst bei Freud“ umfassend darzustellen und zu würdigen. Unter Berücksichtigung der systematischen Zusammenhänge wurde versucht, in chronologischer Folge, die einzelnen Stationen, Ansätze und Einflüsse Freuds, auf dem Wege, eine einheitliche Angsttheorie zu gewinnen, aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- A) Freuds Bild vom Menschen
- B) Das Phänomen der Angst
- I. Der Begriff der Angst
- II. Das Wesen der Angst
- C) Das Verhältnis von Angst und Sexualität
- I. Symptome und Ätiologie der Angstneurose
- II. Angst aus verdrängter Libido
- III. Verdrängung der Libido aus Angst
- IV. Die kindliche Angst
- D) Neurotische Angst - Realangst
- I. Die neurotische Angst
- II. Realangst
- III. Verbindung von Realangst und neurotischer Angst
- IV. Angst und Schuld
- E) Angst und Gefahrsituationen
- I. Die Gefahrsituation in den einzelnen Entwicklungsstadien
- II. Trennungsangst
- III. Die Bedeutung der Gefahrsituation für die Angst
- F) Die Geburtsangst
- G) Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Sigmund Freuds Auseinandersetzung mit dem Thema Angst. Ziel ist es, Freuds verschiedene Ansätze und Entwicklungen seiner Angsttheorie nachzuvollziehen und darzustellen, ohne dabei eine systematische Darstellung zu erzwingen, die der komplexen und oft widersprüchlichen Natur von Freuds Denken nicht gerecht werden würde. Die Arbeit berücksichtigt die biologischen und psychologischen Aspekte von Freuds Denken und verzichtet bewusst auf eine detaillierte Analyse der hysterischen und phobischen Ängste, um den Umfang zu begrenzen.
- Freuds Menschenbild und seine naturwissenschaftlichen Prämissen
- Die Entwicklung von Freuds Angsttheorie und die verschiedenen Stadien seiner Auseinandersetzung mit dem Thema
- Das Verhältnis von Angst und Sexualität in Freuds Werk
- Die Unterscheidung zwischen neurotischer Angst und Realangst
- Die Rolle von Gefahrsituationen und Entwicklungsphasen in der Entstehung von Angst
Zusammenfassung der Kapitel
A) Freuds Bild vom Menschen: Dieses Kapitel beschreibt Freuds naturwissenschaftlich geprägtes Menschenbild. Freud sieht den Menschen biologisch determiniert, wobei die Angst als in der Natur des Menschen begründete Konstante verstanden wird. Seine Betrachtungsweise verbindet psychologische und physiologische Aspekte, wobei er sich auf die Charakteristika Bewußtsein und Affektivität konzentriert. Trotz der generischen Bestimmung des Menschen lehnt Freud die Festlegung normativer Grenzen ab, da die Abgrenzung von psychischer Norm und Abnormalität wissenschaftlich nicht durchführbar ist.
B) Das Phänomen der Angst: Dieses Kapitel legt den Fokus auf den Begriff und das Wesen der Angst nach Freud. Es behandelt die Schwierigkeit, Freuds Gedankengänge systematisch darzustellen, da er sich dem Thema von verschiedenen Seiten und mit korrigierenden Ansätzen näherte, was zu scheinbaren Widersprüchen in seinen Arbeiten führt.
C) Das Verhältnis von Angst und Sexualität: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Angst und Sexualität in Freuds Werk. Es beleuchtet die Symptome und Ätiologie der Angstneurose, die Rolle der verdrängten Libido und den umgekehrten Prozess der Verdrängung aus Angst. Die kindliche Angst wird ebenfalls thematisiert und im Kontext dieser komplexen Wechselbeziehung betrachtet.
D) Neurotische Angst - Realangst: Hier werden neurotische Angst und Realangst unterschieden und in Beziehung zueinander gesetzt. Der Text analysiert die spezifischen Charakteristika beider Angstformen und deren Zusammenspiel. Schließlich wird die Verbindung zwischen Angst und Schuld thematisiert, ein zentrales Element in Freuds Theorie.
E) Angst und Gefahrsituationen: In diesem Kapitel wird die Bedeutung von Gefahrsituationen in den verschiedenen Entwicklungsphasen für die Entstehung von Angst untersucht. Die Trennungsangst wird als besonderes Beispiel hervorgehoben, und die allgemeine Rolle von Gefahrsituationen für die Angstentwicklung wird umfassend analysiert.
F) Die Geburtsangst: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Betrachtung der Geburtsangst als einem fundamentalen Aspekt von Freuds Angsttheorie. Die Ausführungen beleuchten die Bedeutung dieses frühen Erlebnisses für die spätere Angstentwicklung.
Schlüsselwörter
Angst, Sigmund Freud, Psychoanalyse, Neurotische Angst, Realangst, Sexualität, Libido, Verdrängung, Gefahrsituation, Entwicklungsphasen, kindliche Angst, Geburtsangst, Menschenbild, biologische Determinierung.
Häufig gestellte Fragen zu: Sigmund Freuds Angsttheorie
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Sigmund Freuds Angsttheorie. Sie umfasst eine detaillierte Inhaltsübersicht, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Nachvollziehung von Freuds verschiedenen Ansätzen und Entwicklungen seiner Angsttheorie, ohne eine systematische Darstellung zu erzwingen, die der Komplexität seines Denkens nicht gerecht werden würde.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die folgenden Kapitel: A) Freuds Bild vom Menschen; B) Das Phänomen der Angst; C) Das Verhältnis von Angst und Sexualität; D) Neurotische Angst - Realangst; E) Angst und Gefahrsituationen; F) Die Geburtsangst; G) Schluss. Jedes Kapitel wird im Text zusammengefasst.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Freuds Menschenbild und seine naturwissenschaftlichen Prämissen; die Entwicklung von Freuds Angsttheorie und die verschiedenen Stadien seiner Auseinandersetzung mit dem Thema; das Verhältnis von Angst und Sexualität in Freuds Werk; die Unterscheidung zwischen neurotischer Angst und Realangst; die Rolle von Gefahrsituationen und Entwicklungsphasen in der Entstehung von Angst.
Wie beschreibt die Arbeit Freuds Menschenbild?
Die Arbeit beschreibt Freuds Menschenbild als naturwissenschaftlich geprägt und biologisch determiniert. Angst wird als in der Natur des Menschen begründete Konstante verstanden. Freud verbindet psychologische und physiologische Aspekte und konzentriert sich auf Bewußtsein und Affektivität. Eine normative Abgrenzung von psychischer Norm und Abnormalität wird von Freud abgelehnt.
Wie wird das Verhältnis von Angst und Sexualität dargestellt?
Das Verhältnis von Angst und Sexualität wird als komplex und wechselseitig beschrieben. Die Arbeit beleuchtet Symptome und Ätiologie der Angstneurose, die Rolle der verdrängten Libido, die Verdrängung aus Angst und die kindliche Angst im Kontext dieser Beziehung.
Wie unterscheidet die Arbeit zwischen neurotischer und Realangst?
Die Arbeit unterscheidet zwischen neurotischer und Realangst und analysiert deren spezifische Charakteristika und ihr Zusammenspiel. Die Verbindung zwischen Angst und Schuld als zentrales Element in Freuds Theorie wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielen Gefahrsituationen und Entwicklungsphasen?
Gefahrsituationen in verschiedenen Entwicklungsphasen werden als bedeutend für die Entstehung von Angst betrachtet. Die Trennungsangst wird als Beispiel hervorgehoben, und die allgemeine Rolle von Gefahrsituationen für die Angstentwicklung wird umfassend analysiert. Die Geburtsangst wird als fundamentaler Aspekt von Freuds Angsttheorie behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Angst, Sigmund Freud, Psychoanalyse, Neurotische Angst, Realangst, Sexualität, Libido, Verdrängung, Gefahrsituation, Entwicklungsphasen, kindliche Angst, Geburtsangst, Menschenbild, biologische Determinierung.
- Quote paper
- Bernd Kagerhuber (Author), 1974, Die Angst bei Freud, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4241