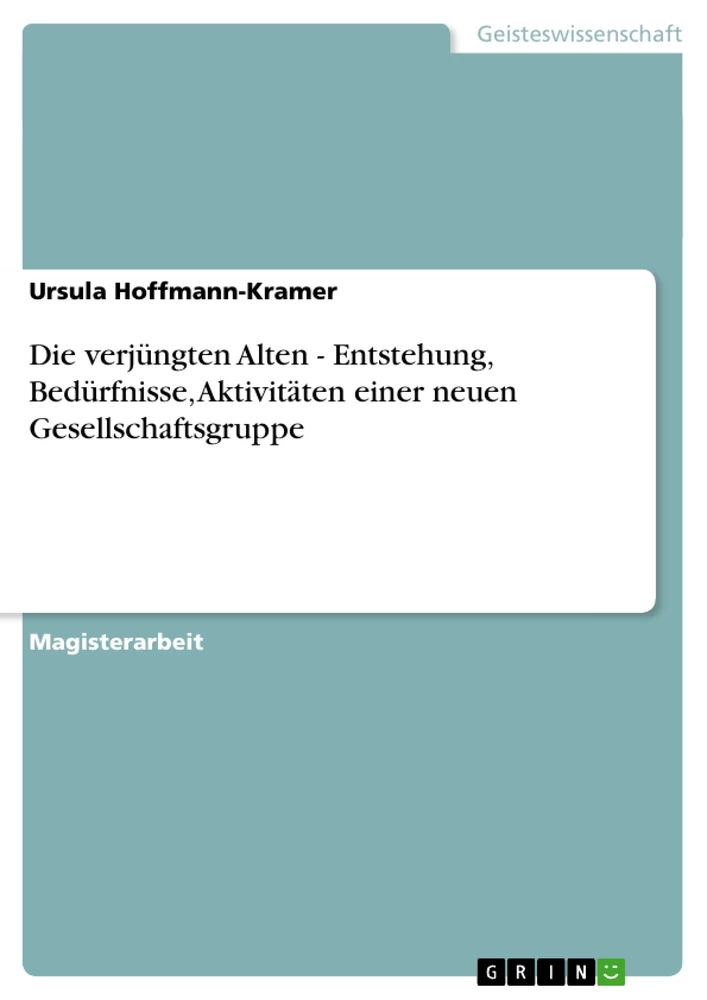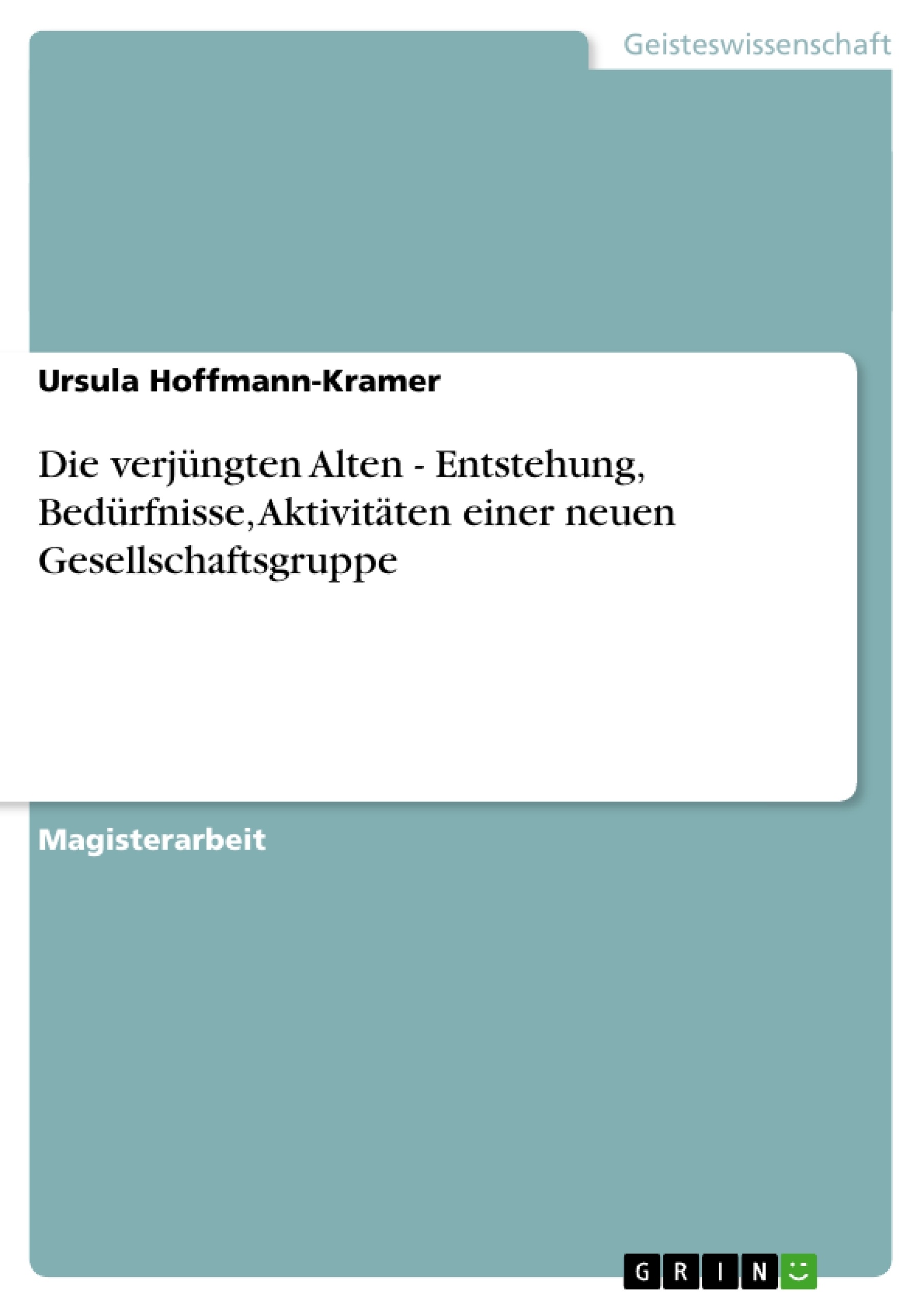Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die rüstigen, häufig vorzeitig entberuflichten Alten eines verjüngten Alters, die sogenannten „jungen“ oder „neuen“ aktiven Alten, die mehr als nur die Früh- und Vorruheständler verkörpern und die aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung noch Unternehmungen realisieren, die Personen ihres Alters vor 50 Jahren nie gewagt hätten. Es sind die jungen bzw. neuen Alten, die durch ihr Verhalten im Begriff sind, mit dem überkommenen Bild vom defizitären, eingeschränkten alten Menschen gründlich aufzuräumen und „(...) die sich nicht in die Klischees des Alters einordnen lassen.“ (Tokarski, 1998, S. 111).
Die Diskussionen um das Thema der sogenannten „neuen“ Alten haben bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eingesetzt. Anlass war die Verabschiedung des Vorruhestandsgesetzes, das von 1984 bis 1988 den vorzeitigen Berufsaustritt mit 59 Jahren ermöglichte (vgl. Tokarski/Karl, 1989, S. 9). Seither wird versucht, die „neuen“ Alten als eigenständige gesellschaftliche Gruppe soziologisch abgrenzbar und bestimmbar zu machen.
Während sich einerseits Bemühungen finden, die Gruppe der „neuen“ Alten altersmäßig einzugrenzen, wird aus gerontologischer Sicht unter dem Begriff der „neuen“ Alten eher ein „state of mind“ verstanden, der vorrangig die positiven Seiten des Alterns herauszustellen versucht, die heute in modernen Gesellschaften realisierbar sind. Die Bezeichnung „neue“ Alte soll damit lediglich die Möglichkeiten und Chancen aufzeigen (wie z. B. Aktivitäten wahrnehmen, versäumte Freiheiten nachholen, lebenslange Wünsche verwirklichen), die gegenwärtig ältere Menschen haben können (vgl. ebd., S. 11f.).
In dieser Arbeit soll die wachsende Gruppe der neuen, jungen Alten, beleuchtet werden, die ihre Familienarbeit nach Auszug der erwachsenen Kinder abgeschlossen hat und/oder die als ArbeitnehmerInnnen vorzeitig, vielfach schon mit 50 Jahren, aus dem Erwerbsarbeitsleben ausgeschieden sind. Dabei soll aufgezeigt werden, dass diese verjüngten Alten als neue gesellschaftliche Gruppe, die weitgehend noch gesund und auf der Suche nach neuen nachberuflichen Möglichkeiten ist, Fragen bewusster Lebensplanung für weitere 20, 30 Jahre und mehr sehr interessiert gegenübersteht, was mittlerweile auch zunehmend von der Öffentlichkeit und den Medien wahrgenommen und aufgegriffen wird...
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Alter und Altern als Thema der Soziologie
- Demographische Alterung, ihre Ursachen und Prognosen
- Theoretischer Überblick
- Die neuen Alten - ein Produkt des Strukturwandels des Alters
- Auswirkungen der veränderten Altersstruktur und der sich verändernden Alternsbedingungen auf Individuum und Gesellschaft
- Konzepte des gesellschaftlichen Strukturwandels des Alters
- Verjüngung des Alters
- Entberuflichung
- Feminisierung des Alters
- Singularisierung
- Hochaltrigkeit
- Die neuen Alten und ihre empirische Begrenztheit: Weitere Erklärungsansätze
- Verhaltensdiskrepanzen der neuen Alten
- Kritische Betrachtungsweisen zum Strukturwandel-Ansatz
- Das Altersbild einer aktiv gebliebenen Generation in Gesellschaft, Medien und Werbewelt
- Lebensstile, Bedürfnisse, Konsumverhalten
- Produktives Altern
- Nachberufliche Tätigkeiten im Bildungsbereich
- Bildungsangebot Volkshochschule
- Seniorenstudium als wissenschaftliche nachberufliche Aktivität
- Junge Alte und neue Techniken
- Funktion und Bedeutung der nachberuflichen Weiterbildung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die soziologischen Aspekte der „neuen Alten“, einer Gruppe von älteren Menschen, die durch früheres Ausscheiden aus dem Berufsleben und eine längere Lebenserwartung neue Lebensphasen gestalten. Die Arbeit analysiert den Strukturwandel des Alters und beleuchtet die Lebensstile, Bedürfnisse und Aktivitäten dieser Gruppe, insbesondere im Kontext nachberuflicher Tätigkeiten im Bildungsbereich.
- Der Strukturwandel des Alters und die Entstehung der „neuen Alten“
- Lebensstile, Bedürfnisse und Konsumverhalten der „neuen Alten“
- Nachberufliche Tätigkeiten im Bildungsbereich und lebenslanges Lernen
- Das gesellschaftliche Bild vom Alter und dessen Wandel
- Die Bedeutung von Weiterbildung für die „neuen Alten“
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung beschreibt den demografischen Wandel und die wachsende Bedeutung älterer Menschen in der Gesellschaft. Sie hebt hervor, dass das traditionelle Bild vom Alter als negativ besetzt, inaktiv und krank, nicht mehr der Realität entspricht. Die Arbeit konzentriert sich auf die „neuen Alten“, aktive und rüstige Menschen, die ihre Lebensphase nach dem Berufsaustritt aktiv gestalten und das überkommene Bild vom Alter verändern.
Alter und Altern als Thema der Soziologie: Dieses Kapitel beleuchtet die relativ junge Beschäftigung der Soziologie mit dem Thema Alter. Es diskutiert die methodischen Herausforderungen und die wachsende Relevanz des Themas aufgrund des demografischen Wandels und des Strukturwandels des Alters, wie er von Tews beschrieben wird.
Die neuen Alten - ein Produkt des Strukturwandels des Alters: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der veränderten Altersstruktur auf Individuum und Gesellschaft. Es untersucht Tews' Konzept des Strukturwandels des Alters mit seinen fünf Aspekten (Verjüngung, Entberuflichung, Feminisierung, Singularisierung und Hochaltrigkeit) und diskutiert die empirische Begrenztheit dieser Konzepte sowie Verhaltensdiskrepanzen der "neuen Alten".
Kritische Betrachtungsweisen zum Strukturwandel-Ansatz: Dieses Kapitel setzt sich kritisch mit dem Strukturwandel-Ansatz auseinander, bewertet dessen Stärken und Schwächen und beleuchtet möglicherweise bestehende alternative Erklärungsansätze für die Veränderungen im Altersbild und den Lebensweisen älterer Menschen.
Das Altersbild einer aktiv gebliebenen Generation in Gesellschaft, Medien und Werbewelt: Dieses Kapitel untersucht, wie die Gesellschaft, die Medien und die Werbewelt das Bild vom Alter prägen und wie sich dies im Laufe der Zeit verändert hat, insbesondere im Hinblick auf die "neuen Alten". Es analysiert die Darstellung und die Kommunikation um das Alter und die Auswirkungen dieser Darstellungen auf die Lebensgestaltung der Betroffenen.
Lebensstile, Bedürfnisse, Konsumverhalten: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Lebensstile, Bedürfnisse und Konsummuster der „neuen Alten“. Es analysiert, wie sich diese von den Lebensweisen vorhergehender Generationen unterscheiden und welche Faktoren diese Unterschiede beeinflussen. Der Fokus liegt auf den individuellen Bedürfnissen und Entscheidungen innerhalb der Gruppe der "neuen Alten".
Produktives Altern: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung von produktivem Altern für die „neuen Alten“ und deren gesellschaftliche Einbettung. Es untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen des produktiv bleibens im Alter, die Motivationen dahinter und die Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die soziale Integration.
Nachberufliche Tätigkeiten im Bildungsbereich: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die nachberuflichen Aktivitäten der „neuen Alten“ im Bildungsbereich, beispielsweise Volkshochschulen und Seniorenstudium. Es untersucht die Bedeutung dieser Aktivitäten für die Persönlichkeitsentwicklung, das soziale Leben und die gesellschaftliche Teilhabe der älteren Erwachsenen.
Funktion und Bedeutung der nachberuflichen Weiterbildung: Das Kapitel untersucht die Rolle und Bedeutung von Weiterbildung im Kontext des lebenslangen Lernens für die „neuen Alten“. Es analysiert, welche Funktionen Weiterbildung für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung im Alter erfüllt. Der Fokus liegt auf den gesellschaftlichen Auswirkungen und dem individuellen Nutzen solcher Aktivitäten.
Schlüsselwörter
Neue Alte, Strukturwandel des Alters, Verjüngung des Alters, Entberuflichung, Lebenslanges Lernen, Nachberufliche Weiterbildung, Bildung im Alter, Lebensstile im Alter, Konsumverhalten, soziologische Altersforschung, Demographischer Wandel.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: "Die Neuen Alten"
Was ist der Fokus dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die soziologischen Aspekte der „neuen Alten“, einer Gruppe älterer Menschen, die durch früheres Ausscheiden aus dem Berufsleben und längere Lebenserwartung neue Lebensphasen gestalten. Der Fokus liegt auf ihren Lebensstilen, Bedürfnissen, Aktivitäten und insbesondere auf nachberuflichen Tätigkeiten im Bildungsbereich.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit analysiert den Strukturwandel des Alters, beleuchtet die Lebensstile, Bedürfnisse und das Konsumverhalten der „neuen Alten“, untersucht nachberufliche Tätigkeiten im Bildungsbereich (z.B. Volkshochschulen, Seniorenstudium), setzt sich kritisch mit dem Strukturwandel-Ansatz auseinander und beleuchtet das gesellschaftliche Bild vom Alter und dessen Wandel.
Welche Konzepte des Strukturwandels des Alters werden diskutiert?
Die Arbeit behandelt Tews' Konzept des Strukturwandels des Alters mit seinen fünf Aspekten: Verjüngung des Alters, Entberuflichung, Feminisierung des Alters, Singularisierung und Hochaltrigkeit. Es werden sowohl die empirische Begrenztheit dieser Konzepte als auch Verhaltensdiskrepanzen der „neuen Alten“ diskutiert.
Wie wird das gesellschaftliche Bild vom Alter betrachtet?
Die Arbeit analysiert, wie Gesellschaft, Medien und Werbewelt das Bild vom Alter prägen und wie sich dies im Laufe der Zeit verändert hat, insbesondere im Hinblick auf die „neuen Alten“. Die Darstellung und Kommunikation rund um das Thema Alter und deren Auswirkungen auf die Lebensgestaltung der Betroffenen werden untersucht.
Welche Rolle spielt die Weiterbildung für die „neuen Alten“?
Die Bedeutung von Weiterbildung im Kontext des lebenslangen Lernens für die „neuen Alten“ wird untersucht. Die Arbeit analysiert die Funktionen von Weiterbildung für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung im Alter, mit Fokus auf gesellschaftliche Auswirkungen und individuellen Nutzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einführung, Alter und Altern als Thema der Soziologie, Demographische Alterung, Theoretischer Überblick, Die neuen Alten – ein Produkt des Strukturwandels des Alters, Kritische Betrachtungsweisen zum Strukturwandel-Ansatz, Das Altersbild einer aktiv gebliebenen Generation, Lebensstile, Bedürfnisse, Konsumverhalten, Produktives Altern, Nachberufliche Tätigkeiten im Bildungsbereich, Funktion und Bedeutung der nachberuflichen Weiterbildung und Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Neue Alte, Strukturwandel des Alters, Verjüngung des Alters, Entberuflichung, Lebenslanges Lernen, Nachberufliche Weiterbildung, Bildung im Alter, Lebensstile im Alter, Konsumverhalten, soziologische Altersforschung, Demographischer Wandel.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Soziologen, Gerontologen, Personen im Bildungsbereich, sowie alle, die sich für den demografischen Wandel, die Lebensstile älterer Menschen und die Bedeutung von Weiterbildung im Alter interessieren.
- Quote paper
- Ursula Hoffmann-Kramer (Author), 2002, Die verjüngten Alten - Entstehung, Bedürfnisse, Aktivitäten einer neuen Gesellschaftsgruppe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42278