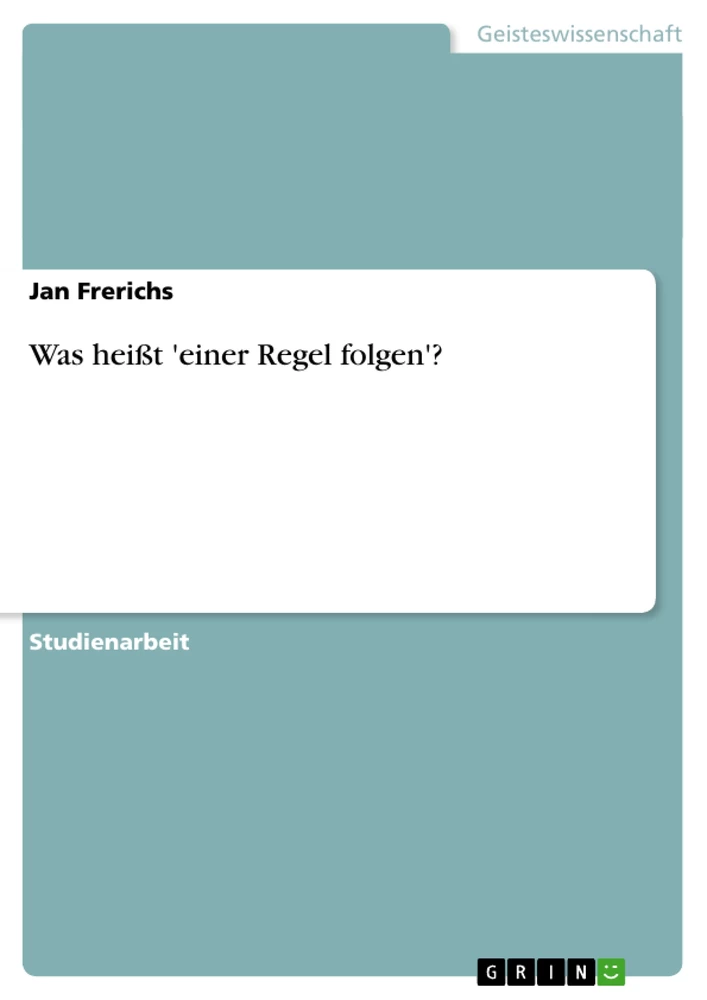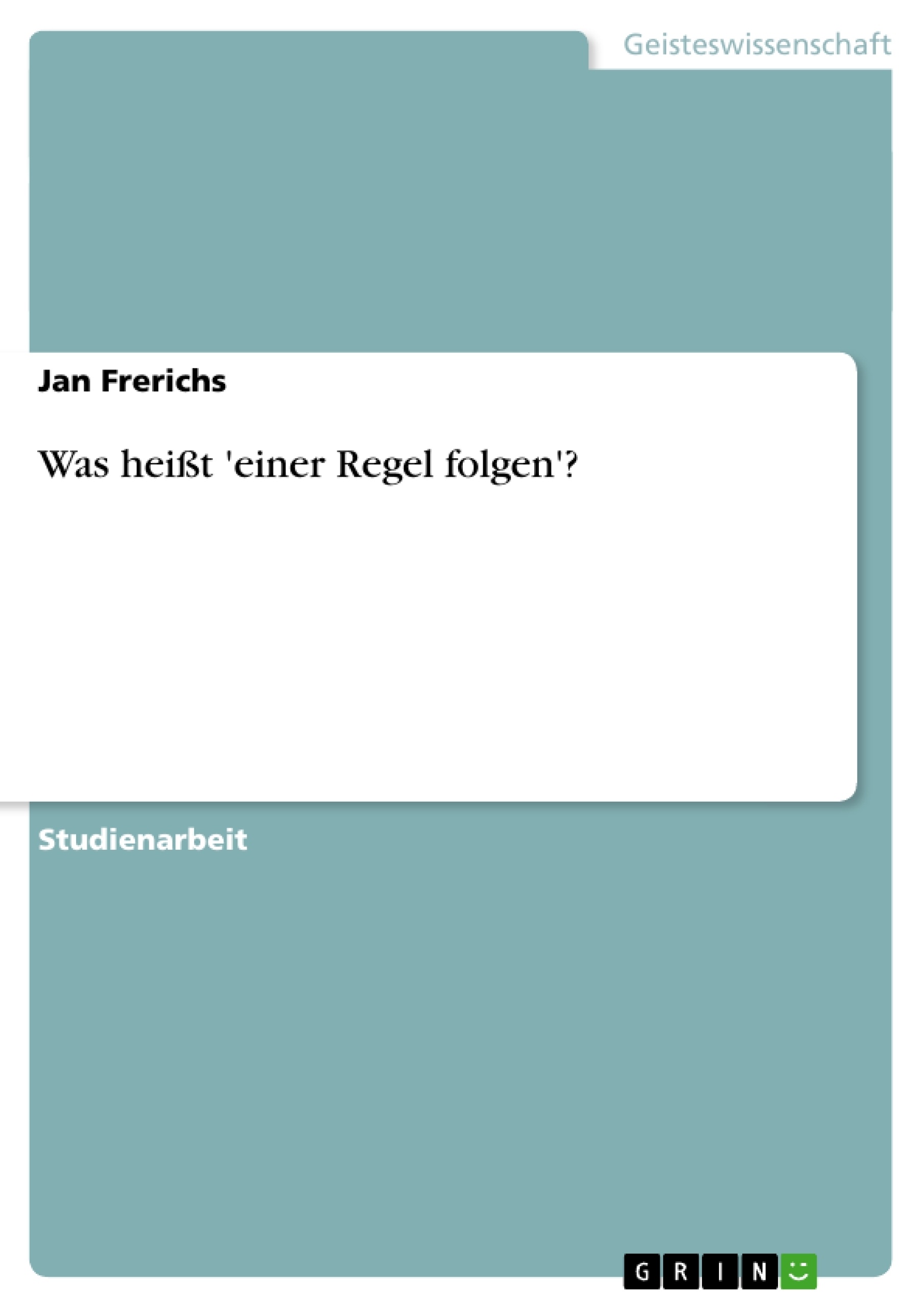Einleitung
„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache“(PU 43). Auf diesem Axiom gründet bei Wittgenstein der Begriff des „Sprachspiels“. Je nachdem in welchem Sprachspiel ein Wort verwendet wird, hat es entsprechend Bedeutung: PU 23: „Es gibt unzählige ... verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir ‘Zeichen’, ‘Worte’, ‘Sätze’ nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für allemal Gegebenes; sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen. ... Das Wort ‘Sprachspiel’ soll hier hervorheben, daß das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform.“ Unser Denken, Sprechen und Handeln verläuft innerhalb dieser Sprachspiele und daher auch nicht willkürlich (oder privat), sondern nach bestimmten Regeln. Dieser Gedanke hat zunächst einen geheimnisvollen Charakter, denn woher, fragen wir uns, kommen die Regeln, denen wir folgen: Wer stellt sie auf? Können wir wissen, welcher Regel wir gerade folgen? Können wir beurteilen, welcher Regel ein anderer Mensch gerade folgt? Welche Kriterien haben wir für das Befolgen oder Nicht-Befolgen einer Regel und inwiefern bestimmen die Regeln, die wir in Ausdrücken „sichtbar“ machen können, unser Handeln? Was geschieht also mit oder in uns, wenn wir Regeln folgen? Was heißt einer Regel folgen und inwiefern heißt es immer wieder „das gleiche“ tun?
Diesen Fragen geht Wittgenstein ausgehend vom Sprachspiel-Begriff in den Philosophischen Untersuchungen nach. Er wählt für seine Überlegungen meist mathematische Beispiele. Für die Regeln, die in mathematischen Beispielen gelten, lassen sich leicht Ausdrücke finden. Gerade daran will er aber zeigen, daß „die richtige Antwort auf diese Art Problem (Für einen neuen Fall „das gleiche“ tun, was man schon für die früheren Fälle getan hat) im Fall der Anwendung strenger und expliziter mathematischer Regeln auf eine Weise festgelegt wird, die sich nicht grundlegend von dem Fall unterscheidet, in dem sehr viel weniger strenge und im allgemeinen überhaupt nicht explizite Regeln angewendet werden, wie sie den Wortgebrauch der Alltagssprache bestimmen“. Die mathematischen Regeln scheinen die korrekte Anwendung per se schon präzise vorherzubestimmen, die Regeln des alltäglichen Sprachgebrauchs, legen scheinbar nur teilweise fest, was der korrekte Gebrauch ist...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Eine Regel lernen und ein System verstehen
- 2.1 Wie lernt jemand ein System?
- 2.2 Was „Verstehen“ ist
- 2.3 Zur Grammatik von „können“
- 2.4 Entzauberung des Wortes „meinen“
- 2.5 Verstehen auf dem Hintergrund etablierter Verwendung eines Ausdrucks
- 3. Was heißt einer Regel folgen?
- 3.1 Regeln sind intersubjektiv geteilte Gepflogenheiten
- 3.2 Regelfolgen ist eine Praxis
- 4. Am Schluß: Regelfolgen ohne letzte Gewißheit?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Wittgensteins Konzept des Regelfolgens im Kontext seiner Sprachspiel-Theorie. Sie analysiert, wie das Lernen und Verstehen von Regeln funktioniert und welche Rolle die intersubjektive Natur von Regeln spielt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage nach der Gewissheit im Regelfolgen.
- Wittgensteins Sprachspiel-Begriff
- Das Lernen von Regeln und Systemen
- Die Natur des Verstehens
- Intersubjektivität von Regeln
- Gewissheit und Regelfolgen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Frage der Arbeit ein: Was heißt es, einer Regel zu folgen? Sie basiert auf Wittgensteins Axiom, dass die Bedeutung eines Wortes in seinem Gebrauch liegt und präsentiert die Problematik des Regelfolgens anhand der Frage nach der Herkunft von Regeln, dem Wissen über das Befolgen einer Regel und den Kriterien für die Beurteilung korrekten Handelns. Mathematische Beispiele werden als Ausgangspunkt für die Untersuchung gewählt, um die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den alltäglichen Sprachgebrauch zu belegen.
2. Eine Regel lernen und ein System verstehen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Lernprozess von Regeln und Systemen. Am Beispiel des Erlernens der natürlichen Zahlenreihe wird gezeigt, wie das Verständnis eines Systems entsteht. Wittgenstein unterscheidet dabei zwischen regellosen und systematischen Fehlern, betont aber die fließende Grenze zwischen beiden. Das Verständnis eines Systems wird nicht als innerer seelischer Prozess dargestellt, sondern als ein Zustand, der aus der richtigen Anwendung resultiert, basierend auf anerkannten Vorgaben und der Beherrschung von Grundregeln. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der anerkannten Vorgabe und der etablierten Verwendung als Grundlage für das Verstehen.
3. Was heißt einer Regel folgen?: Dieses Kapitel untersucht die intersubjektive Natur von Regeln und die Praxis des Regelfolgens. Regeln werden als intersubjektiv geteilte Gepflogenheiten verstanden. Der Akt des Regelfolgens wird als Praxis beschrieben, welche von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst ist und nicht durch eine einzige, eindeutige Definition festgelegt wird. Die Untersuchung befasst sich mit der Problematik, dass die Anwendung von Regeln immer einen interpretationellen Aspekt beinhaltet, der die absolute Gewissheit in Frage stellt.
Schlüsselwörter
Wittgenstein, Sprachspiel, Regelfolgen, Verstehen, Intersubjektivität, Regel, Praxis, Gewissheit, mathematische Beispiele, alltäglicher Sprachgebrauch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wittgensteins Konzept des Regelfolgens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Wittgensteins Konzept des Regelfolgens im Kontext seiner Sprachspiel-Theorie. Sie analysiert, wie das Lernen und Verstehen von Regeln funktioniert und welche Rolle die intersubjektive Natur von Regeln spielt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage nach der Gewissheit im Regelfolgen.
Welche Themen werden behandelt?
Die zentralen Themen sind Wittgensteins Sprachspiel-Begriff, das Lernen von Regeln und Systemen, die Natur des Verstehens, die Intersubjektivität von Regeln und die Gewissheit im Regelfolgen. Die Arbeit verwendet mathematische Beispiele, um die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf den alltäglichen Sprachgebrauch zu belegen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und einen Schluss. Die Einleitung führt in die Problematik des Regelfolgens ein. Kapitel 2 befasst sich mit dem Lernen von Regeln und dem Verstehen von Systemen. Kapitel 3 untersucht die intersubjektive Natur von Regeln und die Praxis des Regelfolgens. Der Schluss diskutiert das Regelfolgen ohne letzte Gewissheit.
Was wird in Kapitel 2 ("Eine Regel lernen und ein System verstehen") behandelt?
Dieses Kapitel analysiert den Lernprozess von Regeln und Systemen am Beispiel der natürlichen Zahlenreihe. Es wird der Unterschied zwischen regellosen und systematischen Fehlern erläutert und die Bedeutung der anerkannten Vorgabe und etablierten Verwendung für das Verstehen hervorgehoben. Das Verständnis wird nicht als innerer Prozess, sondern als Ergebnis der richtigen Anwendung von Regeln dargestellt.
Was ist der Fokus von Kapitel 3 ("Was heißt einer Regel folgen?")?
Kapitel 3 konzentriert sich auf die intersubjektive Natur von Regeln und die Praxis des Regelfolgens. Regeln werden als intersubjektiv geteilte Gepflogenheiten verstanden, und der Akt des Regelfolgens als eine Praxis, die von vielen Faktoren beeinflusst wird und keinen eindeutigen Definitionen unterliegt. Die interpretative Natur der Regelanwendung und die damit verbundene Problematik der absoluten Gewissheit werden diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis der Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Wittgenstein, Sprachspiel, Regelfolgen, Verstehen, Intersubjektivität, Regel, Praxis, Gewissheit, mathematische Beispiele und alltäglicher Sprachgebrauch.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Regelfolgen ohne letzte Gewissheit möglich ist. Die genauen Schlussfolgerungen lassen sich aus der gegebenen Zusammenfassung nicht vollständig erschließen, aber die Diskussion um Interpretation und die intersubjektive Natur von Regeln deutet auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Idee absoluter Gewissheit im Regelfolgen hin.
- Citation du texte
- Jan Frerichs (Auteur), 1998, Was heißt 'einer Regel folgen'?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42202