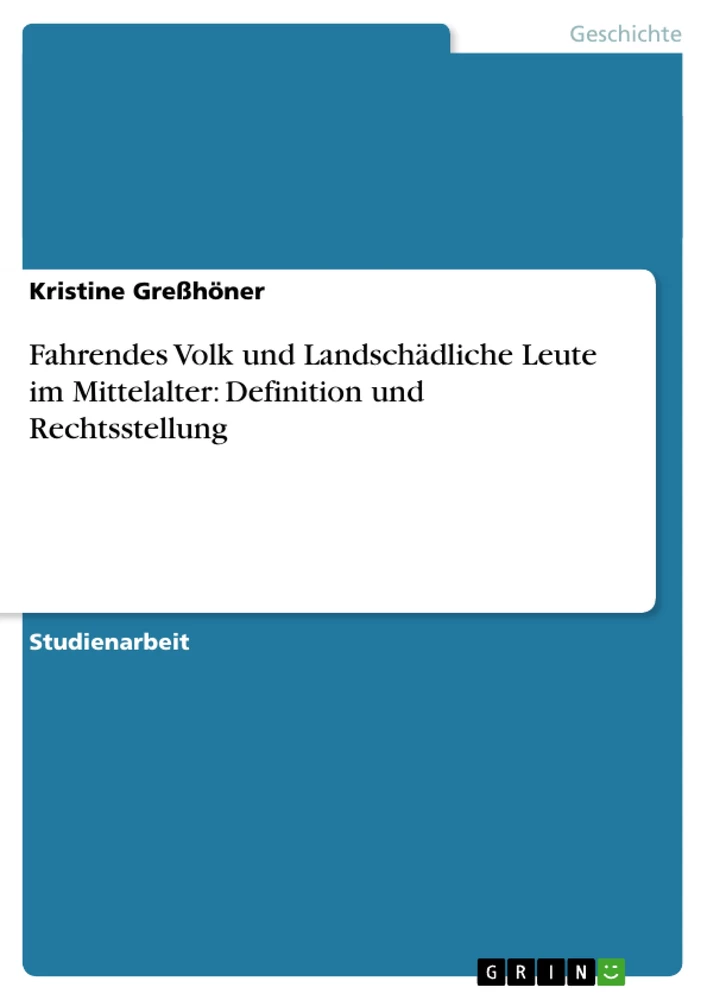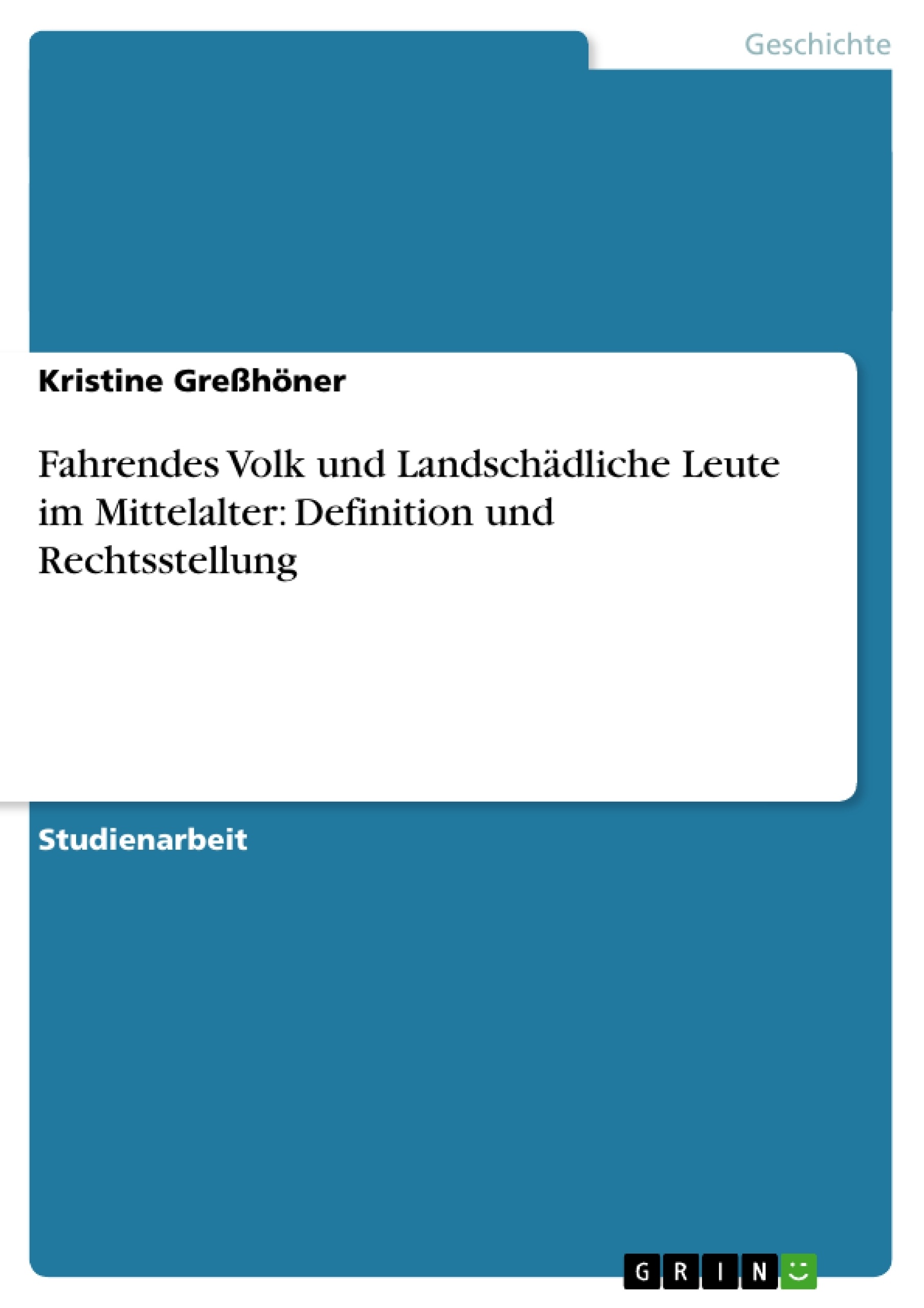# Die Begriffe des (land-)schädlichen und des fahrenden Volkes sind nicht deckungsgleich. Während erstere eine juristisch/personell umrissene Gruppe darstellen, bilden letztere eine soziologisch definierte Gruppe, die in sich heterogen ist. Ob die einen nun mit den anderen deckungsgleich waren, nicht oder nur zum Teil, ist für ihre rechtliche Stellung nebensächlich. Anhand dieser Personengruppen wird deren soziale und juristische Stellung im Mittelalter aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Die Debatte um die landschädlichen oder auch schädlichen Leute – Bezüge zum fahrenden Volk ja oder nein?
- Literaturlage
- Die soziale Perspektive
- Wer oder was ist das fahrende Volk im Mittelalter?
- Ist der Fahrende ein Außenseiter, wie in vielen Publikationen erklärt?
- Die juristische Perspektive
- Wie ist die Freiheit der Fahrenden zu bewerten?
- Wie spielt sie in das geltende Recht hinein?
- Wer sind die so genannten landschädlichen Leute und was ist ihr juristischer Status?
- Auf welcher Basis fand dieser Wandel im Rechtssystem statt, der sich auf die landschädlichen Leute zuzuspitzen schien?
- Rügegericht / Rügeverfahren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die historische Debatte um die „landschädlichen Leute“ im Mittelalter und deren mögliche Verbindung zum fahrenden Volk. Ziel ist es, die soziale und juristische Perspektive auf diese Gruppen zu beleuchten und die Entwicklung der rechtlichen Behandlung dieser Bevölkerungsgruppen zu analysieren.
- Soziale Stellung des fahrenden Volkes im Mittelalter
- Juristische Definition und Behandlung der „landschädlichen Leute“
- Der Wandel des Rechtssystems im Bezug auf „landschädliche Leute“
- Das Verhältnis zwischen fahrendem Volk und „landschädlichen Leuten“
- Die Rolle von Vorurteilen und Klischees in der historischen Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Debatte um die landschädlichen oder auch schädlichen Leute – Bezüge zum fahrenden Volk ja oder nein?: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Schwierigkeiten, das fahrende Volk des Mittelalters eindeutig zu definieren. Es wird auf die unterschiedlichen Quellen verwiesen, die von Herolden und Musikanten bis hin zu Handwerkern eine breite Palette von Berufsgruppen umfassen. Die Bezeichnung "landschädlich" wird als eine Kategorisierung vorgestellt, die Personen als eine Gefahr für die mittelalterliche Gesellschaft kennzeichnet, wobei die Gemeinsamkeit des fehlenden festen Wohnsitzes hervorgehoben wird. Die Heterogenität beider Gruppen wird betont, und es wird auf die bestehende Forschungsdebatte hingewiesen, die sich mit der juristischen Stellung der "landschädlichen Leute" auseinandersetzt.
Die soziale Perspektive: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des fahrenden Volkes im Mittelalter und der Frage, ob diese Gruppe als Randständige oder Außenseiter zu betrachten ist. Es wird kritisch hinterfragt, ob die gängige Darstellung als "unehrliche Personen" gerechtfertigt ist, und es wird die These aufgestellt, dass eine pauschale Verurteilung zu voreilig ist. Es wird ein differenzierteres Bild des fahrenden Volkes gezeichnet, das von "varnde liute" (fahrende Leute) bis zu "gernde liute" (fahrende Leute, die ihre Kunstfertigkeiten hervorheben) reicht und so einen fließenden Übergang von Gast zu Schmarotzer offenbart. Kleidung und äußeres Erscheinungsbild spielten dabei eine wesentliche Rolle. Trotz negativer Vorurteile wird die gesellschaftliche Nützlichkeit des fahrenden Volkes hervorgehoben, das für Unterhaltung sorgte, als Nachrichtenübermittler diente und Handwerksdienste anbot.
Die juristische Perspektive: Dieses Kapitel untersucht die Freiheit der Fahrenden im mittelalterlichen Kontext und deren Stellung im geltenden Recht. Die „Freiheit“ wird als Privileg oder Vorrecht verstanden, im Gegensatz zur tatsächlichen Rechtlosigkeit vieler Fahrender. Es wird auf das Paradoxon eingegangen, dass die Freiheit der Fahrenden gleichzeitig eine Gefährdung ihrer Sicherheit bedeutete, da sie vogelfrei waren. Das Kapitel beleuchtet die widersprüchliche rechtliche Behandlung der Fahrenden, die teils als rechtlos galten und ungestraft gescholten oder geschlagen werden konnten, andererseits aber einen gewissen, wenn auch eingeschränkten, Rechtsschutz genossen. Das Beispiel der Scheinbußen veranschaulicht den komplizierten Umgang mit rechtlichen Konflikten, die Spielleute betrafen, wobei diese nicht den "landschädlichen Leuten" gleichgestellt wurden.
Wer sind die so genannten landschädlichen Leute und was ist ihr juristischer Status?: Dieses Kapitel klärt den Begriff der "landschädlichen Leute", der seit dem 13. Jahrhundert in verschiedenen Rechtsquellen auftaucht. Es wird erläutert, dass dieser Begriff sowohl Straftäter mit todeswürdigen Verbrechen als auch unstet umherziehendes Volk umfasste, das als Gefahr für die öffentliche Ordnung galt. Der rechtliche Status dieser Personen ist besonders insofern relevant, da sie ohne den Nachweis eines konkreten Verbrechens strafrechtlich belangt werden konnten, was einem modernen Verständnis von gemeingefährlichen Berufsverbrechern entspricht.
Schlüsselwörter
Fahrendes Volk, landschädliche Leute, Mittelalter, Rechtssystem, soziale Randgruppen, juristische Stellung, Rechtsschutz, Vorurteile, Geschichtswissenschaft, Friedensordnungen, Stadtrechte, Scheinbuße, varnde liute, gernde liute.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Die Debatte um die landschädlichen oder auch schädlichen Leute – Bezüge zum fahrenden Volk ja oder nein?"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die historische Debatte um die "landschädlichen Leute" im Mittelalter und deren mögliche Verbindung zum fahrenden Volk. Sie beleuchtet die soziale und juristische Perspektive auf diese Gruppen und analysiert die Entwicklung ihrer rechtlichen Behandlung.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit eingenommen?
Die Arbeit betrachtet die Thematik aus einer sozialen und juristischen Perspektive. Die soziale Perspektive untersucht die Stellung des fahrenden Volkes in der mittelalterlichen Gesellschaft, während die juristische Perspektive sich mit der rechtlichen Definition und Behandlung der "landschädlichen Leute" auseinandersetzt.
Wer oder was ist das fahrende Volk im Mittelalter?
Die Arbeit definiert das fahrende Volk des Mittelalters als eine heterogene Gruppe, die von Herolden und Musikanten bis hin zu Handwerkern reichte. Sie hinterfragt die gängige Darstellung als "unehrliche Personen" und plädiert für ein differenzierteres Bild, das die soziale Nützlichkeit dieser Gruppe berücksichtigt.
Was bedeutet der Begriff "landschädliche Leute"?
Der Begriff "landschädliche Leute", der seit dem 13. Jahrhundert belegt ist, umfasste sowohl Straftäter mit todeswürdigen Verbrechen als auch unstet umherziehendes Volk, das als Gefahr für die öffentliche Ordnung galt. Sie konnten ohne Nachweis eines konkreten Verbrechens strafrechtlich belangt werden.
Wie war die juristische Stellung des fahrenden Volkes und der "landschädlichen Leute"?
Die juristische Stellung beider Gruppen war ambivalent. Während sie teils rechtlos galten und ungestraft gescholten oder geschlagen werden konnten, genossen sie andererseits einen gewissen, wenn auch eingeschränkten, Rechtsschutz. Die Arbeit beleuchtet die Widersprüche und Paradoxien dieser rechtlichen Behandlung.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem fahrenden Volk und den "landschädlichen Leuten"?
Die Arbeit untersucht die mögliche Verbindung zwischen dem fahrenden Volk und den "landschädlichen Leuten", betont aber die Heterogenität beider Gruppen und die Schwierigkeit, eine eindeutige Verbindung herzustellen. Der fehlende feste Wohnsitz wird als Gemeinsamkeit hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Vorurteile und Klischees in der historischen Forschung?
Die Arbeit kritisiert die Rolle von Vorurteilen und Klischees in der bisherigen Forschung und plädiert für eine differenziertere Betrachtung der sozialen und juristischen Realität des fahrenden Volkes und der "landschädlichen Leute" im Mittelalter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Debatte um "landschädliche Leute" und deren Bezug zum fahrenden Volk, zur sozialen und juristischen Perspektive auf diese Gruppen, zur Definition und dem juristischen Status der "landschädlichen Leute", sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fahrendes Volk, landschädliche Leute, Mittelalter, Rechtssystem, soziale Randgruppen, juristische Stellung, Rechtsschutz, Vorurteile, Geschichtswissenschaft, Friedensordnungen, Stadtrechte, Scheinbuße, varnde liute, gernde liute.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein differenziertes Bild des fahrenden Volkes und der "landschädlichen Leute" im Mittelalter zu zeichnen und die Entwicklung ihrer rechtlichen Behandlung zu analysieren. Sie will bestehende Vorurteile und Klischees kritisch hinterfragen.
- Quote paper
- Kristine Greßhöner (Author), 2005, Fahrendes Volk und Landschädliche Leute im Mittelalter: Definition und Rechtsstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42168