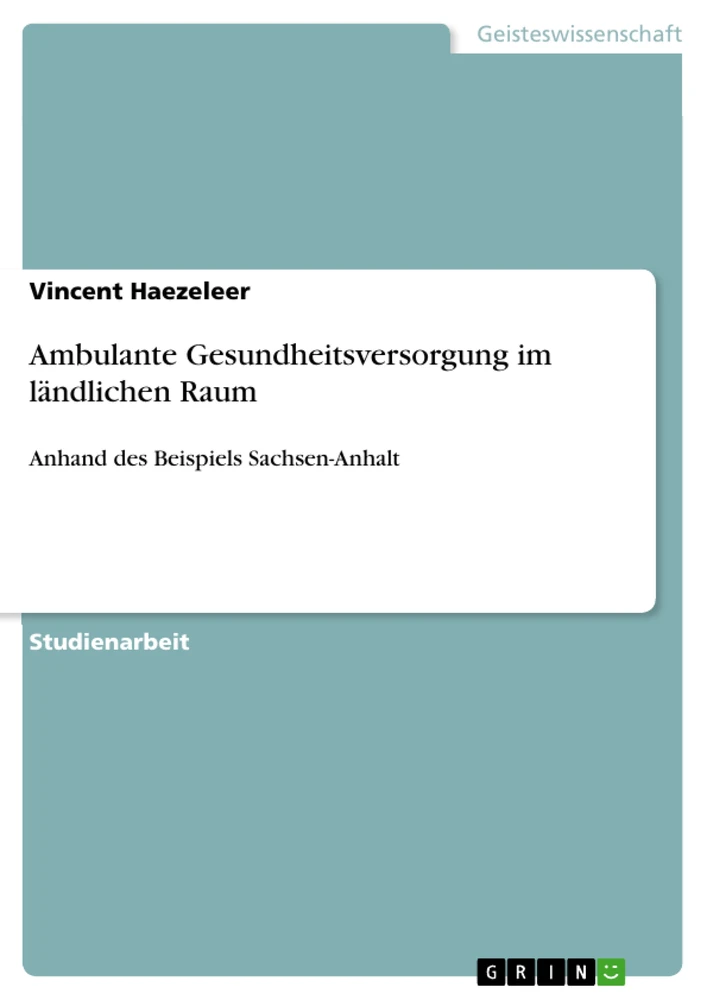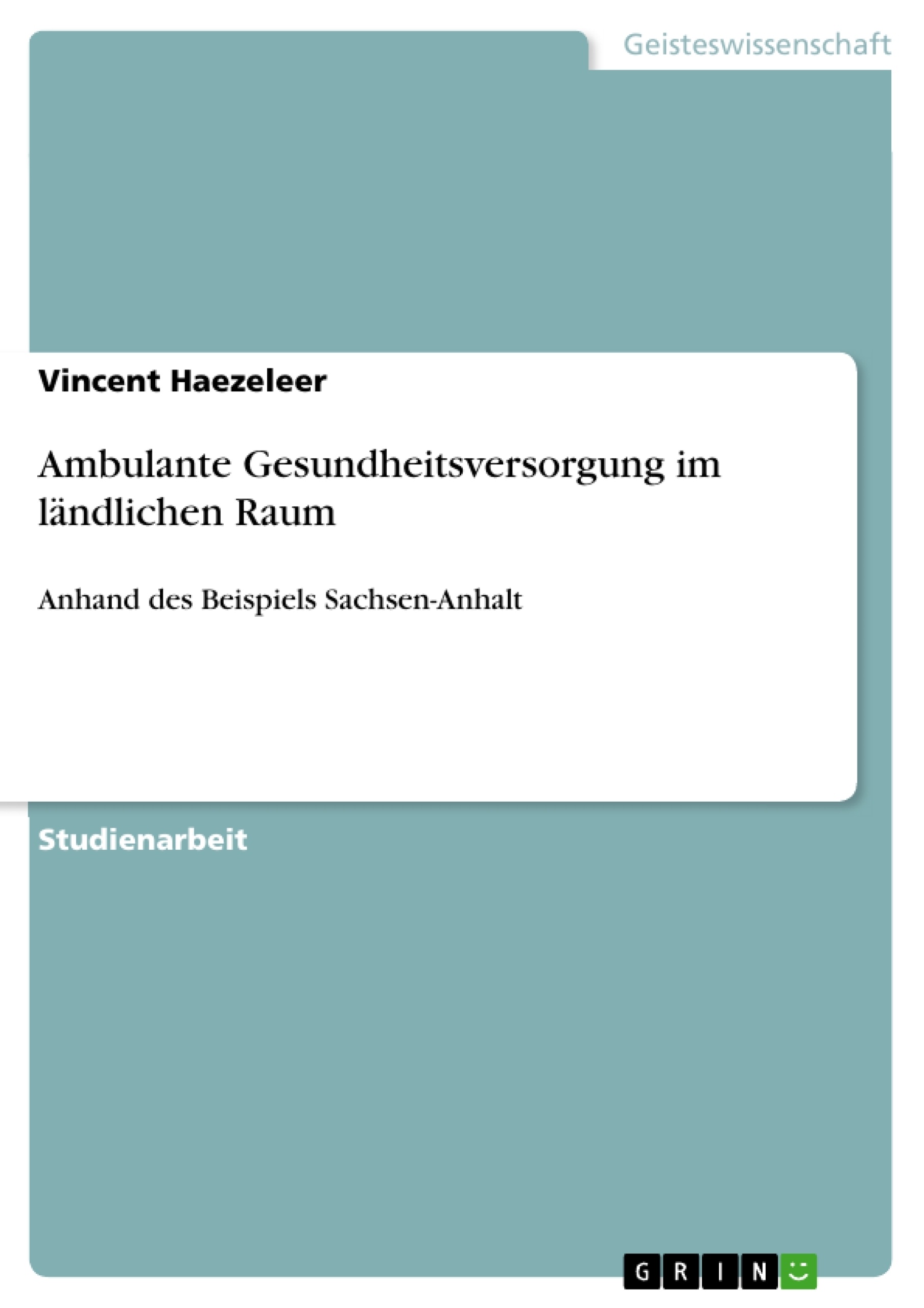Im internationalen Vergleich mit anderen Ländern steht den deutschen Staatsbürgern hinsichtlich der gesundheitlichen Versorgung aller Sektoren ein überdurchschnittliches Niveau zur Verfügung. Das Angebot an ambulanter vertragsärztlicher Versorgung wird jährlich von fast 90% der Erwachsenen in Deutschland in Anspruch genommen. Das ist kaum verwunderlich, da niedergelassene Ärzte/innen die erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Problemen darstellen. Daher erscheint es ebenso gerechtfertigt, dass im Jahre 2013 mit 155,5 Milliarden Euro, fast sechs Prozent des gesamten Bruttoinlandsproduktes, für ambulante Versorgungsleistungen ausgegeben wurden. Die Anzahl der ambulant tätigen Ärzte deutschlandweit ist von 1990 bis 2015 um nahezu 63% auf eine Zahl von 150.106 gestiegen. Ebenfalls zu begrüßen ist die kleiner werdende Einwohner-pro-Arzt-Relation. Diese sank von 335 um 53% auf 219 im selben Zeitraum. Seit dem Jahre 2000 sind gleichzeitig sehr große personelle Zuwächse in den pflegerischen und heilpraktischen Berufen sowie in der Physiotherapie zu verzeichnen. Auch in vielen anderen Gesundheitsberufen der ambulanten Versorgung ist seit der Jahrtausendwende eine positive Entwicklung zu beobachten. Alle ambulanten Berufungen zusammengezählt, stieg die Anzahl von ~4 Millionen innerhalb von 14 Jahren auf ~5,2 Millionen an. Die Ausführungen in den folgenden Kapiteln zeigen mithilfe des Beispiels Sachsen-Anhalt auf, warum der ambulante Versorgungssektor trotz dieser auf den ersten Blick guten Entwicklung vor immer mehr Probleme gestellt wird und wie diese angegangen werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Allgemein
- 1.1.1 Entwicklung/Situation
- 1.1.2 Problemstellungen
- 1.2 Akteure
- 1.2.1 Vertragsärzte
- 1.2.2 Andere Gesundheitsberufe
- 1.2.3 Gestaltungs- und Organisationsorgane
- 1.3 Bedarfsplanung
- 1.3.1 Grundlage und Funktion
- 1.3.2 Grundstrukturierung
- 1.3.3 Über-, Unter- und Regelversorgung
- 1.3.4 Instrumente zur Steuerung
- 2 Ländliche Region: Sachsen-Anhalt
- 2.1 Ambulante vertragsärztliche Versorgung
- 2.1.1 Allgemein
- 2.1.2 Hausärztliche Versorgung
- 2.1.3 Allgemeine fachärztliche Versorgung
- 2.1.4 Spezialisierte fachärztliche Versorgung
- 2.1.5 Gesonderte fachärztliche Versorgung
- 2.2 Problemstellungen bzw. Herausforderungen
- 2.2.1 Ärzteverteilung
- 2.2.2 Fachausrichtung
- 2.2.3 Altersentwicklung
- 2.2.4 Versorgungsbedarf
- 3 Problemlösungen und Ansätze
- 3.1 Politische Interventionen
- 3.1.1 Bedarfsplanung
- 3.1.2 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)
- 3.1.3 GKV-Modernisierungsgesetz (GMG)
- 3.1.4 Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VändG)
- 3.1.5 GKV-Organisationsstrukturgesetz (GKV-OrgWG)
- 3.1.6 Bedarfsplanungsrichtlinie §34a
- 3.1.7 GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VStG)
- 3.2 Ausgewählte Handlungsmöglichkeiten
- 3.2.1 Mobile Praxisassistentin
- 3.2.2 Attraktivität der Niederlassungsorte erhöhen
- 3.2.3 Notdienste
- 3.2.4 Kommunale Eigeneinrichtungen
- 3.2.5 Erreichbarkeit (öffentliche Verkehrsmittel)
- 3.2.6 Telemedizin
- 3.2.7 Zulassungsvoraussetzungen für Medizin ändern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der ambulanten Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, anhand des Beispiels Sachsen-Anhalt. Sie analysiert die Entwicklungen und Herausforderungen der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen, insbesondere im Kontext des demografischen Wandels und der veränderten Krankheitsbilder. Ziel ist es, die Problematiken der Ärzteverteilung, der Facharztausrichtung und des steigenden Versorgungsbedarfs zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze zu diskutieren.
- Entwicklung und aktuelle Situation der ambulanten Versorgung
- Herausforderungen durch den demografischen Wandel und die Veränderung von Krankheitsbildern
- Problemstellungen der Ärzteverteilung und Fachausrichtung in ländlichen Regionen
- Politische Interventionen und Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der ambulanten Versorgung
- Potenzial und Grenzen von Telemedizin und anderen innovativen Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung - Das Kapitel bietet einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung und die aktuelle Situation der ambulanten Gesundheitsversorgung in Deutschland. Es beleuchtet die Bedeutung des ambulanten Sektors und die positive Entwicklung der Arztzahlen und der Einwohner-pro-Arzt-Relation. Zugleich werden die Herausforderungen durch den demografischen Wandel, die Verschiebung von Krankheitsbildern und die unterschiedliche Verteilung von Ärzten zwischen Stadt und Land hervorgehoben.
- Kapitel 2: Ländliche Region: Sachsen-Anhalt - Dieses Kapitel fokussiert auf die spezifische Situation in Sachsen-Anhalt. Es untersucht die ambulante vertragsärztliche Versorgung, die Problemstellungen der Ärzteverteilung, der Fachausrichtung und der Altersentwicklung. Es werden auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem steigenden Versorgungsbedarf in ländlichen Gebieten beleuchtet.
- Kapitel 3: Problemlösungen und Ansätze - Das Kapitel beschäftigt sich mit politischen Interventionen und Handlungsmöglichkeiten, um die ambulante Versorgung in ländlichen Regionen zu verbessern. Es werden verschiedene Ansätze wie die Bedarfsplanung, das Gesundheitsstrukturgesetz und die Telemedizin diskutiert. Des Weiteren werden auch Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Niederlassungsorten und zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Versorgung für Patienten behandelt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: ambulante Gesundheitsversorgung, ländlicher Raum, Sachsen-Anhalt, Ärzteverteilung, Fachausrichtung, demografischer Wandel, Versorgungsbedarf, politische Interventionen, Telemedizin, Bedarfsplanung, Gesundheitsstrukturgesetz, Attraktivitätssteigerung.
- Citar trabajo
- Vincent Haezeleer (Autor), 2017, Ambulante Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/421027