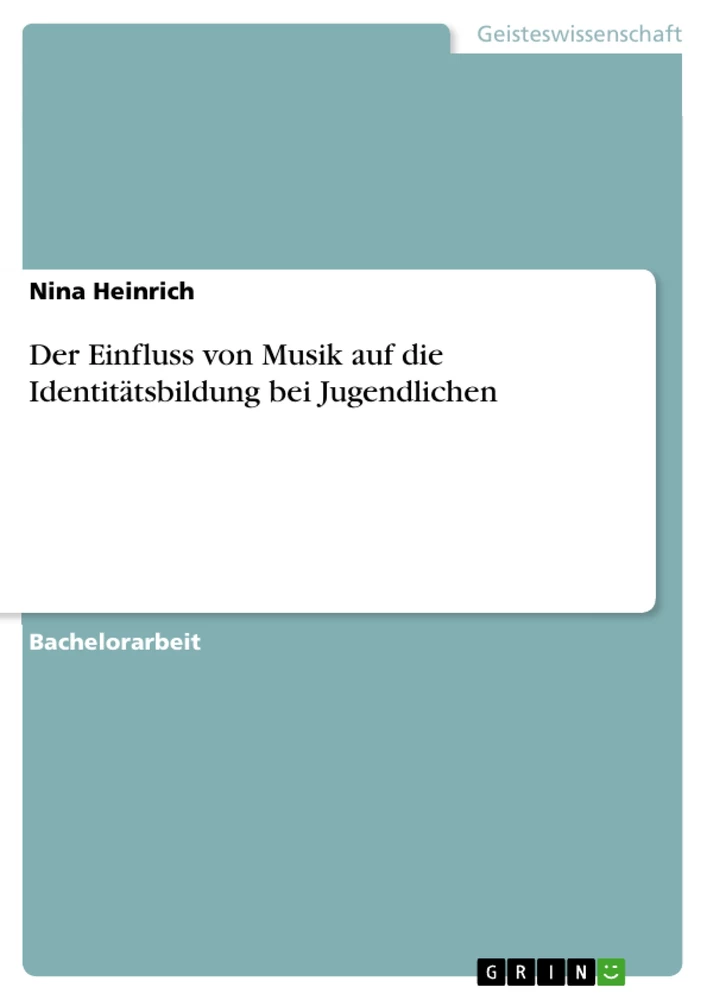Musik wird als Teil von Sozialisation und im konkreten Fall dieser Arbeit als Teil der jugendlichen Entwicklung ausführlich thematisiert. Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass Musik im Jugendalter nicht nur bloßer Hörgenuss und Mittel zur Unterhaltung und des Zeitvertreibs ist, sondern als Ressource zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und somit bei der Identitätsbildung verwendet wird. Besonders komplex ist dieser Themenzusammenhang aufgrund der drei zu berücksichtigenden großen Konstrukte: der Identität, der Jugend und der Musik. Um diese zusammenzubringen, wird ein theoretischer Ansatz gewählt, der die jugendliche Entwicklung, mit Schwerpunkt auf der Identitätsfindung, in einen gesellschaftlichen Kontext setzt. Um die Entwicklung des Jugendlichen zu verstehen, muss somit ein Verständnis der gesellschaftlichen Strukturen geschaffen werden, wobei Musik in das Verhältnis von Mensch und Gesellschaft integriert wird und als soziales Austauschmedium eine vermittelnde Funktion einnimmt. Musik wird somit in einem Interpendenzverhältnis zu Gesellschaft, Identität und Jugend betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Begriffserläuterung Identität
- 1.2 Musik im Kontext sozialgeschichtlicher Ereignisse
- 2 Jugend in der heutigen Gesellschaft
- 2.1 Definition Jugend nach Hurrelmann
- 2.2 Entwicklungsaufgaben nach Havighurst und Hurrelmann
- 2.3 Entwicklungsmodell nach Erikson
- 2.4 Entwicklung bei Keupp
- 3 Sozialisationstheorien
- 3.1 Strukturfunktionalistische Theorie Parson
- 3.2 Sozialbehaviorismus nach Mead
- 3.2.1 Identitätskonstruktionen nach Mead
- 3.3 Selbstsozialisation
- 3.4 Hurrelmanns Modell der produktiven Realitätsverarbeitung
- 3.5 Integration der Identitätsmodelle als Zwischenfazit
- 4 Geschmack im Kontext der Gesellschaft
- 4.1 Bourdieus Habitustheorie
- 4.1.1 Kulturkapital als Mittel zur Distinktion
- 4.2 Drei Dimensionen des Geschmacks
- 4.1 Bourdieus Habitustheorie
- 5 Geschmack im Kontext von Gruppenkonstellationen
- 5.1 Tafjel und Turner: Soziale Identitätstheorie
- 5.2 Brewer & Picket Angleichung und Abgrenzung
- 6 Musikalische (Selbst-) Sozialisation
- 6.1 Parsons Strukturfunktionalismus und Musik
- 6.2 (Musikalischer) Geschmack als Interaktion bei Mead
- 6.3 Medien als Instrumente der Interaktion
- 6.4 Musik als Mittel zur sozialen Verortung nach Bourdieu
- 6.5 Musikalische Selbstsozialisation nach Müller
- 7 Wirkung und Funktion von Musik
- 7.1 Rainer Dollases Schema des musikalischen Interesses
- 7.2 Mood Management Theorie
- 7.3 Riggenbachs Funktionen von Musik
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Musik auf die Identitätsbildung bei Jugendlichen. Sie setzt sich zum Ziel aufzuzeigen, dass Musik im Jugendalter nicht nur bloßer Hörgenuss und Mittel zur Unterhaltung ist, sondern als Ressource zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und somit bei der Identitätsbildung verwendet wird.
- Identitätsbildung im Jugendalter
- Musik als Mittel zur sozialen Verortung
- Musik als Ressource zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben
- Sozialisationstheorien und deren Einfluss auf die Identitätsbildung
- Die Rolle von Geschmack und Musik in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Begriff der Identität erläutert und den Einfluss von Musik im Kontext sozialgeschichtlicher Ereignisse aufzeigt. Anschließend wird die Rolle der Jugend in der heutigen Gesellschaft behandelt, wobei die Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen nach Havighurst und Hurrelmann sowie die Identitätsentwicklung nach Erikson und Keupp im Fokus stehen.
Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Sozialisationstheorien, die die Identitätsbildung des Menschen in den Mittelpunkt stellen, darunter der Strukturfunktionalismus von Parson, die Meadsche Theorie und die Selbstsozialisationstheorie. Außerdem wird Hurrelmanns Modell der produktiven Realitätsverarbeitung vorgestellt.
Kapitel 4 und 5 befassen sich mit dem Thema Geschmack im Kontext von Gesellschaft und Gruppenkonstellationen. Bourdieus Habitustheorie, die den Geschmack eines Menschen als sozial determiniert beschreibt, wird ebenso behandelt wie die soziale Identitätstheorie von Tajfel und Turner sowie die optimale Distinktionstheorie von Brewer & Picket.
Kapitel 6 thematisiert die musikalische (Selbst-)Sozialisation, wobei der Strukturfunktionalismus von Parson, die Interaktionstheorie von Mead und Bourdieus Theorie der sozialen Verortung berücksichtigt werden. Außerdem wird die musikalische Selbstsozialisation nach Müller beleuchtet.
Kapitel 7 schließlich widmet sich der Wirkung und Funktion von Musik. Es werden Rainer Dollases Schema des musikalischen Interesses, die Mood Management Theorie und Riggenbachs Funktionen von Musik behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Identitätsbildung, der Jugend, der Musik und der Sozialisation. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Identitätsentwicklung, Entwicklungsaufgaben, Sozialisationstheorien, Musik als Ressource, Musik als Mittel zur sozialen Verortung, Geschmack, Gruppenkonstellationen, Bourdieu, Mead, Parsons, Hurrelmann.
- Quote paper
- Nina Heinrich (Author), 2011, Der Einfluss von Musik auf die Identitätsbildung bei Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/420660