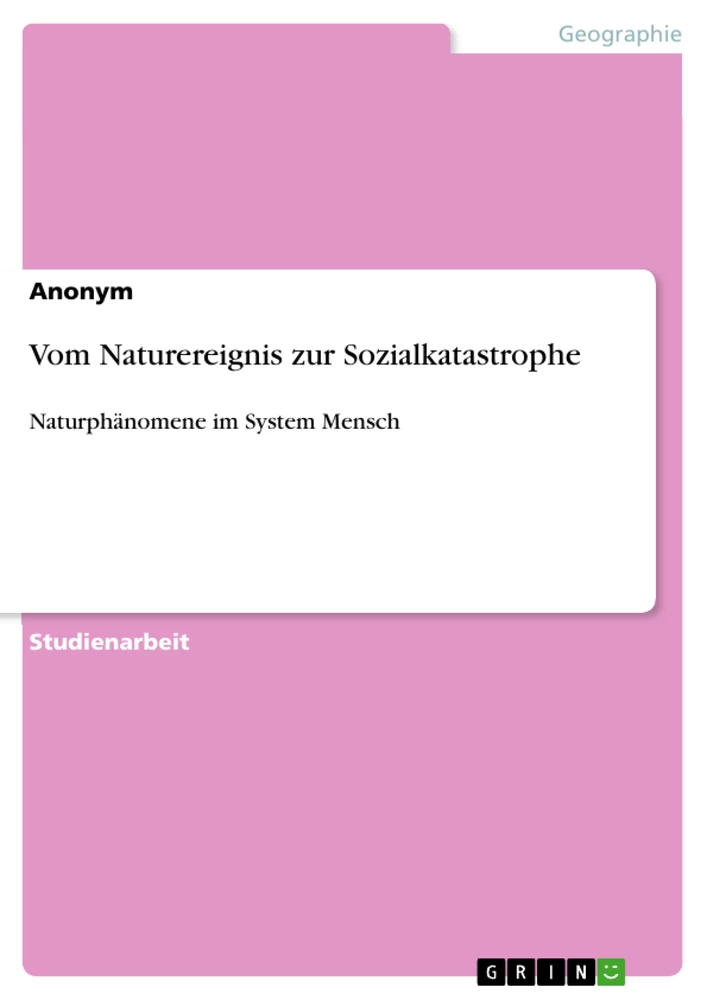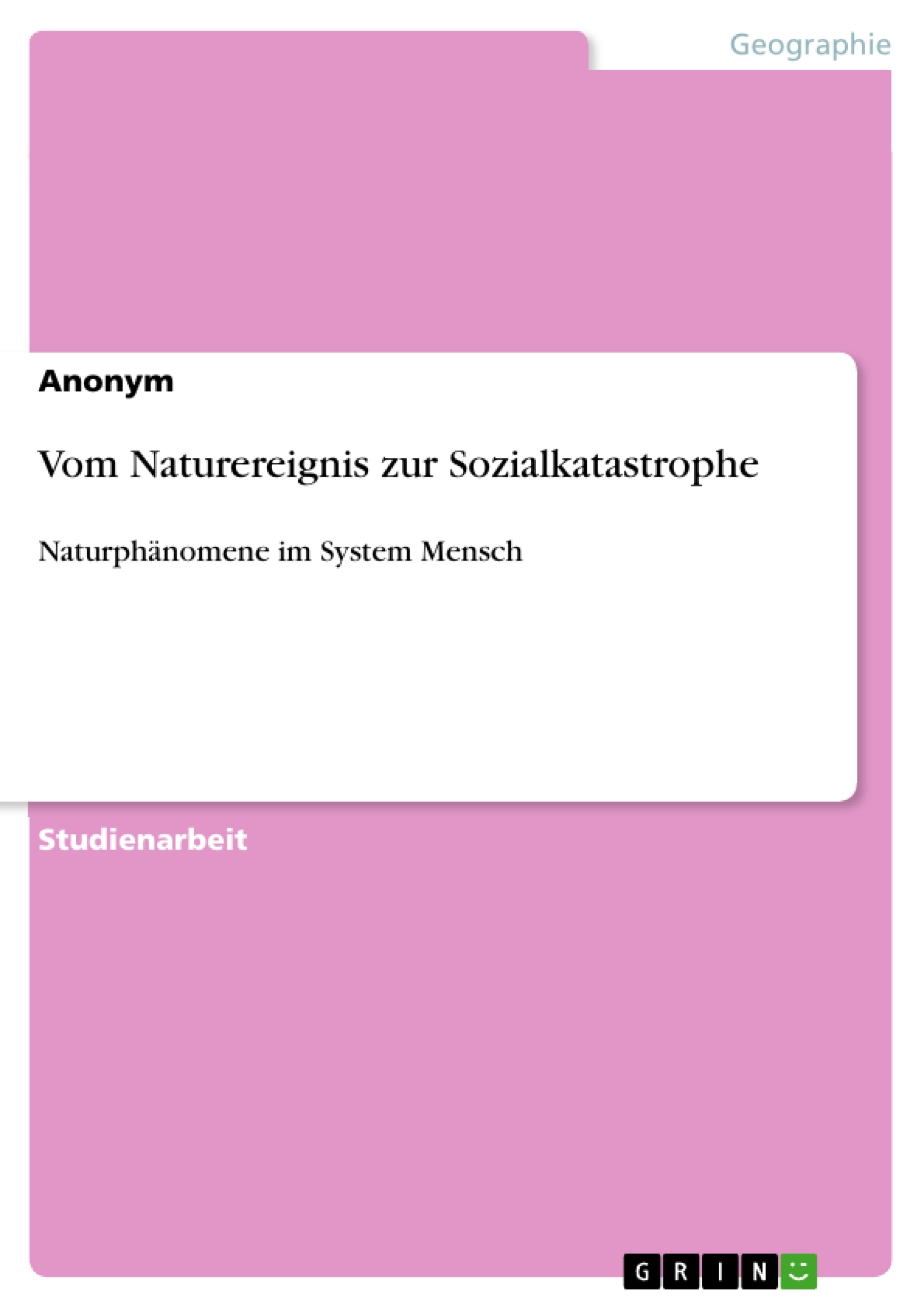Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Stürme - die Wirkungen extremer Naturereignisse auf uns Menschen sind immens. Sie mögen unkontrollierbare Ursachen und verheerende Folgen mit sich bringen, doch in der entsprechenden medialen Berichterstattung fühlt sich nahezu jede Altersgruppe einer Gesellschaft angesprochen. Zum einen für die Faszination des Unfassbaren bzw. dem Unbezwingbaren, dem „extremen Naturereignis“. Zum anderen die Folgen einer, statistisch gesehen selten auftretenden, „extremen Naturkraft“ auf den Menschen und das infolge der Naturgefahr entstehende Realisieren gesellschaftlicher Anfälligkeiten.
Es stellt sich in dieser Konstellation die Frage, welche Rolle Naturphänomene im System Mensch spielen und andersherum. Liegen die Anfälligkeiten (Vulnerabilität; Verwundbarkeit), die im öffentlichen Diskurs (das Verhindern und Entstehen von Naturkatastrophen) debattiert werden, in der Natur selbst, im System Mensch oder im Wechselspiel beider begründet? Dieser Problematik soll in dieser Modularbeit nachgegangen werden und mit dem Ansatz von Schmidt-Wulffen, es handle sich nicht um Natur-, sondern um Sozialkatastrophen, diskutiert werden.
Weiterhin, so Schmidt-Wulffen, werde eine Naturgefahr erst durch das Eingreifen des Menschen in den Naturraum zu einer „Katastrophe“. Dieser Gedanke soll zudem unter den Fragestellungen aufgegriffen werden, welche Voraussetzungen Naturgefahren gefährlich machen, wodurch sowohl hohe Todesopfer als auch gravierende, volkswirtschaftliche Schäden begründet liegen und welche Raumstrukturen ein mögliches Risiko bedingen. Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit soll eine ganzheitliche Raumbetrachtung aus dem Blickwinkel der (gesellschaftlichen) Anfälligkeit vorgenommen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fachwissenschaftliche Aspekte
- Die aktuelle Sichtweise von Naturkatastrophen
- Die „Hazardforschung“
- Das Ausmaß von „Sozialkatastrophen“
- Wahrnehmung von „Sozialkatastrophen“
- Naturgewalten im Vergleich
- Historischer Kontext
- Ökonomischer Kontext
- Ausblicke
- Zeitgemäßer Geographieunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Modularbeit untersucht die Rolle von Naturphänomenen im System Mensch und umgekehrt. Sie analysiert, wie Naturgefahren zu „Sozialkatastrophen“ werden und welche Faktoren die Anfälligkeit menschlicher Gesellschaften für solche Katastrophen beeinflussen. Dabei werden sowohl die wissenschaftliche Sichtweise auf Naturkatastrophen als auch die gesellschaftliche Wahrnehmung und die ökonomischen Folgen betrachtet. Die Arbeit greift den Ansatz von Schmidt-Wulffen auf, der argumentiert, dass es sich nicht um Natur-, sondern um Sozialkatastrophen handelt, da Naturgefahren erst durch das Eingreifen des Menschen in den Naturraum zu einer Katastrophe werden.
- Die aktuelle Sichtweise auf Naturkatastrophen und die Unterscheidung zwischen Naturereignis und Katastrophe
- Die Rolle der „Hazardforschung“ bei der Analyse und Prävention von Naturgefahren
- Das Ausmaß von „Sozialkatastrophen“ und die Folgen für die betroffenen Gesellschaften
- Die Wahrnehmung von „Sozialkatastrophen“ in der Medienlandschaft und der öffentlichen Meinung
- Die Bedeutung von gesellschaftlicher Anfälligkeit (Vulnerabilität) für die Entstehung von „Sozialkatastrophen“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Modularbeit vor und führt in die Problematik von Naturphänomenen im System Mensch ein. Sie diskutiert die unterschiedliche Sichtweise auf Naturgefahren und die Frage, inwieweit sie durch menschliche Eingriffe zu Katastrophen werden.
Das Kapitel „Fachwissenschaftliche Aspekte“ analysiert die aktuelle Sichtweise auf Naturkatastrophen und stellt die „Hazardforschung“ als wissenschaftlichen Ansatz vor. Es geht auf das Ausmaß von „Sozialkatastrophen“ und die Wahrnehmung dieser in der Gesellschaft ein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Differenzierung zwischen Naturereignis, Naturgefahr und Naturrisiko.
Das Kapitel „Naturgewalten im Vergleich“ untersucht den historischen und ökonomischen Kontext von Naturgefahren. Es analysiert die Rolle von extremen Naturereignissen in der Menschheitsgeschichte und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Naturphänomene, Naturereignis, Naturgefahr, Naturrisiko, Sozialkatastrophe, Hazardforschung, Anfälligkeit (Vulnerabilität), gesellschaftliche Wahrnehmung, ökonomische Folgen, Medienlandschaft, Raumstrukturen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2013, Vom Naturereignis zur Sozialkatastrophe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419328