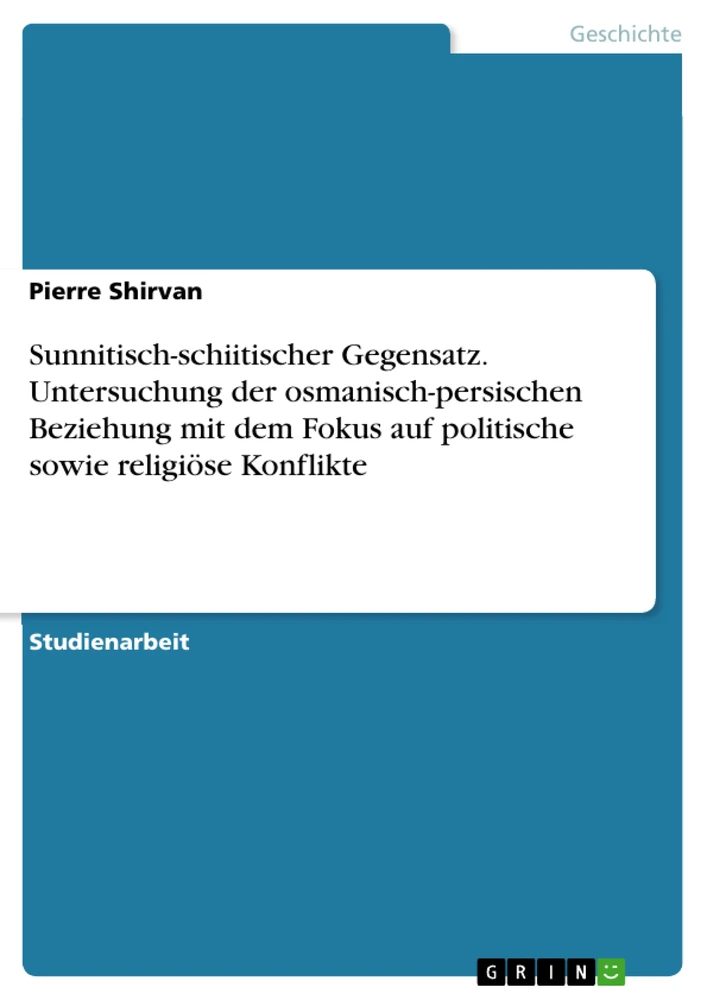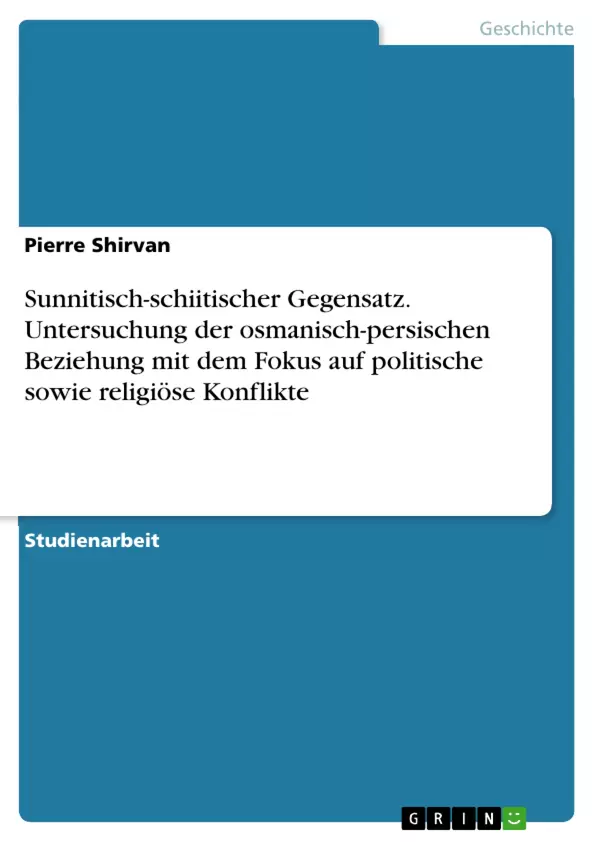Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit den politischen und religiösen Beziehungen sowie mit den damit einhergehenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Osmanen und Safawiden. Im Fokus der Betrachtung stehen dabei die Ereignisse des 16. und 17. Jahrhunderts. Ziel ist die Beantwortung der Frage, durch welche Faktoren beide Staatsysteme ihren Machtanspruch legitimierten und welche Gründe es für die Konflikte untereinander gab. Dies geschieht unter Berücksichtigung der einschlägigen deutsch- und englischsprachigen Literatur. Es soll verdeutlicht werden mit welchen Mitteln die jeweilige Politik begründet wurde.
Die Entwicklungen des Irans unter den Safawiden, waren maßgebend für die neuzeitliche Entwicklung des Landes. Noch heute sind Grundzüge der Safawidendynastie im iranischen Staatssystem zu erkennen. Seine größte Ausdehnung erreichte das Reich unter Schah Abbas I. und war umgeben vom Osmanischen Reich, dem usbekischen Khanat und dem indischen Mogulreich. Dies waren allesamt sunnitische Mächte, die das schiitische Reich umzingelten, welches dementsprechend einen Sonderstatus einnahm.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Methodischer Aufbau und Fragestellung
- Die osmanische Gesellschaftsstruktur - Umgang mit Nicht-Muslimen
- Das osmanisch-safawidische Verhältnis
- Die Sultane als Aufseher des Hedschas und der Pilger
- Konflikte mit den Schiiten des Irans und Anatoliens
- Politik, Religion und Kultur unter den Safawiden
- Das safawidische Herrschaftssystem
- Territoriale Konflikte mit den westlichen Nachbarn
- Legitimation der Safawiden
- Die Pilgerfahrt als politisches Spannungsfeld
- Die Damen der Dynastie auf diplomatischen Missionen
- Probleme persischer Pilger
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die politischen und religiösen Beziehungen zwischen den Osmanen und den Safawiden im 16. und 17. Jahrhundert. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Frage, wie beide Staaten ihre Machtansprüche legitimierten und welche Gründe für die Konflikte zwischen ihnen lagen. Die Arbeit stützt sich dabei auf deutsch- und englischsprachige Literatur und soll die Begründungsstrategien der jeweiligen Politiken verdeutlichen.
- Legitimation der Machtansprüche der Osmanen und Safawiden
- Religiöse und politische Konflikte zwischen den Osmanen und Safawiden
- Der Einfluss der schiitischen Ideologie auf die Safawidenpolitik
- Die Rolle der Pilgerfahrt als politisches Spannungsfeld
- Der Umgang der Osmanen mit schiitischen Minderheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die osmanische Sicht auf die Beziehung zu den Safawiden. Die Entstehung und Entwicklung dieser Beziehung wird dargestellt, wobei der Fokus auf die Zeit zwischen der Machtübernahme Schah Ismails und dem Tod Sultan Selims liegt. Hier werden die ersten Konflikte zwischen den beiden Reichen und die frühen Legitimationsstrategien beider Seiten beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der safawidischen Perspektive auf die osmanisch-safawidischen Beziehungen. Das safawidische Herrschaftssystem wird vorgestellt, die territorialen Konflikte zwischen den beiden Mächten analysiert und die Legitimationsmuster des safawidischen Staates erläutert.
Kapitel 4 bietet einen Überblick über die Pilgerfahrt nach Mekka und analysiert deren politische Bedeutung für die osmanisch-safawidische Beziehung. Die besondere Rolle der Frauen der Dynastie auf diplomatischen Missionen sowie die Probleme persischer Pilger unter der osmanischen Herrschaft werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich der osmanisch-safawidischen Beziehung und beleuchtet deren komplexe Verflechtung von politischen, religiösen und kulturellen Faktoren. Die Arbeit analysiert die Legitimationsstrategien der beiden Reiche, die Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten, die Rolle der Pilgerfahrt im politischen Kontext und die unterschiedlichen Ansichten von osmanischen und safawidischen Gelehrten.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Ursache für den Konflikt zwischen Osmanen und Safawiden?
Der Konflikt war sowohl politisch (Territorialansprüche) als auch religiös (Sunniten gegen Schiiten) begründet.
Wer waren die Safawiden?
Die Safawiden waren eine Dynastie, die das schiitische Perserreich (Iran) begründete und im 16. und 17. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebte.
Warum war die Pilgerfahrt nach Mekka ein politisches Problem?
Da die Osmanen die heiligen Stätten kontrollierten, mussten persische Schiiten osmanisches Gebiet durchqueren, was oft zu diplomatischen Spannungen und Schikanen führte.
Wie legitimierten die Safawiden ihre Herrschaft?
Sie nutzten die schiitische Ideologie und behaupteten oft eine religiöse Verbindung zu den Imamen, um sich von den sunnitischen Nachbarn abzugrenzen.
Welche Rolle spielten Frauen der Dynastien?
Hochrangige Frauen wurden oft auf diplomatische Missionen geschickt oder spielten eine Rolle bei der Organisation der Pilgerfahrten und Friedensverhandlungen.
- Citar trabajo
- Pierre Shirvan (Autor), 2014, Sunnitisch-schiitischer Gegensatz. Untersuchung der osmanisch-persischen Beziehung mit dem Fokus auf politische sowie religiöse Konflikte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419271