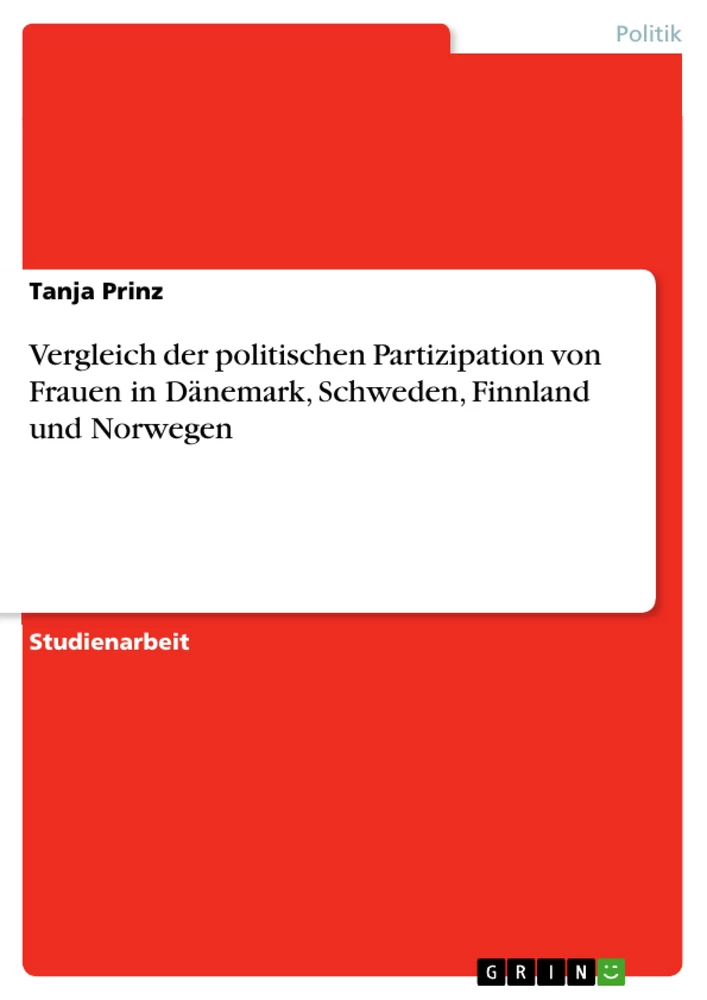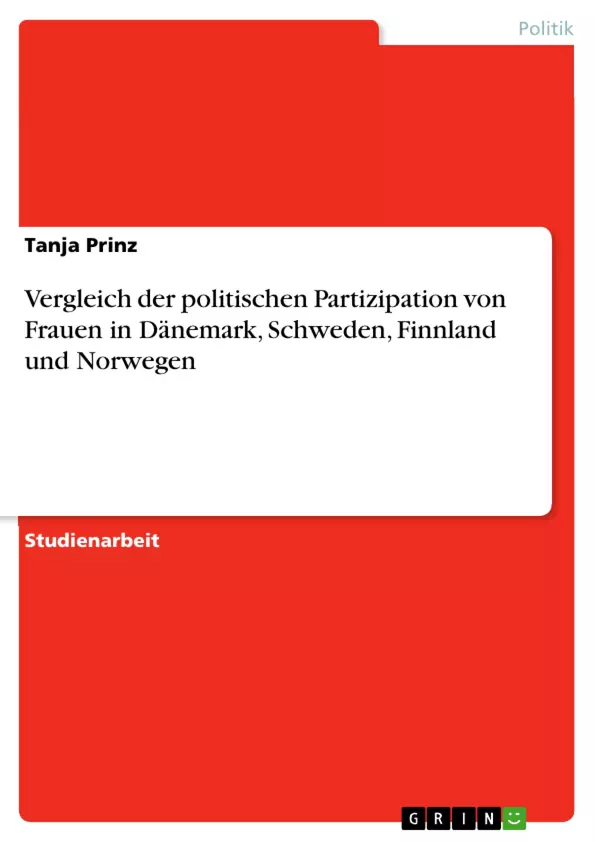Die Frauen in Skandinavien werden von deutschen und anderen europäischen Frauen oft um ihren angeblich enormen Einfluss auf das politische System und die Gesamtgesellschaft beneidet. Viele betrachten Skandinavien als das Eldorado der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Viele Rekorde sprechen dafür: In Dänemark gibt es seit 1885 eine unabhängige Frauengewerkschaft. Die Finninnen erhalten bereits 1906 als erste Frauen in Europa das passive und weltweit als erste das aktive Wahlrecht - gleichzeitig mit den Männern. 1907 schicken sie die erste Frau ins Parlament. Die Dänen sind es, die 1924 die erste Ministerin ins Kabinett berufen, die Isländer, die 1980 eine Frau zur Präsidentin wählen und die Norweger, die 1981 eine Frau zur ersten Premierministerin machen .
Es soll in der folgenden Arbeit untersucht werden, wie groß im 20. Jahrhundert der Einfluss der Frauen in den sogenannten Wohlfahrtsstaaten des Nordens innerhalb der Parteiensysteme wirklich war. Parteien, mit ihrer wichtigen Aufgabe der Kandidatenrekrutierung für politische Ämter und Mandate, spielen auch heute noch eine wichtige Rolle. Sie sind die meist entscheidende Zwischenstation zwischen Privatleben und dem Schritt in die politische Öffentlichkeit. Es stellt sich die Frage, ob Frauen mittlerweile den gleichen Zugang zu den politischen Parteien gefunden haben oder ob sie nach wie vor nach Mitgliederzahl und Einflussbereich unterrepräsentiert sind. Wie viele Frauen werden in den nordischen Parteien für wichtige Ämter nominiert? Wie viele Frauen schicken die Parteien ins Rennen, wenn es um die wichtigen Parlamentssitze auf kommunaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene geht? Wie hoch ist ihr Anteil dann tatsächlich in den Parlamentsfraktionen? Wie oft gelangen Frauen in die prestigeträchtigen Kabinette, Ausschüsse und Parlamentsämter? Welche Rolle spielt das Wahlsystem hinsichtlich der Repräsentation von Frauen? Haben parteiinterne Frauenorganisationen, Strategien der positiven Diskriminierung und die neuen sozialen Bewegungen den Frauen auf dem Weg zur paritätischen Machtausübung geholfen?
Die Arbeit soll helfen zu klären, ob sich ein Blick gen Norden hinsichtlich Geschlechtergleichheit auch weiterhin lohnt und wenn ja, welche Elemente und Entwicklungen möglicherweise auch für Deutschland hilfreich sein könnten. Dazu werden auch Daten zur politischen Partizipation von deutschen Frauen herangezogen und mit skandinavischen verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Integration von Frauen in den Parteien
- 2.1 Frauen als Parteimitglieder
- 2.2 Frauen in parteiinternen Führungspositionen
- 2.3 Parteiinterne Frauenorganisationen
- 2.4 Innerparteiliche Frauenförderung
- 2.4.1 Rhetorische Strategie und Strategie der positiven bzw. unterstützenden Aktion
- 2.4.2 Positive Diskriminierung
- 3. Frauen als Volksvertreterinnen
- 3.1 Frauen in lokalen und regionalen Parlamenten
- 3.2 Frauen im nationalen Parlament
- 3.2.1 Frauen im nationalen Parlament
- 3.2.2 Wahlverhalten von Männern und Frauen
- 3.2.3 Frauen in den Parteifraktionen
- 3.3 Frauen im Europäischen Parlament
- 3.4 Frauen in der Regierung
- 3.5 Frauen in Parlamentsausschüssen
- 4. Einfluss des Wahlsystems auf die Repräsentation von Frauen
- 5. Einflussfaktoren der parlamentarischen Repräsentation von Frauen
- 6.
- 6.1 Die Marginalisierungsthese
- 6.2 Die Timelag-Hypothese
- 7. Das nordische Modell
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss von Frauen auf die Parteiensysteme der nordischen Wohlfahrtsstaaten im 20. Jahrhundert. Sie analysiert den Zugang von Frauen zu politischen Parteien, ihre Repräsentation in Parlamenten auf verschiedenen Ebenen und die Rolle von Wahlsystemen und parteiinternen Faktoren in diesem Kontext. Der Vergleich mit Daten aus Deutschland soll mögliche Parallelen und Unterschiede aufzeigen.
- Frauen in nordischen Parteien: Mitgliedschaft, Führungspositionen und innerparteiliche Förderung
- Repräsentation von Frauen in lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Parlamenten
- Einfluss des Wahlsystems auf die weibliche Repräsentation
- Analyse relevanter Einflussfaktoren auf die parlamentarische Repräsentation von Frauen
- Vergleich der politischen Partizipation von Frauen in Skandinavien und Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangshypothese auf, dass der Einfluss von Frauen in den skandinavischen Parteiensystemen im 20. Jahrhundert stärker war als oft angenommen. Sie begründet die Notwendigkeit einer genaueren Untersuchung dieses Einflusses im Kontext des skandinavischen Wohlfahrtsstaates und der Rolle der Parteien bei der Kandidatenrekrutierung. Die Arbeit zielt darauf ab, den Zugang von Frauen zu politischen Parteien, ihre Repräsentation in verschiedenen Parlamenten und den Einfluss von Wahlsystemen und parteiinternen Faktoren zu analysieren. Ein Vergleich mit deutschen Daten ist ebenfalls vorgesehen.
2. Die Integration von Frauen in den Parteien: Dieses Kapitel untersucht die Integration von Frauen in die nordischen Parteiensysteme. Es analysiert die Entwicklung der Frauenmitgliedszahlen in Parteien, ihren Anteil an Führungspositionen und die Rolle parteiinterner Frauenorganisationen. Es werden verschiedene Strategien der Frauenförderung, wie positive Diskriminierung und unterstützende Maßnahmen, beleuchtet. Die Analyse zeigt, dass, obwohl Frauen in den Parteien vertreten waren, sie oft in der Minderheit blieben und oft weniger Einfluss als Männer hatten. Der Text beleuchtet den Unterschied zwischen der Gesamtzahl der weiblichen Mitglieder und ihrer tatsächlichen aktiven Partizipation in den Parteiaktivitäten.
3. Frauen als Volksvertreterinnen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Repräsentation von Frauen in verschiedenen politischen Gremien. Es analysiert den Anteil von Frauen in lokalen und regionalen Parlamenten, im nationalen Parlament, im Europäischen Parlament, in der Regierung und in Parlamentsausschüssen. Zusätzlich wird das Wahlverhalten von Männern und Frauen untersucht und die Rolle der Parteifraktionen in Bezug auf die weibliche Repräsentation beleuchtet. Das Kapitel verdeutlicht die Diskrepanz zwischen der Anzahl weiblicher Kandidaten und dem tatsächlichen Anteil von Frauen in den politischen Ämtern, auch unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ebenen der politischen Repräsentation.
4. Einfluss des Wahlsystems auf die Repräsentation von Frauen: Dieses Kapitel untersucht, welchen Einfluss verschiedene Wahlsysteme auf die Repräsentation von Frauen haben. Es analysiert die Auswirkungen der Wahlsysteme auf den Anteil von Frauen in Parlamenten und anderen politischen Institutionen. Es wird diskutiert, ob bestimmte Wahlsysteme die Wahl von Frauen eher fördern als andere und welche Faktoren zusätzlich zum Wahlsystem zu einer höheren oder geringeren Repräsentation von Frauen führen.
5. Einflussfaktoren der parlamentarischen Repräsentation von Frauen: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Repräsentation von Frauen im Parlament. Es diskutiert unter anderem parteiinterne Faktoren, gesellschaftliche Entwicklungen und die Rolle von Frauenbewegungen.
6. Die Marginalisierungsthese und die Timelag-Hypothese: Dieses Kapitel befasst sich mit zwei wichtigen Theorien, die die Unterrepräsentation von Frauen in der Politik erklären. Es analysiert die Marginalisierungsthese, die argumentiert, dass Frauen aufgrund struktureller Benachteiligung marginalisiert sind, und die Timelag-Hypothese, die besagt, dass die Repräsentation von Frauen sich mit einer gewissen Verzögerung an gesellschaftliche Veränderungen anpasst. Es werden die Stärken und Schwächen beider Thesen im Kontext der nordischen Länder diskutiert.
7. Das nordische Modell: Dieses Kapitel analysiert das sogenannte "nordische Modell" im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter und deren Auswirkungen auf die politische Partizipation von Frauen. Es untersucht, inwieweit das nordische Modell tatsächlich eine höhere Gleichstellung erreicht hat und welche Faktoren zu diesem Erfolg beigetragen haben. Der Vergleich mit anderen politischen Systemen könnte hier wichtige Erkenntnisse liefern.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Frauen, Skandinavien, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Parteiensysteme, Parlamentarische Repräsentation, Wahlsysteme, Geschlechtergleichheit, Frauenförderung, Positive Diskriminierung, Marginalisierungsthese, Timelag-Hypothese, Nordisches Modell, Wohlfahrtsstaat.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Frauen in den Parteiensystemen der nordischen Wohlfahrtsstaaten
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss von Frauen auf die Parteiensysteme der nordischen Wohlfahrtsstaaten im 20. Jahrhundert. Sie analysiert den Zugang von Frauen zu politischen Parteien, ihre Repräsentation in Parlamenten auf verschiedenen Ebenen und die Rolle von Wahlsystemen und parteiinternen Faktoren in diesem Kontext. Ein Vergleich mit Daten aus Deutschland soll Parallelen und Unterschiede aufzeigen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Integration von Frauen in Parteien (Mitgliedschaft, Führungspositionen, Frauenorganisationen, Fördermaßnahmen), die Repräsentation von Frauen in lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Parlamenten, den Einfluss des Wahlsystems auf die weibliche Repräsentation, relevante Einflussfaktoren auf die parlamentarische Repräsentation von Frauen und einen Vergleich der politischen Partizipation von Frauen in Skandinavien und Deutschland. Die Marginalisierungsthese und die Timelag-Hypothese zur Erklärung der Unterrepräsentation von Frauen werden ebenfalls diskutiert, ebenso wie das nordische Modell und seine Bedeutung für die Geschlechtergleichstellung.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Integration von Frauen in Parteien, Frauen als Volksvertreterinnen, Einfluss des Wahlsystems, Einflussfaktoren der parlamentarischen Repräsentation, Marginalisierungsthese und Timelag-Hypothese, das nordische Modell und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Fragestellung.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Hausarbeit verwendet eine vergleichende Analyse der politischen Partizipation von Frauen in den nordischen Ländern und Deutschland. Sie stützt sich auf die Auswertung von Daten zur Frauenmitgliedschaft in Parteien, zur Repräsentation in Parlamenten und anderen politischen Institutionen sowie auf die Analyse von Wahlsystemen und parteiinternen Faktoren. Theorien wie die Marginalisierungsthese und die Timelag-Hypothese werden diskutiert und auf ihren Erklärungswert hin überprüft.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse zeigen die Entwicklung der Frauenintegration in nordische Parteiensysteme auf, analysieren deren Repräsentation in verschiedenen politischen Gremien und untersuchen den Einfluss von Wahlsystemen und parteiinternen Faktoren. Die Arbeit beleuchtet Diskrepanzen zwischen der Anzahl weiblicher Kandidaten und dem tatsächlichen Anteil von Frauen in politischen Ämtern und diskutiert die Stärken und Schwächen der Marginalisierungsthese und der Timelag-Hypothese im Kontext der nordischen Länder. Der Vergleich mit Deutschland soll wichtige Erkenntnisse liefern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Politische Partizipation, Frauen, Skandinavien, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Parteiensysteme, Parlamentarische Repräsentation, Wahlsysteme, Geschlechtergleichheit, Frauenförderung, Positive Diskriminierung, Marginalisierungsthese, Timelag-Hypothese, Nordisches Modell, Wohlfahrtsstaat.
Welche zentrale These wird in der Einleitung aufgestellt?
Die Einleitung stellt die Hypothese auf, dass der Einfluss von Frauen in den skandinavischen Parteiensystemen im 20. Jahrhundert stärker war als oft angenommen und begründet die Notwendigkeit einer genaueren Untersuchung im Kontext des skandinavischen Wohlfahrtsstaates und der Rolle der Parteien bei der Kandidatenrekrutierung.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden bereitgestellt?
Die Hausarbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels knapp zusammenfassen und die Argumentationslinie der Arbeit verdeutlichen. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die behandelten Themen und die gewonnenen Erkenntnisse.
- Arbeit zitieren
- Tanja Prinz (Autor:in), 2001, Vergleich der politischen Partizipation von Frauen in Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4173