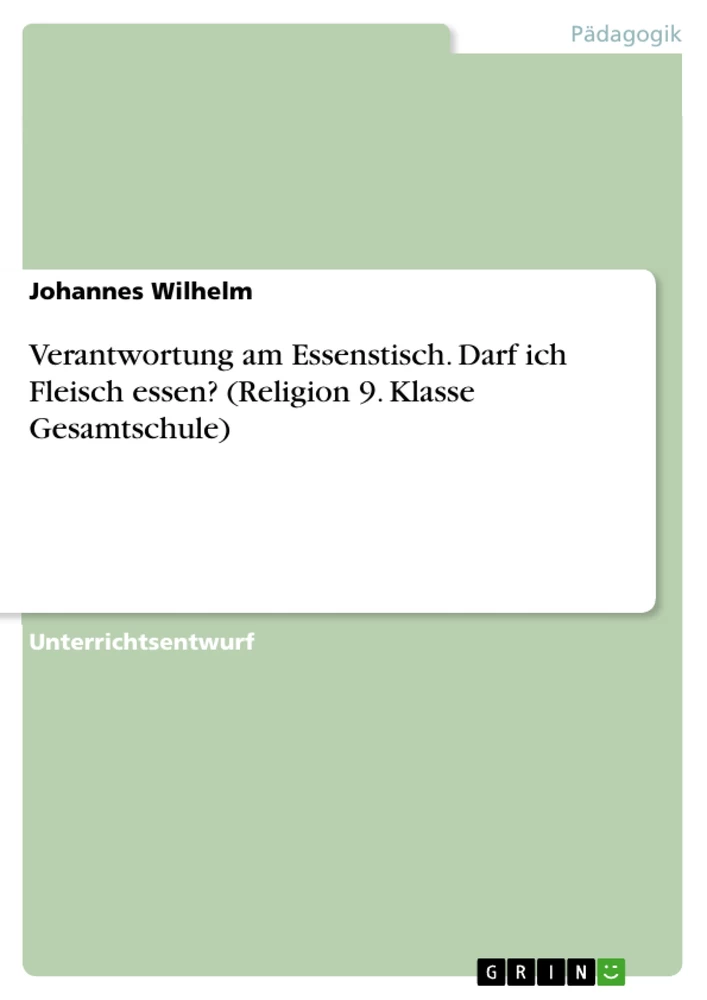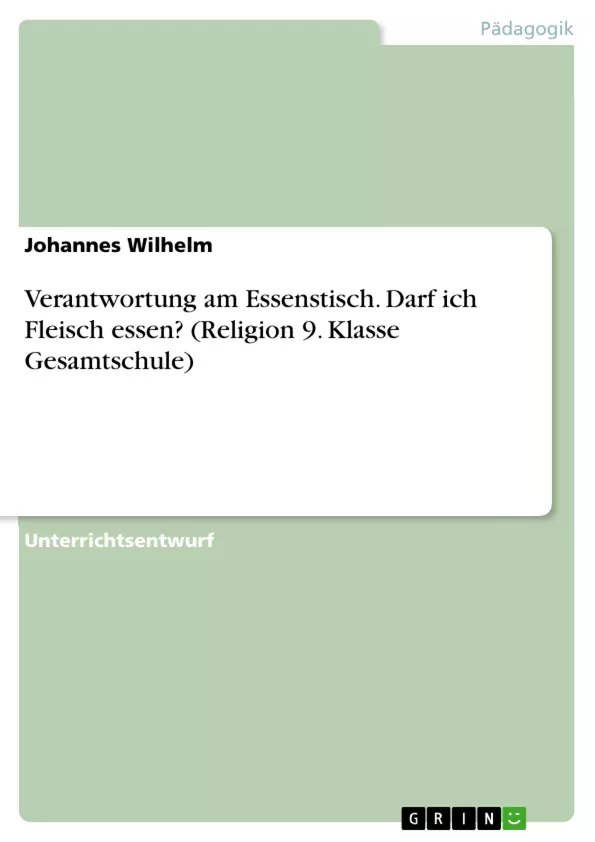Unsere alltäglichen Handlungen sind durch den technischen Fortschritt in immer komplexeren „menschlichen, ökologischen und physikalischen Beziehungsgeflechten“ eingewoben. Die damit verbundenen Eingriffe in die Natur bergen nicht immer absehbare Risiken für Mensch und Mitwelt. Dennoch werden mit dem technischen Fortschritt grundsätzlich positive Aussichten verknüpft. Die Beurteilung, ob es sich bei technischen Neuerungen und den damit einhergehenden menschlichen Handlungsmöglichkeiten (Handlungsfreiheit) um Fortschritte im Sinne des Voranschreitens im Menschsein oder um einen Fortschritt im Sinne des Wegschreitens handelt, erfordert eine Einsicht in die kurz- und langfristigen Folgen, die mit der Anwendung neuer Techniken verbunden sind. Die Bewertung dieser Folgen bedarf wiederum eines Bewusstseins dafür, wodurch die Lebensqualität grundlegend bestimmt ist. Erst dann kann eine eigene begründete und mündige Weltanschauung mit einem tragfähigen Menschenbild entwickelt und in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Analyse der Lerngruppe und Lernausgangslage
- Auszug aus der Unterrichtseinheit und Einordnung der Stunde
- Didaktische Analyse
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse der Stunde
- Didaktisches Zentrum der Stunde
- Angestrebter Kompetenzerwerb und Indikatoren
- Methodische Analyse
- Unterrichtsverlaufsplan
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Internetquellen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsreihe „Darf man alles, was man kann? Technischer Fortschritt als Herausforderung an unser Verantwortungsbewusstsein" zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für die ethischen Implikationen des technischen Fortschritts zu vermitteln. Sie sollen lernen, die Folgen ihres Handelns zu reflektieren und ihre Handlungsfreiheit in Bezug auf gesellschaftliche Normen und Werte zu hinterfragen.
- Verantwortung für die Folgen technischen Fortschritts
- Zusammenhang zwischen Freiheit und Verantwortung
- Ethische Fragen im Kontext von Konsum und Lebensqualität
- Das Verhältnis von technischem Fortschritt und Natur
- Sittliche Normen als Grundlage für verantwortliches Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt befasst sich mit der Analyse der Lerngruppe und der Lernausgangslage. Es werden die Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ihre moralischen und fachlichen Kompetenzen beschrieben. Im zweiten Abschnitt wird die Einordnung der Unterrichtsstunde in die Gesamt-Unterrichtseinheit erläutert. Die didaktische Analyse befasst sich mit der Sachanalyse, der didaktischen Analyse der Stunde, dem didaktischen Zentrum der Stunde und dem angestrebten Kompetenzerwerb. Die methodische Analyse beleuchtet die verschiedenen Methoden und Medien, die in der Stunde eingesetzt werden. Der Unterrichtsverlaufsplan gibt einen detaillierten Überblick über den geplanten Ablauf der Stunde.
Schlüsselwörter
Technischer Fortschritt, Verantwortung, Handlungsfreiheit, ethische Implikationen, Folgen des Handelns, Lebensqualität, sittliche Normen, Konsum, Natur, Nachhaltigkeit, Moralentwicklung, Kompetenzerwerb.
Häufig gestellte Fragen
Welche ethischen Fragen wirft der Fleischkonsum auf?
Es geht um die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Natur, den Tieren und den globalen Folgen des technischen Fortschritts in der Lebensmittelproduktion.
Wie hängen technischer Fortschritt und Verantwortung zusammen?
Technischer Fortschritt erweitert unsere Handlungsfreiheit, erfordert aber gleichzeitig eine kritische Reflexion der kurz- und langfristigen Folgen für Mensch und Mitwelt.
Was bedeutet „mündige Weltanschauung“ im Kontext von Konsum?
Eine mündige Weltanschauung bedeutet, eigene Konsumentscheidungen (wie Fleisch essen) auf Basis begründeter Werte und des Bewusstseins für Lebensqualität zu treffen.
Welche Rolle spielt die Schule bei diesem Thema?
Im Religionsunterricht (9. Klasse) sollen Schüler lernen, ethische Implikationen des Alltags zu reflektieren und moralische Kompetenzen im Umgang mit gesellschaftlichen Normen zu entwickeln.
Ist jeder technische Fortschritt auch ein Fortschritt im „Menschsein“?
Nicht zwingend. Die Arbeit unterscheidet zwischen Fortschritt als „Voranschreiten“ oder „Wegschreiten“ vom Menschsein, abhängig von der Bewertung der Folgen für die Lebensqualität.
- Citar trabajo
- Johannes Wilhelm (Autor), 2016, Verantwortung am Essenstisch. Darf ich Fleisch essen? (Religion 9. Klasse Gesamtschule), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415837