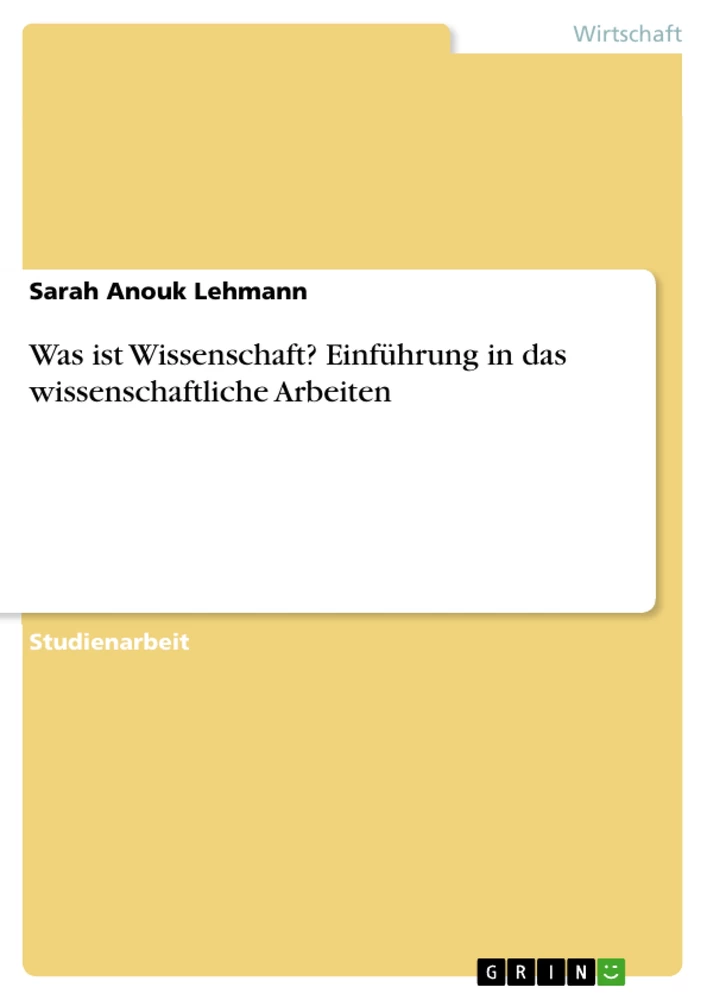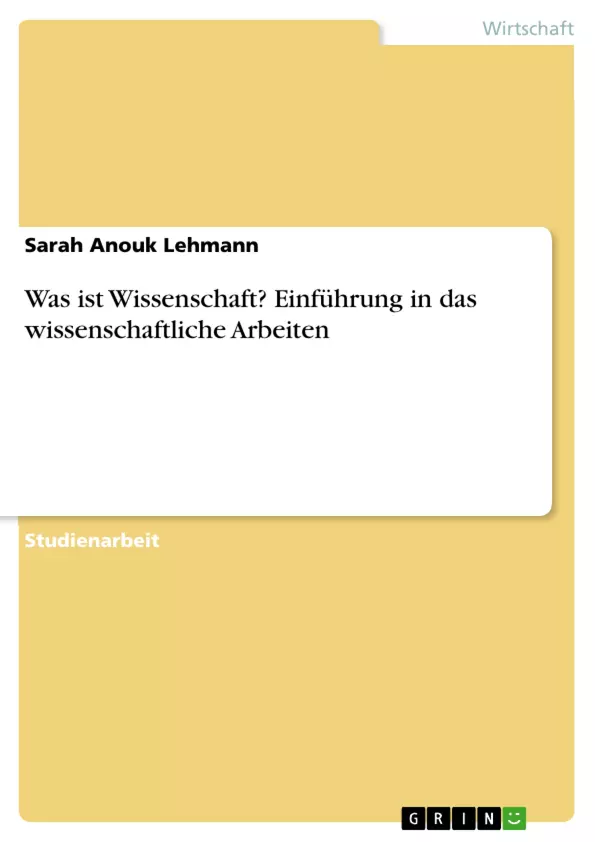„Wer's nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er's klar sagen kann.“ Karl Popper (1902-1994)
In nahezu allen alltäglichen Lebensbereichen und -situationen wird häufig auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgegriffen. Dabei wird der Begriff Wissenschaft oft in einem inflationären, verallgemeinernden Sprachgebrauch verwendet, der dem Wesen der Wissenschaft nicht gerecht wird. In den Medien werden häufig Beweisführungen und Behauptungen mit pseudowissenschaftlichen Formulierungen belegt. Aussagen wie „es ist längst wissenschaftlich bewiesen“ werden als faktische Begründungen angeboten, ohne dass relevante Hintergründe und Zusammenhänge in verlässlicher Weise vermittelt werden. So wird Berichten und Meinungen ein oft zweifelhafter wissenschaftlicher Anstrich verliehen mit der Gefahr, dass der Stellenwert wissenschaftlicher Erkenntnisse und Aussagen im Empfinden der Leser als erheblich abgenutzt und abgewertet registriert wird.
Die Kehrseite dieses Dilemmas ist, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und Errungenschaften von den Expertinnen und Experten leider häufig in sprachlichen Sphären abgehandelt werden, welche die praktische Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit für den „Konsumenten“ höchst unverdaulich oder gar unmöglich machen. Ganz im Sinne eines Zitats von dem ehemaligen kanadischen Premierminister Pierre Elliot Trudeau (1919-2000): „Nicht wenige Experten sehen ihre Daseinsberechtigung darin, einen relativ einfachen Sachverhalt unendlich zu komplizieren.“ Erschwerend kommt hinzu, dass „Wissenschaftsstreit“ die Aufnahme und die Verständlichkeit von Informationen erheblich kompliziert. Das Gebot der Verständlichkeit der Wissenschaft wurde auch von Karl Jaspers (1883-1969) formuliert. Für ihn war es ein Anliegen, seine Reden und Aufsätze möglichst offen und für alle Interessierten zugänglich zu gestalten.
Im Blick auf diese beiden Extreme möchte ich mit meiner Arbeit ganz im Sinn des Eingangszitats von Karl Popper mit einem strukturierten, ausgewogenen Überblick zu wesentlichen Aspekten und Wissenschaftsbegriffen zu einer differenzierten und verständlichen Betrachtung des Begriffs Wissenschaft beitragen.
Ich zeige ausgewählte Quellen, erläutere das Wesen der Wissenschaft, behandle wesentliche Aspekte zur Systematik, gehe auf Denkschulen und den Wissenschaftsstreit ein und schließe mit einem persönlichen Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung: Umgang mit dem Begriff Wissenschaft
- Quellen der Wissenschaft
- Ausgewählte Quellen der Wissenschaft vor dem 20. Jahrhundert
- Ausgewählte Quellen der Wissenschaft im 20. Jahrhundert
- Das Wesen der Wissenschaft
- Wissenschaftsdisziplinen
- Begriffsdefinitionen
- Wertfreiheit
- Fazit zu dem Wesen der Wissenschaft
- Wissenschaftsdisziplinen
- Systematik der Wissenschaft
- Quantitative und qualitative Forschung
- Deduktion, Induktion, Abduktion
- Falsifikation
- Paradigmen
- Begriffsdefinition
- Anwendung von Paradigmen
- Fazit zu Paradigmen
- Denkschulen
- Begriffsdefinition
- Beispiele für Denkschulen
- Frankfurter Schule
- Freiburger Schule
- Fazit zu Denkschulen
- Wissenschaftsstreit
- Was ist Glyphosat und Gegenstand des Streits
- Streitpositionen im Glyphosatstreit
- Fazit zum Wissenschaftsstreit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, den Begriff „Wissenschaft“ zu beleuchten und eine verständliche Übersicht über wichtige Aspekte und wissenschaftliche Begriffsdefinitionen zu liefern. Die Arbeit soll dabei helfen, die Komplexität des Begriffs zu entschlüsseln und die unterschiedlichen Perspektiven auf Wissenschaft aufzuzeigen.
- Die Geschichte der Wissenschaft und ihre Entwicklung
- Das Wesen der Wissenschaft und ihre unterschiedlichen Disziplinen
- Methoden und Systematik der Wissenschaft
- Denkschulen und wissenschaftliche Kontroversen
- Die Bedeutung von Verständlichkeit in der Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel werden die Problematik des Begriffs "Wissenschaft" im alltäglichen Sprachgebrauch beleuchtet und die notwendige Auseinandersetzung mit dem Wesen der Wissenschaft begründet. Anschließend werden in Kapitel 2 wichtige Quellen der Wissenschaft aus verschiedenen Epochen vorgestellt. Hierzu gehören bekannte Wissenschaftler wie Aristoteles, Wilhelm von Ockham, Sir Francis Bacon, René Descartes, Sir Karl Popper, Georgi Schischkoff und Thomas S. Kuhn.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Wesen der Wissenschaft, betrachtet Wissenschaftsdisziplinen und die Begriffsdefinitionen, die dabei eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Wertfreiheit in der Wissenschaft thematisiert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Systematik der Wissenschaft, untersucht die Methoden der quantitativen und qualitativen Forschung und analysiert die Prinzipien der Deduktion, Induktion und Abduktion. Besondere Beachtung findet die Falsifikation als wissenschaftliche Methode sowie die Bedeutung von Paradigmen für den wissenschaftlichen Fortschritt.
In Kapitel 5 werden Denkschulen wie die Frankfurter und die Freiburger Schule beleuchtet, die unterschiedliche Denkansätze und Forschungsfelder in der Wissenschaft repräsentieren.
Kapitel 6 untersucht die Komplexität von Wissenschaftsstreit anhand des Beispiels Glyphosat. Dabei werden die verschiedenen Streitpositionen dargestellt und die Herausforderungen in der Kommunikation von wissenschaftlichen Erkenntnissen betont.
Schlüsselwörter
Wissenschaft, Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftsdisziplinen, Begriffsdefinition, Wertfreiheit, Systematik, Deduktion, Induktion, Abduktion, Falsifikation, Paradigmen, Denkschulen, Wissenschaftsstreit, Glyphosat
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Wesen der Wissenschaft?
Wissenschaft zeichnet sich durch methodisches Vorgehen, Objektivität und die Suche nach verlässlichen Erkenntnissen aus, wobei die Wertfreiheit eine zentrale Rolle spielt.
Was ist der Unterschied zwischen Deduktion und Induktion?
Deduktion schließt vom Allgemeinen auf das Besondere, während Induktion von Einzelfällen auf allgemeine Gesetze schließt.
Warum ist das Prinzip der Falsifikation nach Karl Popper wichtig?
Falsifikation besagt, dass wissenschaftliche Theorien nie endgültig bewiesen, sondern nur widerlegt werden können, was den Fortschritt durch ständige Prüfung ermöglicht.
Was versteht man unter einem Paradigmenwechsel?
Ein Paradigmenwechsel tritt ein, wenn grundlegende wissenschaftliche Überzeugungen durch neue Erkenntnisse oder Denkmodelle (Paradigmen) abgelöst werden.
Warum ist die Verständlichkeit in der Wissenschaft ein Problem?
Oft verkomplizieren Experten einfache Sachverhalte durch Fachsprache, was den Zugang für Laien erschwert und Raum für pseudowissenschaftliche Behauptungen lässt.
- Quote paper
- Sarah Anouk Lehmann (Author), 2018, Was ist Wissenschaft? Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/415780