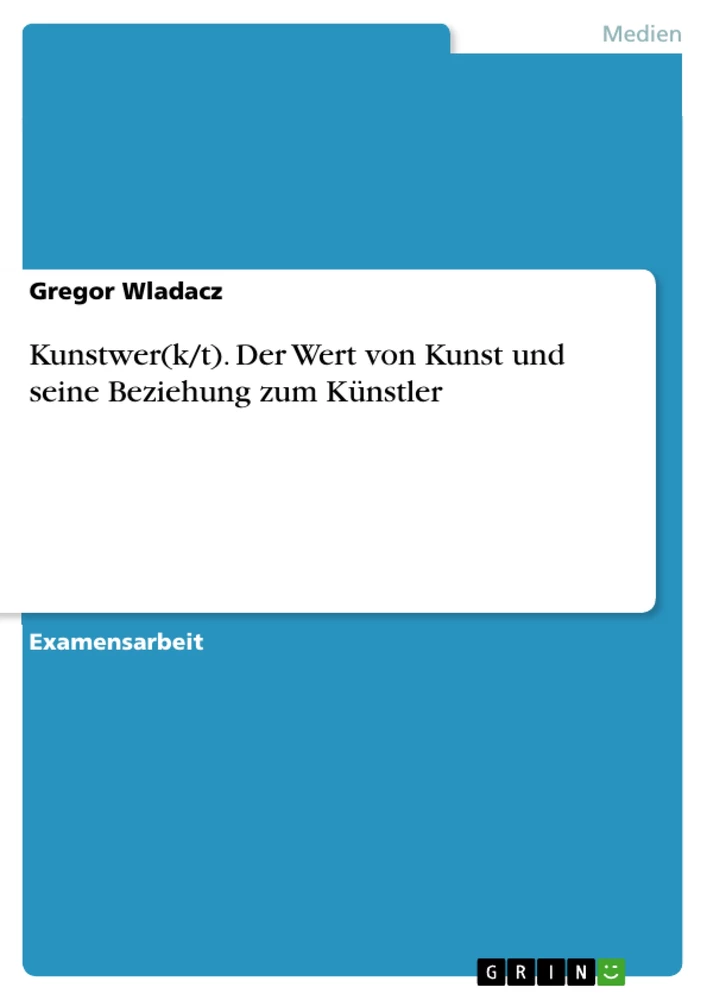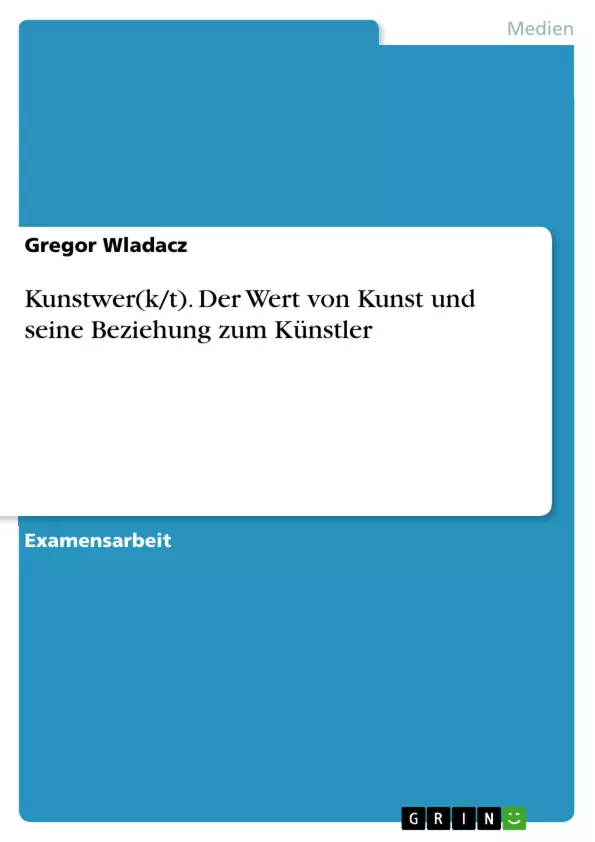Inwieweit ist der (kommerzielle) Wert eines Werkes abhängig vom Künstler/der Künstlerin? Was determiniert den Preis von Kunstwerken? Ist der Preis ein geeignetes Qualitätsmerkmal? Ich versuche diese Fragen zu beantworten, indem ich mich mit verschiedenen Bereichen der Kunsttheorie, -geschichte und des Kunstmarktes auseinandersetze. Zunächst werde ich dafür auf wichtige Begriffe eingehen. Die Definition von Kunst wird einen besonderen Rahmen einnehmen, da der Begriff „Kunst“ allein schon ein Thema für philosophische Diskurse ist.
Dennoch werde ich versuchen, eine allgemeine Auffassung des Begriffes abzudecken, welcher im Rahmen der Arbeit relevant ist. Darauffolgend werde ich die Geschichte des Künstlers/der Künstlerin von dem/der Handwerker/in zur Marke skizzieren, da diese einen wichtigen Hintergrund für die Auffassung von Künstler/innen liefert. Hieran schließen sich ausgewählte kunsttheoretisch Ansätze, die einerseits für die Definition von Kunst, andererseits auch für andere Aspekte des Kunstsystems und der Auffassung von Kunstwerken, sowohl in formaler wie inhaltlicher Hinsicht, wichtig sind. Anschließend soll erläutert werden, wie sich der kommerzielle Wert von Kunstwerken zusammensetzt, und weshalb es wichtig ist, die Bestandteile und Teilnehmer des Kunstmarktes, sowie deren Motive zu beleuchten.
Dieser kommerzielle Aspekt soll schließlich die Verknüpfung zur Auseinandersetzung mit der These bilden, inwiefern es gerechtfertigt ist, den Preis eines Kunstwerks als Qualitätsmerkmal heranzuziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition wichtiger Begriffe
- 2.1 Wert
- 2.2 Kunst
- Kunsthistorischer Exkurs
- 3.1 Der*die Künstler*in – von dem*der Handwerker*in über den*die geniale*n Schöpfer*in zur Marke
- 3.2 Arten von Künstler*innen und die Erweiterung der Kunst
- 3.2.1 Marcel Duchamp: Readymades
- 3.2.2 Joseph Kosuth - Konzeptkunst
- 3.2.3 FLUXUS und der Tod des Autors*der Autorin
- 3.2.4 Joseph Beuys
- 3.2.5 Andy Warhol – Kunst, Konsum, Kommerz
- Vom Kunstmarkt und dem kommerziellen Wert der Kunst
- 4.1 Der Preis
- 4.1.1 Provenienz
- 4.1.2 Original - Fälschung – Kopie
- 4.1.3 Zustand
- 4.1.4 Ästhetische Bewertung
- 4.1.5 Angebot und Nachfrage
- 4.2 Kunst und Geld
- 4.2.1 Kunst als Investment und Spekulationsobjekt
- 4.2.2 Kunst als Statussymbol
- 4.2.3 Kunst als Repräsentation
- 4.3 Der*die Händler*in
- 4.4 Der*die Sammler*in
- 4.5 Das Museum
- 4.6 Kunstkritik
- 4.6.1 Bedeutung von Kritik
- 4.6.2 Ist Kunstkritik tot? Ein kurzer Diskurs
- 4.6.3 Probleme von Kunstkritik
- 4.7 Der*die Künstler*in im Kunstmarkt
- Fazit: der Preis als Qualitätsmerkmal?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit der (kommerzielle) Wert eines Kunstwerks vom Künstler*der Künstlerin abhängig ist und welche Faktoren den Preis von Kunstwerken bestimmen. Darüber hinaus wird untersucht, ob der Preis ein geeignetes Qualitätsmerkmal für Kunst ist.
- Definition von Kunst und Wert
- Entwicklung des Künstler*der Künstlerin von dem*der Handwerker*in zur Marke
- Einfluss des Kunstmarktes auf den Wert von Kunst
- Der Preis als Indikator für Qualität
- Die Rolle von Kunstkritik
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt zwei aktuelle Ereignisse vor, die den Wert und die Preisgestaltung von Kunstwerken in Frage stellen: den Rekordpreis für ein Werk von Leonardo da Vinci und die Aufdeckung von Fälschungen des Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi.
- Kapitel 2 definiert wichtige Begriffe wie Wert und Kunst, wobei letzteres ein komplexes Thema ist, das philosophische Debatten auslöst.
- Kapitel 3 beleuchtet den kunsthistorischen Kontext, insbesondere die Entwicklung des Künstlers*der Künstlerin von dem*der Handwerker*in zu einer Marke. Es werden auch verschiedene Kunstrichtungen vorgestellt, die das Verständnis von Kunst und Künstler*innen erweitern, wie etwa Readymades von Marcel Duchamp, Konzeptkunst von Joseph Kosuth und FLUXUS.
- Kapitel 4 widmet sich dem Kunstmarkt und dem kommerziellen Wert von Kunstwerken. Es werden die Faktoren untersucht, die den Preis beeinflussen, wie Provenienz, Originalität, Zustand und Angebot und Nachfrage. Außerdem werden die verschiedenen Akteure des Kunstmarktes, wie Händler*innen, Sammler*innen, Museen und Kunstkritiker*innen, betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Kunstwert, Kunstmarkt, Künstler*innen, Kunstkritik, Preisgestaltung, Qualität, Fälschung und Provenienz. Darüber hinaus werden wichtige Konzepte aus der Kunsttheorie und -geschichte beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Preis eines Kunstwerks ein Maßstab für seine Qualität?
Nicht zwangsläufig. Der Preis wird oft durch Marktfaktoren wie Angebot und Nachfrage, Spekulation und das Prestige des Künstlers bestimmt, was nicht immer die künstlerische oder ästhetische Qualität widerspiegelt.
Welche Faktoren bestimmen den kommerziellen Wert von Kunst?
Wichtige Faktoren sind die Provenienz (Herkunft), der Zustand des Werks, die Seltenheit, die Bedeutung des Künstlers im kunsthistorischen Kanon sowie aktuelle Trends auf dem Kunstmarkt.
Wie hat sich die Rolle des Künstlers historisch verändert?
Die Entwicklung verlief vom anonymen Handwerker im Mittelalter über das "geniale Genie" der Renaissance bis hin zum Künstler als moderner Marke in der zeitgenössischen Kunstwelt.
Welchen Einfluss haben Kunstfälschungen auf den Markt?
Fälschungen können den Marktwert ganzer Werkgruppen erschüttern und das Vertrauen von Sammlern zerstören, wie prominente Fälle (z. B. Beltracchi) gezeigt haben.
Was ist die Aufgabe der Kunstkritik heute?
Kunstkritik soll Werke einordnen und bewerten. In einem marktgesteuerten System steht sie jedoch oft im Schatten von Preisen und Auktionsergebnissen, was ihre Unabhängigkeit herausfordert.
- Citation du texte
- Gregor Wladacz (Auteur), 2018, Kunstwer(k/t). Der Wert von Kunst und seine Beziehung zum Künstler, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/414744