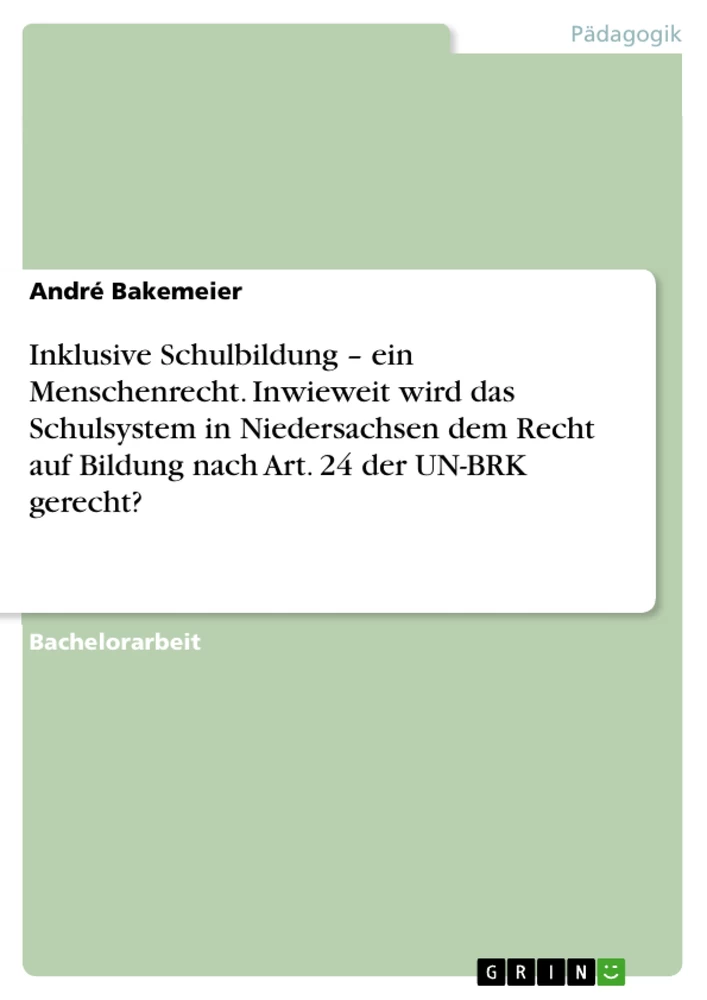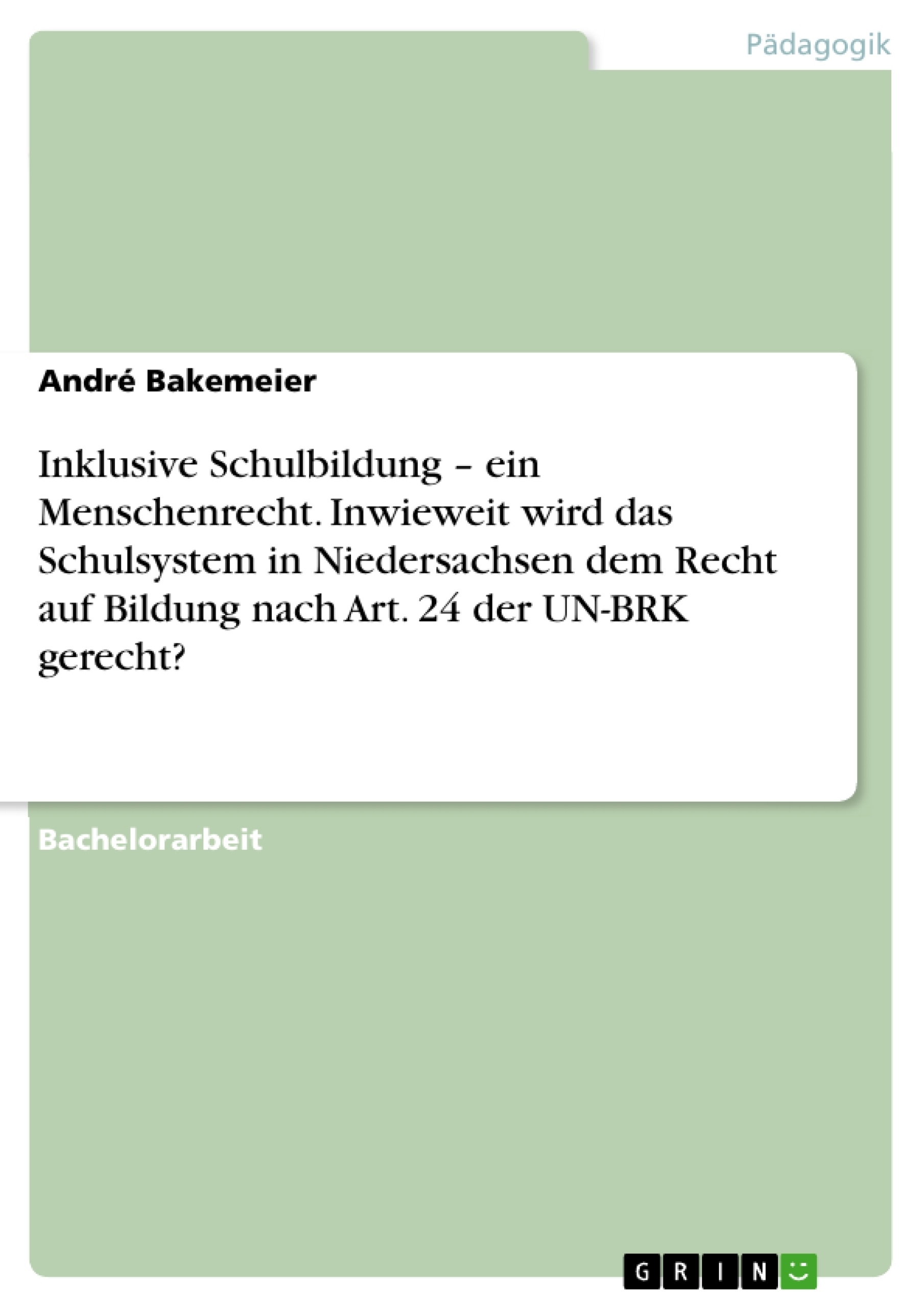Das Thema Inklusion ist, obwohl schon seit mehreren Jahren auf der politischen Tagesordnung, immer noch hochaktuell. Gesellschaftlich wird es ebenso sehr kontrovers diskutiert. Geschichtlich gesehen ist es meines Erachtens, vor allem im Hinblick auf Bildung und Schule, geradezu bahnbrechend. Die praktische Umsetzung des Inklusionsgedankens stellt meiner Meinung nach auch bisherige pädagogische Konzepte auf den Kopf und verlangt von vielen Menschen in unserer Gesellschaft, auch von pädagogischen Fachkräften, ein Umdenken bezüglich des eigenen Menschenbildes.
Seit nunmehr zwei Jahrzehnten bin ich in Einrichtungen tätig, in denen ich beruflich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen arbeite, deren Lebensführung durch eine geistige, körperliche oder seelische Beeinträchtigung behindert war und/oder ist. Die meiste Zeit meiner beruflichen Tätigkeit habe ich in vorschulischen und schulischen Bildungseinrichtungen verbracht. Die letzten fünf Jahre bin ich an einer Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und Körperliche/Motorische Entwicklung tätig.
Gerade durch diesen hautnahen praktischen Bezug beschäftigt und bewegt mich das Thema Inklusion sehr. Obwohl ich an einer Förderschule tätig bin, halte ich deren Bestehen für fragwürdig. Ich habe die Hoffnung, dass sich der inklusive Gedanke immer mehr in unseren Bildungseinrichtungen durchsetzen kann und früher oder später somit Förderschulen überflüssig werden.
In meiner Ausarbeitung werde ich neben der Darstellung der Entwicklung der Institution Schule in Deutschland, der gesetzlichen Grundlage bezüglich inklusiver Bildung, auch den Integrations- und den Inklusionsgedanken gegenüberstellen und versuchen deutlich zu machen das der Inklusionsgedanke bildungsspezifisch weitreichendere Folgen hat, als eine schulische Integration. Danach werde ich der Frage nachgehen, unter welchen Bedingungen eine Schule als inklusiv bezeichnet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Sonderpädagogische Schulentwicklung in Deutschland
- 3. Rechtliche Grundlagen inklusiver Schulbildung in der BRD
- 3.1. Menschenrechtskonventionen
- 3.2. Die UN-BRK - Art. 24 (inklusive Bildung)
- 3.3. Die Rechtswirkungen der UN – BRK in der BRD
- 3.4. UN-Ausschuss zur Umsetzung der Vorgaben in der BRD
- 3.5. Das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG)
- 4. Inklusive Bildung im niedersächsischen Schulsystem
- 4.1. Die Schullandschaft in Niedersachsen
- 4.2. Aktionsplan zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
- 4.3. Inklusive Bildung in Zahlen
- 5. Der Weg zu einem inklusiven Schulsystem
- 5.1. Voraussetzungen inklusiver Bildung
- 5.2. Inklusion vs. Integration
- 5.3. Inklusive Bildung kontrovers
- 5.4. Das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein
- 6. Standards einer inklusiven Schule
- 6.1. Kennzeichen einer inklusiven Schule
- 6.2. Der inklusive Unterricht
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Umsetzung des Rechts auf inklusive Schulbildung nach Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im niedersächsischen Schulsystem. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Deutschland, beleuchtet die rechtlichen Grundlagen inklusiver Bildung und vergleicht die Konzepte von Integration und Inklusion. Ziel ist es, die Herausforderungen und Voraussetzungen für ein inklusives Schulsystem aufzuzeigen.
- Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Deutschland
- Rechtliche Grundlagen inklusiver Bildung in Deutschland und Niedersachsen
- Vergleich zwischen Integration und Inklusion
- Herausforderungen und Voraussetzungen für ein inklusives Schulsystem
- Der aktuelle Stand inklusiver Bildung in Niedersachsen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der inklusiven Schulbildung ein und betont deren Aktualität und gesellschaftliche Kontroverse. Der Autor beschreibt seinen persönlichen Bezug zum Thema durch seine langjährige Tätigkeit in verschiedenen Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und formuliert seine Hoffnung auf einen zukünftigen Wandel hin zu einem inklusiven Schulsystem, in dem Förderschulen überflüssig werden. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau und die Zielsetzung der Ausarbeitung.
2. Die Sonderpädagogische Schulentwicklung in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Deutschland. Es beschreibt die Entstehung von Hilfsschulen im 19. Jahrhundert als Reaktion auf lernschwächere Kinder und die zunehmende Ausdifferenzierung des Bildungssystems mit spezialisierten Förderangeboten. Das Kapitel analysiert die Entwicklung von der Ausgrenzung und Stigmatisierung von Kindern mit Behinderungen hin zur Integrationsbewegung der 1970er Jahre und die begrenzten Erfolge dieser Bewegung. Der Einfluss der Salamanca-Erklärung von 1994 und die entscheidende Rolle der UN-BRK von 2006 werden erörtert.
Schlüsselwörter
Inklusive Schulbildung, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Integration, Inklusion, Sonderpädagogik, Niedersachsen, Schulgesetz, teilhabeorientierte Bildung, barrierefreies Lernen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Inklusive Schulbildung in Niedersachsen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Umsetzung des Rechts auf inklusive Schulbildung gemäß Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im niedersächsischen Schulsystem. Sie analysiert die historische Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Deutschland, die rechtlichen Grundlagen inklusiver Bildung und vergleicht die Konzepte von Integration und Inklusion. Ziel ist es, Herausforderungen und Voraussetzungen für ein inklusives Schulsystem aufzuzeigen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenschwerpunkte: die Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Deutschland, die rechtlichen Grundlagen inklusiver Bildung in Deutschland und Niedersachsen, ein Vergleich zwischen Integration und Inklusion, Herausforderungen und Voraussetzungen für ein inklusives Schulsystem sowie der aktuelle Stand inklusiver Bildung in Niedersachsen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Bachelorarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Sonderpädagogische Schulentwicklung in Deutschland, Rechtliche Grundlagen inklusiver Schulbildung in der BRD (inkl. Unterkapitel zu Menschenrechtskonventionen, UN-BRK, Rechtswirkungen in der BRD, UN-Ausschuss und Niedersächsisches Schulgesetz), Inklusive Bildung im niedersächsischen Schulsystem (inkl. Unterkapitel zur Schullandschaft, Aktionsplan und Zahlen), Der Weg zu einem inklusiven Schulsystem (inkl. Unterkapitel zu Voraussetzungen, Inklusion vs. Integration, Kontroversen und gesellschaftlichem Bewusstsein), Standards einer inklusiven Schule (inkl. Unterkapitel zu Kennzeichen und inklusivem Unterricht) und Fazit.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Menschenrechtskonventionen, insbesondere Artikel 24 der UN-BRK (inklusive Bildung) und dessen Rechtswirkungen in der BRD. Der Einfluss des UN-Ausschusses zur Umsetzung der Vorgaben in Deutschland wird ebenso betrachtet wie das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG).
Wie werden Integration und Inklusion verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Konzepte von Integration und Inklusion, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze herauszuarbeiten und den Fortschritt von der Integration zur Inklusion zu verdeutlichen.
Welche Herausforderungen und Voraussetzungen für ein inklusives Schulsystem werden genannt?
Die Arbeit identifiziert die Herausforderungen und benennt die Voraussetzungen, die für die erfolgreiche Umsetzung eines inklusiven Schulsystems notwendig sind. Dies umfasst gesellschaftliche, politische und pädagogische Aspekte.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der inklusiven Schulbildung in Niedersachsen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: inklusive Schulbildung, UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), Integration, Inklusion, Sonderpädagogik, Niedersachsen, Schulgesetz, teilhabeorientierte Bildung, barrierefreies Lernen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, die Herausforderungen und Voraussetzungen für ein inklusives Schulsystem aufzuzeigen und die Umsetzung des Rechts auf inklusive Schulbildung nach Artikel 24 der UN-BRK im niedersächsischen Schulsystem zu untersuchen.
- Citation du texte
- André Bakemeier (Auteur), 2016, Inklusive Schulbildung – ein Menschenrecht. Inwieweit wird das Schulsystem in Niedersachsen dem Recht auf Bildung nach Art. 24 der UN-BRK gerecht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/413974