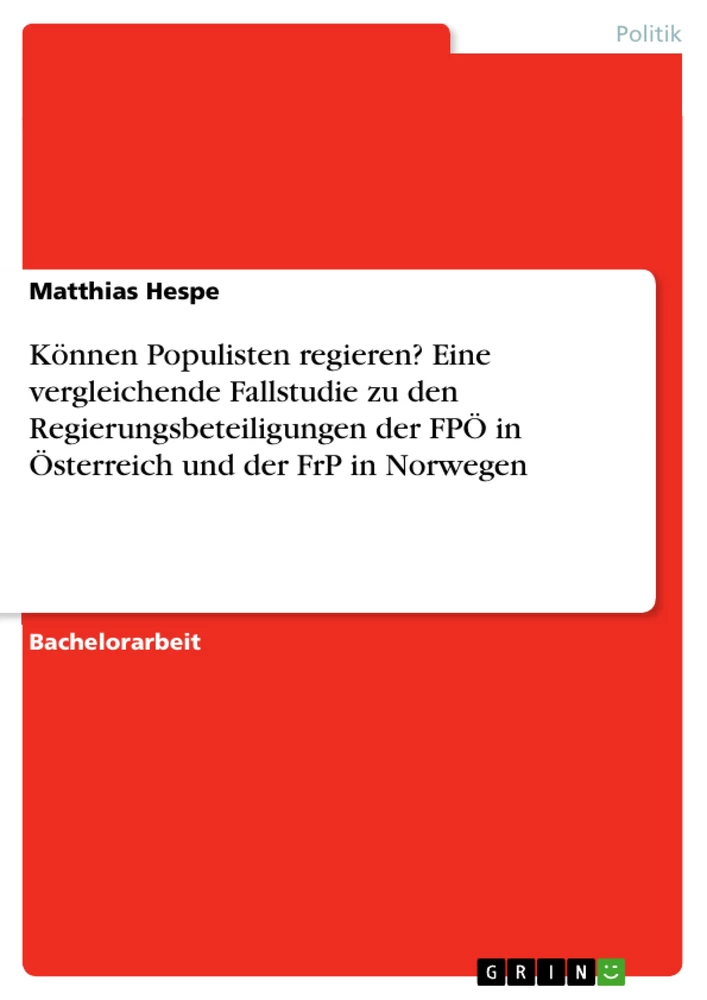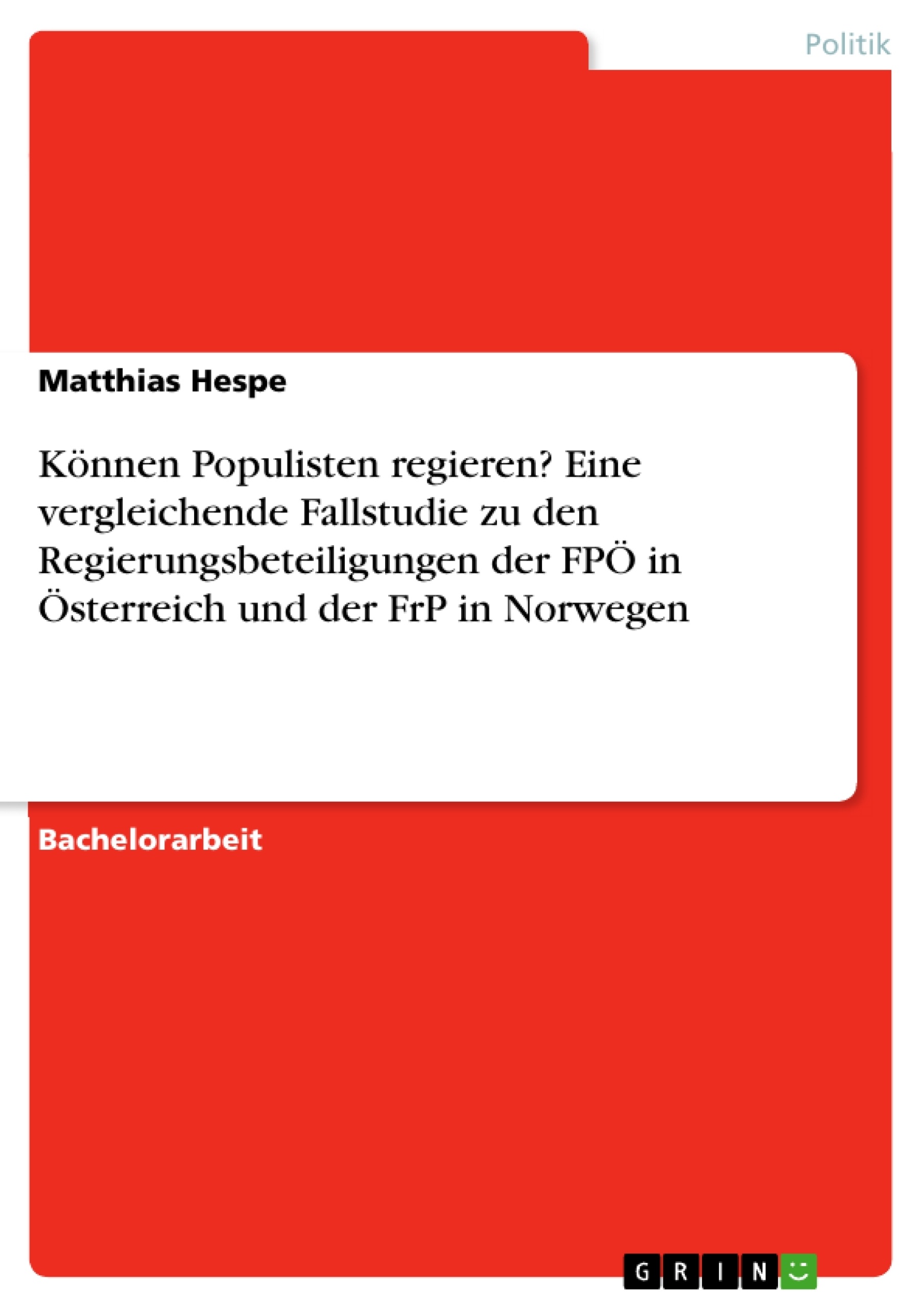Ob Donald Trump in den USA, Viktor Orbán in Ungarn oder Marine Le Pen in Frankreich: Der Populismus und dessen schillernde Vertreter scheinen in der heutigen politischen Welt stärker denn je zu polarisieren. Inzwischen hat auch in Deutschland mit der Alternative für Deutschland (AfD) eine als populistisch bezeichnete Partei unter großem öffentlichem Diskurs die politische Arena betreten. Dennoch ist die Thematik Populismus keine rein europäische und US-amerikanische, sondern vielmehr eine weltweite Angelegenheit. So gibt es unter anderem auch in Südamerika prominente politische Akteure, die als populistisch beschrieben werden. In Europa haben zuletzt jedoch diverse als rechtspopulistisch bezeichnete Parteien durch Wahlerfolge und zum Teil sogar Regierungsbeteiligungen auf sich aufmerksam gemacht. In diesem Zusammenhang wird in der Wissenschaft zunehmend die Frage diskutiert, ob und inwiefern als populistisch bezeichnete Akteure in der Lage sind, einen Staat zu regieren bzw. an einer Regierung zu partizipieren. In dieser Arbeit geht es diesbezüglich konkret um die vergangenen Regierungsbeteiligungen der FPÖ in Österreich und der FrP in Norwegen, welche jeweils einige Übereinstimmungen, aber auch viele Differenzen aufwiesen und dementsprechend von unterschiedlichem Erfolg geprägt waren. Durch den Vergleich dieser beiden Regierungsbeteiligungen soll letztlich erklärt werden, auf welche Weise populistische Parteien in Europa regieren können - und auf welche Weise sie zum Scheitern verurteilt sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Fragestellung, Aufbau der Arbeit und Methodik
- 1.2 Zum Begriff „Populismus“
- 1.2.1 Grundlegende theoretische Ansätze
- 1.2.2 Erscheinungsformen des Populismus
- 1.2.3 Spezifizierung: Rechtspopulismus
- 1.3 Zur Fallauswahl: Populistische Parteien in Europa
- 1.4 Hypothesen zur Fragestellung
- 2. Geschichte und Charakteristik der Norwegischen Fortschrittspartei
- 2.1 Überblick über die Geschichte der FrP
- 2.1.1 Bis 2013: Von der reinen Protest- zur etablierten Oppositionspartei
- 2.1.2 Seit 2013: Erstmalige Regierungsbeteiligung
- 2.2 Der rechtspopulistische Charakter der FrP
- 3. Geschichte und Charakteristik der Freiheitlichen Partei Österreichs
- 3.1 Überblick über die Geschichte der FPÖ
- 3.1.1 Bis 1999: Etablierung in der Parteienlandschaft und Wahlerfolge ab 1986
- 3.1.2 Bis 2005: Regierungsbeteiligungen mit vorzeitigem Ende
- 3.1.3 Seit 2005: Wiedererstarken als Oppositionspartei
- 3.2 Der rechtspopulistische Charakter der FPÖ
- 4. Ursachen der unterschiedlichen Entwicklungen der Amtszeiten von FPÖ und FrP
- 4.1 Die Führungspersönlichkeiten: Jörg Haider und Siv Jensen
- 4.1.1 Rhetorik und Auftreten
- 4.1.2 Stellung in der Partei und Einfluss
- 4.2 Gestaltung von Politikfeldern
- 4.2.1 Migrations- und Asylpolitik
- 4.2.2 Bemerkenswertes aus anderen Politikfeldern
- 4.3 Öffentliche Reaktionen auf den Regierungseintritt
- 4.4 Konfliktlinien in der Regierungsarbeit
- 4.4.1 Parteiinterne Konflikte
- 4.4.2 Personelle (In-)Konstanz und Verhältnis zum Koalitionspartner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern populistische Parteien in der Lage sind, an einer Regierung zu partizipieren und einen Staat zu regieren. Sie untersucht die unterschiedlichen Entwicklungen der Regierungsbeteiligungen der FrP in Norwegen und der FPÖ in Österreich, um die besonderen Problemlagen für populistische Parteien in Regierungsverantwortung zu beleuchten.
- Erscheinungsformen des Populismus, insbesondere Rechtspopulismus
- Geschichte und Charakteristik der FrP und der FPÖ
- Vergleich der Regierungsbeteiligungen der FrP und der FPÖ
- Faktoren, die die unterschiedlichen Entwicklungen der Regierungsbeteiligungen beeinflussen
- Problemlagen populistischer Parteien in Regierungsverantwortung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik „Populismus“ ein und stellt die Fragestellung der Arbeit sowie den methodischen Ansatz vor. Es wird der Begriff „Populismus“ erläutert, die Fallauswahl begründet und Hypothesen zur Fragestellung aufgestellt.
Kapitel 2 beschreibt die Geschichte und den Charakter der FrP in Norwegen. Es werden die Entwicklung der Partei von einer Protestpartei zu einer etablierten Oppositionspartei bis 2013 sowie die Auswirkungen der ersten Regierungsbeteiligung seit 2013 dargestellt.
Kapitel 3 beleuchtet die Geschichte und den Charakter der FPÖ in Österreich. Es werden die Etablierung der FPÖ in der Parteienlandschaft, die Regierungsbeteiligungen mit vorzeitigem Ende und das Wiedererstarken als Oppositionspartei seit 2005 behandelt.
Kapitel 4 analysiert die Ursachen der unterschiedlichen Entwicklungen der Regierungsbeteiligungen der FrP und der FPÖ anhand der Führungspersönlichkeiten, der Gestaltung von Politikfeldern und der öffentlichen Reaktionen auf den Regierungseintritt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Populismus, Rechtspopulismus, Regierungsbeteiligung, vergleichende Fallstudie, FrP, FPÖ, Norwegen, Österreich, Führungspersönlichkeiten, Politikfelder, öffentliche Reaktionen, Konfliktlinien.
Häufig gestellte Fragen
Können populistische Parteien erfolgreich regieren?
Die Arbeit untersucht dies am Vergleich der FPÖ (Österreich) und der FrP (Norwegen) und zeigt, dass der Erfolg stark von Führungspersonen und Koalitionsdynamiken abhängt.
Wie unterscheidet sich die FrP von der FPÖ?
Während die FPÖ oft mit internen Konflikten und vorzeitigen Regierungsabbrüchen kämpfte, agierte die FrP in Norwegen zeitweise stabiler in ihrer Regierungsbeteiligung.
Welche Rolle spielten Jörg Haider und Siv Jensen?
Die Arbeit vergleicht Rhetorik, Auftreten und den Einfluss dieser Führungspersönlichkeiten auf die Akzeptanz und Stabilität ihrer Parteien in der Regierung.
Was sind typische Konfliktlinien für Populisten in der Regierung?
Herausforderungen sind der Spagat zwischen Protestrolle und Staatsverantwortung, personelle Instabilität sowie Reibungen mit dem Koalitionspartner.
Welche Politikfelder sind für Rechtspopulisten zentral?
Besonders die Migrations- und Asylpolitik steht im Fokus, da hier die Kernversprechen an die Wähler umgesetzt werden sollen.
- Citar trabajo
- Matthias Hespe (Autor), 2017, Können Populisten regieren? Eine vergleichende Fallstudie zu den Regierungsbeteiligungen der FPÖ in Österreich und der FrP in Norwegen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/412846