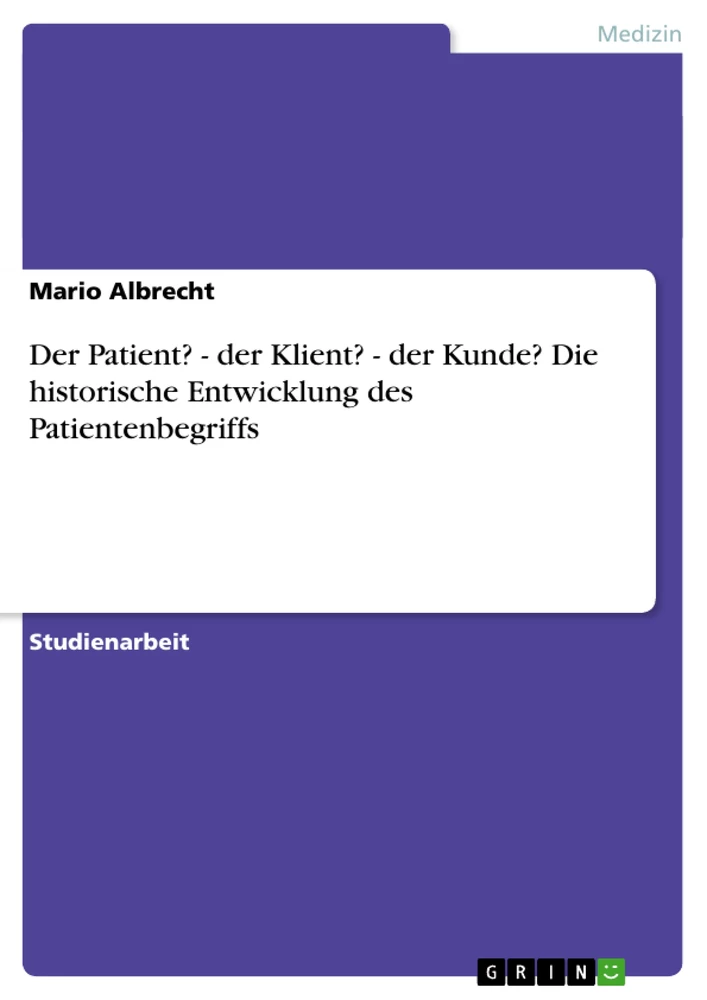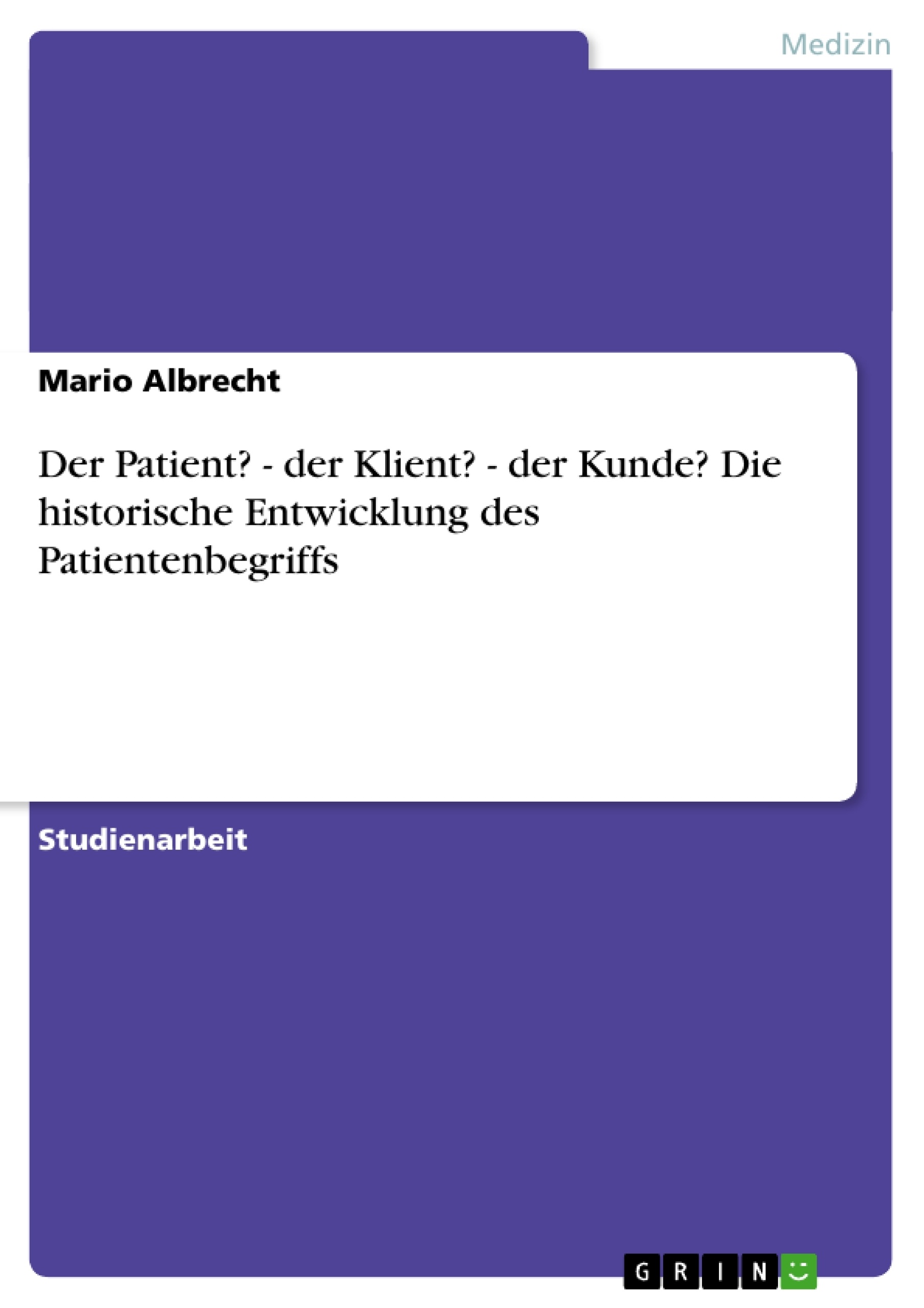[...] Im Krankenhaus mit seiner über die Jahrhunderte gewachsenen hierarchischen Organisationsstruktur erlebe ich auch heute deutlich eine ärztlich-pflegerische Verobjektivierung des Patienten. Wo ist der Ursprung des Patient-Seins, wo ist der Ursprung des Patienten? Über die Geschichte der Medizin und der Ärzte gibt es viele Publikationen. Aber über die Geschichte des Patienten wissen wir wenig. Der Patient hat kaum Dokumente hinterlassen und taucht in der Geschichte selten auf. Als Forschungsgegenstand war er lange Zeit nicht populär. „Während in der aktuellen Diskussion um Reformen im Gesundheitswesen immer wieder das Schlagwort von der ´patientenorientierten Medizin` auftaucht, haben Sozial- und Medizinhistoriker dem Patienten ... erst in jüngster Zeit Aufmerksamkeit geschenkt“. (Jütte 1991,S.9) Die Frage nach dem Ursprung des Begriffes „Patient“ wird die Kernfrage dieser Arbeit sein. Nach einer „Vorschau“ in das Mittelalter befasse ich mich mit der beginnenden Neuzeit im 16. Jahrhundert, die Zeit, in welcher der Begriff in der deutschen Sprache erstmals auftauchte. Im Anschluss werde ich kurz darauf eingehen, welche Begriffe heute anstelle des Patientenbegriffes geprägt und verwendet werden. Dabei wende ich die Aufmerksamkeit besonders auf den Kunden- und den Klientenbegriff. Die Frage, inwieweit die neuen Begriffsprägungen das Bild von der Verobjektivierung des Patienten beeinflussen, soll uns dabei begleiten. Als Quellen dienten mir zum einen die Begriffsklärungen verschiedener Wörterbücher und Lexika. Zum anderen beziehe ich mich insbesondere auf drei Publikationen, die sich mit der Rolle des Kranken im Mittelalter auseinandersetzen: Robert Jütte (1991) vermittelt dem Leser in seinem Buch „Ärzte, Heiler und Patienten“ ein Bild vom „Gesundheitswesen“ des mittelalterlich-neuzeitlichen Köln. Er bezieht sich dabei auf reichhaltiges Quellenmaterial des Stadtarchivs Köln. Heinrich Schipperges (1985) untersucht in seinem Werk „homo patiens“ den Umgang mit Krankheit und die Deutung der Ursache von Krankheit in der Geschichte der Menschheit. In seinem Buch „Die Kranken im Mittelalter“ zeichnet Schipperges (1990) ein Bild von den Krankheiten und den in diesem Zusammenhang entstandenen Institutionen des Mittelalters. Ich werde, falls es der Zusammenhang nicht anders erfordert, in meiner Darstellung weiterhin den Begriff „Patient“ verwenden. Dieser kommt meiner ja auch objektivierenden Betrachtungsweise des „Untersuchungsgegenstandes“ am nächsten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Begriff und seiner Geschichte
- 2.1 Vorgeschichte
- 2.1.1 Begriffssynonyme vor der „Patientenzeit“
- 2.1.2 Die Sprache der Kranken
- 2.1.3 Kleiner Exkurs zur deutschen Sprachentwicklung
- 2.1.4 Ausgrenzungen
- 2.1.5 Armut und Reichtum
- 2.1.6 Eine damalige Darstellung der Beziehung zwischen Kranken und Heilenden
- 2.1.7 Die Berufsausbildung der Heilenden
- 2.2 Erstes Auftauchen des Begriffs „Patient“, Quellen der Erwähnung
- 2.3 Der Begriff und seine Bedeutung
- 2.3.1 Der lateinische Ursprung
- 2.3.2 Medizinische Definitionen
- 2.3.3 Populäre Definitionen
- 2.3.4 Zwischenbilanz
- 3. „Ersatzbegriffe“
- 3.1 Der Klient
- 3.2 Der Kunde
- 3.3 Der Fall und andere Begriffe
- 4. Objekt oder Subjekt - Begriffsimplikationen
- 4.1 Compliance
- 4.2 Stand und Entwicklung heute
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Patientenbegriffs. Das Hauptziel ist es, den Ursprung des Begriffs „Patient“ zu erforschen und seine Bedeutung im Wandel der Zeit zu beleuchten. Dabei werden auch alternative Bezeichnungen wie „Klient“ und „Kunde“ betrachtet.
- Die historische Entwicklung des Patientenbegriffs
- Begriffssynonyme vor der „Patientenzeit“ und ihre soziale Bedeutung
- Der Einfluss der medizinischen und gesellschaftlichen Entwicklung auf den Patientenbegriff
- Die Rolle von Sprache und Perspektiven im Verständnis von Krankheit
- Die Verwendung von „Ersatzbegriffen“ für „Patient“ und deren Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit aus der Perspektive eines Krankenpflegers auf einer Intensivstation, der die Verobjektivierung des Patienten in der Krankenhausstruktur beobachtet. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Ursprung des Patientenbegriffs und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf Quellen wie Wörterbüchern, Lexika und den Werken von Jütte und Schipperges basiert. Die Arbeit legt ihren Fokus auf die Untersuchung des Begriffs "Patient" selbst und der Entwicklung dessen Bedeutung über die Zeit.
2. Zum Begriff und seiner Geschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Patientenbegriffs, beginnend mit der Zeit vor seiner Entstehung. Es analysiert die sprachliche Beschreibung von Krankheit im Mittelalter, die sich deutlich von der heutigen medizinischen Terminologie unterscheidet. Es werden verschiedene Krankheitsgruppen und die damit verbundene soziale Ausgrenzung (z.B. Aussätzige, Pestkranke, Besessene) detailliert untersucht und die damalige Sprache der Kranken und die damals gängigen Krankheitsbeschreibungen analysiert. Der Begriff "Patient" wird im Kontext seines ersten Auftretens in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Bezug auf die Reformation eingeordnet und seine Bedeutung im Kontext dieser Epoche erläutert.
3. „Ersatzbegriffe“: Dieses Kapitel widmet sich alternativen Begriffen zum „Patienten“, insbesondere „Klient“ und „Kunde“. Es untersucht den Einfluss dieser modernen Begrifflichkeiten auf die Wahrnehmung und Behandlung von Kranken und analysiert die damit verbundenen Veränderungen in der Patienten-Behandler-Beziehung. Die potentielle Verschiebung der Perspektive von einem objektivierten „Patienten“ hin zu einem subjektiveren „Klienten“ oder „Kunden“ wird kritisch beleuchtet.
4. Objekt oder Subjekt - Begriffsimplikationen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Implikationen des Patientenbegriffs, insbesondere in Bezug auf die Frage, ob der Patient als Objekt oder Subjekt betrachtet wird. Der Begriff der Compliance wird in diesem Kontext erläutert und die Entwicklung und den aktuellen Stand des Patientenbegriffs in der Medizin. Es werden die ethischen und sozialen Aspekte dieser Betrachtungsweise diskutiert und kritisch analysiert.
Schlüsselwörter
Patient, Patientbegriff, Krankheitsbegriff, Mittelalter, Neuzeit, Sprache, soziale Ausgrenzung, Klient, Kunde, Compliance, Medizinhistorie, Verobjektivierung, Subjekt, Objekt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Entwicklung des Patientenbegriffs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Patientenbegriffs von seinen Ursprüngen bis zur Gegenwart. Sie analysiert den Wandel der Bedeutung des Begriffs „Patient“ und beleuchtet alternative Bezeichnungen wie „Klient“ und „Kunde“ sowie deren Auswirkungen auf die Arzt-Patienten-Beziehung.
Welche Zeiträume werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung des Patientenbegriffs über verschiedene Epochen, beginnend mit der Zeit vor dem erstmaligen Auftreten des Begriffs „Patient“ (Mittelalter) bis zur heutigen Zeit. Dabei wird insbesondere die Sprachentwicklung und die soziale Bedeutung von Krankheit und Kranken im Laufe der Geschichte analysiert.
Welche Quellen wurden für die Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf Quellen wie Wörterbüchern, Lexika und den Werken von Jütte und Schipperges. Sie bezieht sich auf historische Dokumente und analysiert die sprachliche Beschreibung von Krankheit in verschiedenen Epochen.
Wie wird der Begriff „Patient“ in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff „Patient“ nicht statisch, sondern untersucht seine Entwicklung und seine verschiedenen Bedeutungen im historischen Kontext. Sie beleuchtet den Wandel von der Beschreibung von Kranken im Mittelalter bis zur heutigen medizinischen Terminologie.
Welche alternativen Begriffe zu „Patient“ werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht alternative Begriffe wie „Klient“ und „Kunde“ und analysiert deren Einfluss auf die Patienten-Behandler-Beziehung. Sie betrachtet die Implikationen dieser modernen Begrifflichkeiten und die potentielle Verschiebung der Perspektive von einem objektivierten „Patienten“ hin zu einem subjektiveren „Klienten“ oder „Kunden“.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der historischen Entwicklung des Patientenbegriffs, Begriffssynonymen vor der „Patientenzeit“ und deren sozialer Bedeutung, dem Einfluss der medizinischen und gesellschaftlichen Entwicklung auf den Patientenbegriff, der Rolle von Sprache und Perspektiven im Verständnis von Krankheit und der Verwendung von „Ersatzbegriffen“ für „Patient“ und deren Implikationen.
Wie wird die Frage nach der Objektivierung des Patienten behandelt?
Die Arbeit untersucht die Implikationen des Patientenbegriffs hinsichtlich der Frage, ob der Patient als Objekt oder Subjekt betrachtet wird. Der Begriff der Compliance wird in diesem Kontext erläutert und die ethischen und sozialen Aspekte dieser Betrachtungsweise diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Zum Begriff und seiner Geschichte (inkl. Vorgeschichte und dem ersten Auftreten des Begriffs), „Ersatzbegriffe“, Objekt oder Subjekt - Begriffsimplikationen und Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Patient, Patientbegriff, Krankheitsbegriff, Mittelalter, Neuzeit, Sprache, soziale Ausgrenzung, Klient, Kunde, Compliance, Medizinhistorie, Verobjektivierung, Subjekt, Objekt.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Mediziner, Pflegekräfte und alle, die sich für die Geschichte der Medizin, die Entwicklung medizinischer Begriffe und die Arzt-Patienten-Beziehung interessieren.
- Arbeit zitieren
- Mario Albrecht (Autor:in), 2004, Der Patient? - der Klient? - der Kunde? Die historische Entwicklung des Patientenbegriffs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40990