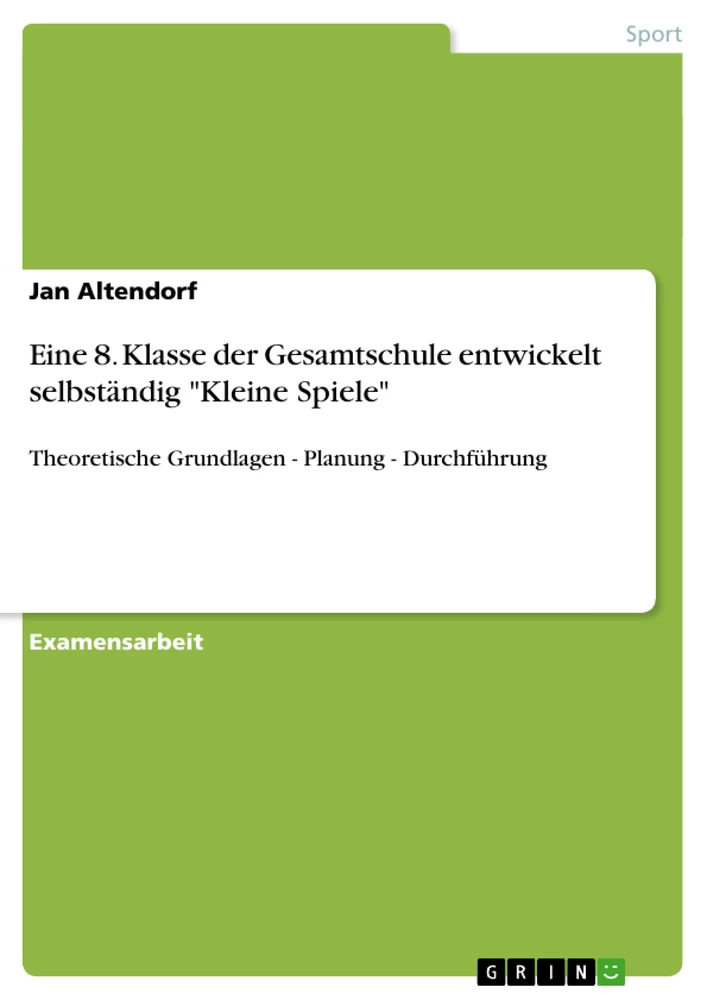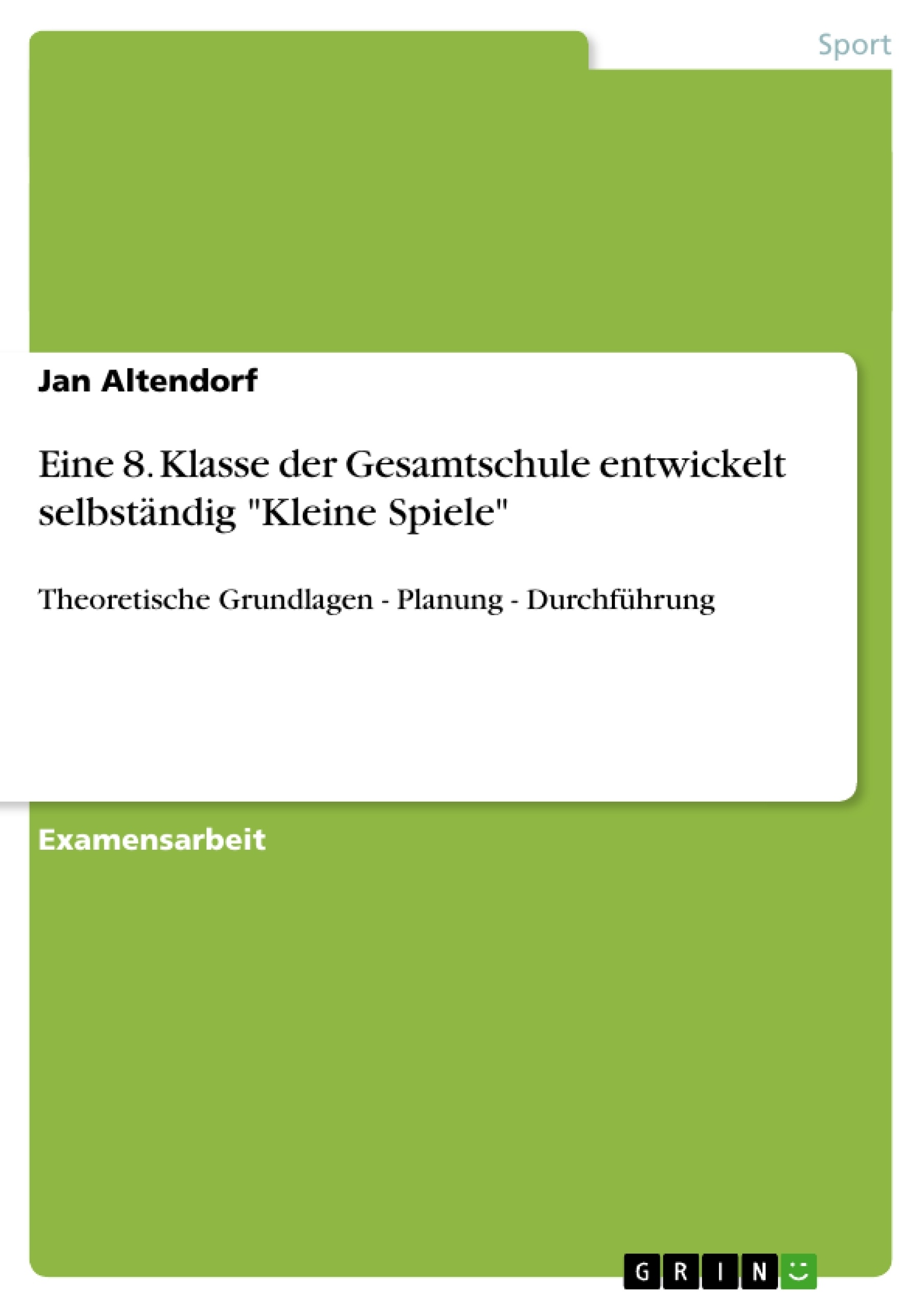Die Entwicklungsbedingungen heutiger Kinder und Jugendlicher haben sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Dies wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus und zeigt sich auch in einem veränderten Spiel- und Bewegungsverhal-ten. Es betrifft vor allem die Qualität des Spielens. Früher wurde gemeinsam mit anderen auf der Straße oder auf dem Hinterhof gespielt. Es dominierten bewe-gungsintensive (Sport-)Spiele. Das gemeinsame Spielen leistete einen wichtigen Beitrag zur Sozialisation und kam dem Bewegungsdrang der Kinder und Jugend-lichen nach. Heute spielen Kinder und Jugendliche anders. Die Gründe dafür liegen in den veränderten Lebensbedingungen.
Insgesamt ist es heutzutage zu einer Verstümmelung der Spielkultur gekommen. Die negativen Folgen sind mangelnde Selbständigkeit, Eigenverantwortung, Ei-gentätigkeit, Teamfähigkeit und Kreativität. Das Paradoxe ist, dass gerade diese Fähigkeiten in der heutigen Gesellschaft in besonderem Maße gefordert werden. Daher muss die Schule diesen Tendenzen entgegentreten. Gerade der Sportunterricht kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, wenn neben Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit auch Selbständigkeit, Mitgestaltung, Kreativität, Spaß an der Bewegung, Fairness und Methodenkompetenz gefördert werden.
Im Rahmen der hier vorgestellten Unterrichtseinheit entwickeln die Schüler selb-ständig und eigenverantwortlich „Kleine Spiele“. Dies geschieht innerhalb eines schüler- und handlungsorientierten Unterrichts. Die Schüler arbeiten konstruktiv und kreativ in Gruppen zusammen. Ihnen wird dabei ein hohes Maß an Eigentätigkeit, Mitbestimmung und Mitgestaltung am Unterricht eingeräumt. Insofern werden dabei Schlüsselkompetenzen wie Selbständigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit und Eigenverantwortung gefördert. Auf diese Weise möchte ich der Verstümmelung der Spielkultur entgegentreten und den Schülern Kompetenzen vermitteln, die sie später in Beruf und Gesellschaft benötigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Das Spiel
- Das Sportspiel
- Spielen im Sport
- Kleine Spiele
- Spielregeln
- Spielgeräte
- Planung der Unterrichtseinheit
- Anthropogene und soziokulturelle Voraussetzungen
- Situation der Klasse
- Entwicklungsvoraussetzungen
- Lernvoraussetzungen
- Rahmenbedingungen
- Didaktische Analyse
- Unterrichtsziele
- Methodische Analyse
- Sportspielvermittlung
- Das Genetische Spielkonzept
- Anthropogene und soziokulturelle Voraussetzungen
- Durchführung der Unterrichtseinheit
- Die erste Doppelstunde: Erarbeitung theoretischer Grundlagen
- Die zweite Doppelstunde: Entwicklung der Spiele
- Die dritte Doppelstunde: Ausprobieren und präsentieren der Spiele
- Die vierte Doppelstunde: Abschlussturnier, Wahl des Klassenspiels, Schülerfeedback
- Schlussbetrachtung
- Auswertung des Fragebogens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung selbständig erstellter „Kleiner Spiele“ in einer 8. Klasse der Gesamtschule im Rahmen eines schüler- und handlungsorientierten Unterrichts zu beschreiben. Dabei wird die Förderung von Schlüsselkompetenzen wie Selbständigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit und Eigenverantwortung in den Vordergrund gestellt.
- Entwicklung und Bedeutung von „Kleinen Spielen“
- Didaktische Ansätze und methodische Vorgehensweisen im Sportunterricht
- Die Förderung von Schlüsselkompetenzen im Kontext von Spiel und Bewegung
- Die Bedeutung von anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen
- Reflexion der Unterrichtseinheit und deren Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit den veränderten Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen in der heutigen Zeit. Dabei werden die Folgen der zunehmenden Mediatisierung und Verinselung der Lebensräume für das Spiel- und Bewegungsverhalten analysiert. Der Einfluss dieser Entwicklungen auf die Spielkultur und die Notwendigkeit, diesen Tendenzen im Sportunterricht entgegenzutreten, werden beleuchtet.
- Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Entwicklung von „Kleinen Spielen“ erörtert. Es werden die Merkmale des Spiels, des Sportspiels und der Kleinen Spiele erläutert, sowie der Begriff der Spielidee und die allgemeine und spezielle Spielfähigkeit. Weiterhin werden die verwendeten Spielgeräte vorgestellt und die Bedeutung von Spielregeln behandelt.
- Kapitel drei widmet sich der Planung der Unterrichtseinheit. Hier werden die anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzungen der Schüler, die Situation der Klasse, deren Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen sowie die didaktische Analyse und die Unterrichtsziele beschrieben. Zudem wird die methodische Analyse der Einheit mit Fokus auf die Sportspielvermittlung und das genetische Spielkonzept dargestellt.
- Das vierte Kapitel beschreibt die praktische Durchführung der Unterrichtseinheit in vier Doppelstunden. Es werden die methodischen Überlegungen, Unterrichtsziele und Reflexionen der einzelnen Unterrichtseinheiten erläutert. Die Schüler erarbeiten zunächst die theoretischen Grundlagen, entwickeln dann selbständig „Kleine Spiele“, die anschließend ausprobiert und präsentiert werden. Die Einheit endet mit einem Abschlussturnier, der Wahl des Klassenspiels und der Einholung von Schülerfeedback.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen „Kleine Spiele“, „Selbstständiges Lernen“, „Schlüsselkompetenzen“, „Sportspielvermittlung“, „Genetisches Spielkonzept“ und „anthropogene und soziokulturelle Voraussetzungen“ im Rahmen eines schüler- und handlungsorientierten Unterrichts in einer 8. Klasse der Gesamtschule.
- Quote paper
- Jan Altendorf (Author), 2005, Eine 8. Klasse der Gesamtschule entwickelt selbständig "Kleine Spiele", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40644