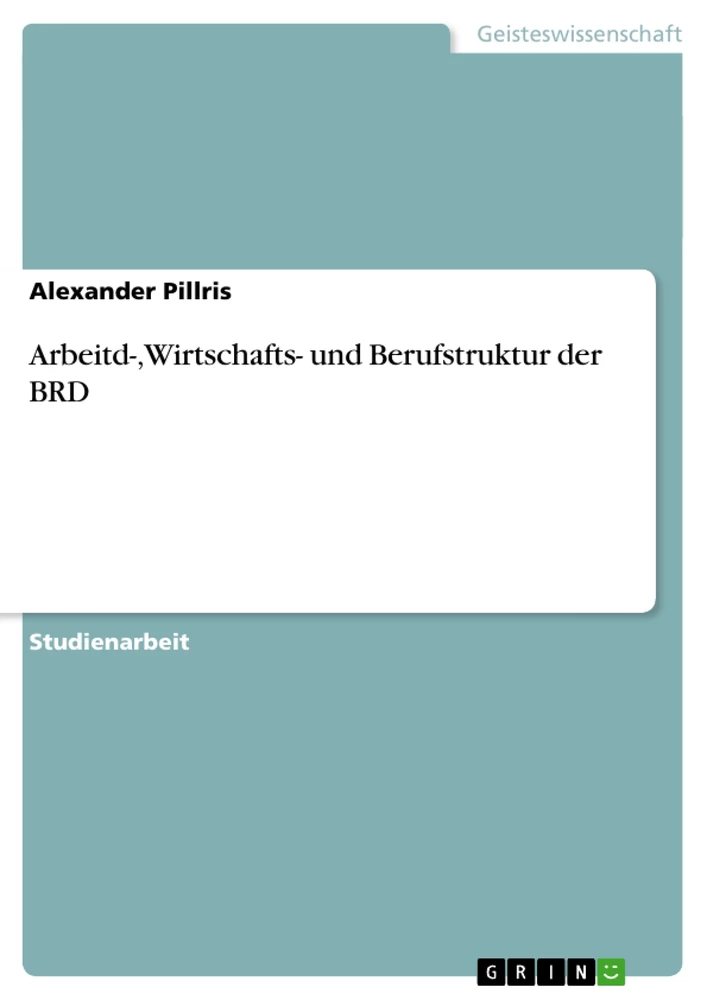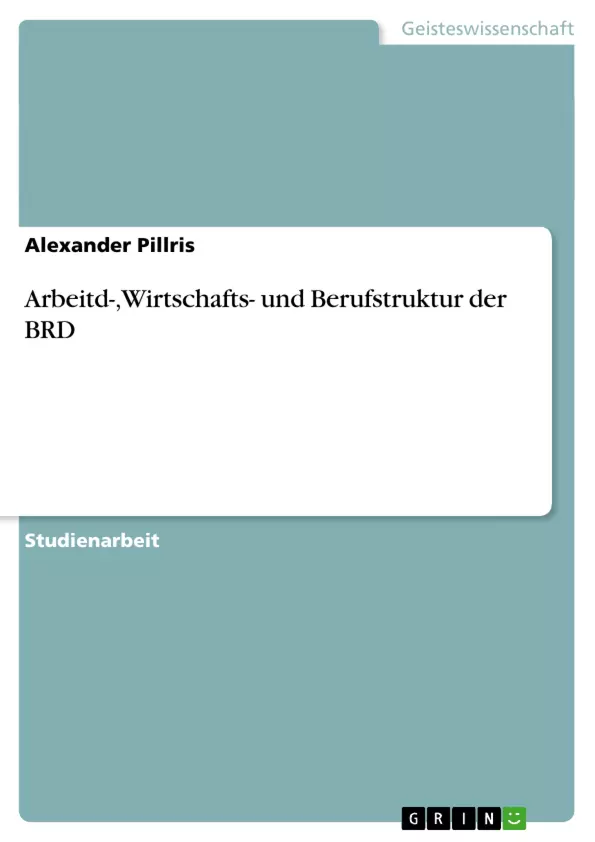Arbeit, Wirtschafts- und Berufsstruktur sind untrennbar miteinander verwoben und bedingen einander. Der Mensch definiert durch die ausgeübte Tätigkeit seinen Platz in der Gesellschaft.1 Diese nur auf den ersten Blick sehr eingängige Formulierung ist in der soziologischen Diskussion seit etwa 20 Jahren einer tiefgehenden Differenzierung und Diskussion unterworfen und trifft auch auf Widerstand.2 „Was machen Sie beruflich?“ Diese vo m Autor in oftmals durchaus harmloser Absicht gestellte Frage führt zu unterschiedlichen Reaktionen: Vom stolzen „ich bin Prokurist bei einer Bank“ hin zu einem verschämten „ich bin zur Zeit arbeitslos“; von „ich lehne Arbeit als Ausbeutung durch das kapitalistische System ab“ bis zum frechen „ich bin von Beruf Sohn“. Bei genauerer Betrachtung der Antworten wird deutlich, dass die Begriffe „Arbeit“ und „Beruf“ von verschiedenen Personen offenbar unterschiedlich und zunehmend subjektiv interpretiert werden. Bezieht man nun die in Mode gekommenen Differenzierungen wie „Beziehungsarbeit“ oder „Unterscheidungsarbeit“ in die Betrachtung ein, wird offensichtlich, dass oben angeführte Alltagsformulierung der heutigen Realität nicht mehr gerecht wird. Es scheint vielmehr einen Trend zu geben, der von dem Blickwinkel „Erwerb“ immer weiter weg führt, und Arbeit mehr aus der Perspektive der „Selbstverwirklichung“ betrachtet wissen will. Ich werde, ausgehend von einer historischen Betrachtung der Begriffe „Arbeit“ und „Beruf“ und einer – problematischen – modernen Definition dieser Begriffe (Punkt B) vor dem Hintergrund dieses Trends · zunächst die aktuelle Arbeits-, Wirtschafts- und Berufsstruktur der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Entwicklung makroökonomisch beschreiben (Punkt C), · sodann die soziologische Diskussion zwischen „Weiterbestehen der Arbeit“ und „Ende der Arbeit“ darstellen (Punkt D), · diese Diskussion dann anhand der These der „subjektbezogenen Ansprüche an Arbeit“ einer Synthese zuführen (Punkt D), diese empirisch unterfüttern und Erklärungsmöglichkeiten für diesen Wertewandel aufzeigen (Punkt E), · und zuletzt einen Ausblick auf die Neubestimmung des Verhältnisses von Arbeit und Leben in der Zukunft geben (Punkt F) 1 eigene Formulierung 2 vgl. Jäger, Wieland (1997). Arbeits- und Berufssoziologie. In: Korte, He., Schäfers, B. (Hg.), Einführung in Praxisfelder der Soziologie, Opladen: Leske + Budrich, S. 112.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- B Arbeit und Beruf – begriffsgeschichtlicher Überblick (n. Rudolph Walther)
- C Strukturwandel der Erwerbstätigkeit – Makrobetrachtung (n. G. Wilke)
- a) Grundlinie des sektoralen Wandels: die 4-Sektoren-Hypothese
- b) Entwicklung und Ist-Zustand – Deskripitive Betrachtung
- D Arbeit und Beruf in der Soziologie - Mikrobetrachtung
- a) Ausgangspunkt: „Arbeit“ / „Beruf“ im Kapitalismus (n. Breckenbach)
- b) Arbeit als Zentralmoment des modernen Menschen (n. Marie Jahoda)
- c) Das Ende der Arbeit?
- d) Wiederkehr der Arbeit!
- e) Synthese: subjektbezogene Ansprüche an Arbeit (n. Martin Baetghe)
- E Wandel der Arbeitsauffassung (nach Peter Pawlowsky)
- F Ausblick: Neubestimmung des Verhältnisses von Arbeit und Leben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Wandel der Arbeits-, Wirtschafts- und Berufsstruktur in Deutschland. Sie untersucht die historische Entwicklung des Arbeitsbegriffs und die soziologischen Debatten um das „Ende der Arbeit“ und die „Wiederkehr der Arbeit“. Die Arbeit analysiert die aktuellen Entwicklungen im Sektoralen Wandel und die Bedeutung von Arbeit für die Selbstverwirklichung des modernen Menschen.
- Historische Entwicklung des Arbeitsbegriffs
- Strukturwandel der Erwerbstätigkeit
- Soziologische Debatten um das „Ende der Arbeit“ und die „Wiederkehr der Arbeit“
- Die Bedeutung von Arbeit für die Selbstverwirklichung
- Aktuelle Entwicklungen im Sektoralen Wandel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas „Arbeit, Wirtschafts- und Berufsstruktur“ dar und erläutert den Forschungsstand. Sie betont, dass die Bedeutung von Arbeit in der heutigen Gesellschaft zunehmend subjektiv interpretiert wird und von dem Blickwinkel „Erwerb“ immer weiter weg führt. Die Arbeit beschäftigt sich mit diesem Trend und will die aktuelle Arbeits-, Wirtschafts- und Berufsstruktur makroökonomisch beschreiben, die soziologische Diskussion um die Zukunft der Arbeit darstellen und diese mit dem Konzept der „subjektbezogenen Ansprüche an Arbeit“ synthetisieren.
Kapitel B gibt einen begriffsgeschichtlichen Überblick über „Arbeit“ und „Beruf“ nach Rudolph Walther. Es analysiert die negative Konnotation des Arbeitsbegriffs in der Antike und seine Entwicklung im Mittelalter und in der Neuzeit. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Arbeit für die Selbsterhaltung und die Bedeutung des Arbeitsbegriffs für die moderne Wirtschaftstheorie.
Kapitel C beschäftigt sich mit dem Strukturwandel der Erwerbstätigkeit. Es beleuchtet die 4-Sektoren-Hypothese und die Entwicklung des Sektoralen Wandels in Deutschland. Der Fokus liegt auf der deskriptiven Betrachtung der Entwicklung des Primär-, Sekundär- und Tertiärsektors.
Kapitel D widmet sich der soziologischen Diskussion um die Zukunft der Arbeit. Es analysiert die Positionen von Breckenbach, Jahoda und Baetghe und stellt die Argumente für und gegen das „Ende der Arbeit“ dar. Das Kapitel führt die verschiedenen Perspektiven auf Arbeit zu einer Synthese, die die „subjektbezogenen Ansprüche an Arbeit“ im Vordergrund stellt.
Kapitel E beleuchtet den Wandel der Arbeitsauffassung nach Peter Pawlowsky. Es analysiert die unterschiedlichen Sichtweisen auf Arbeit und die Bedeutung von Selbstverwirklichung und Lebensqualität.
Kapitel F bietet einen Ausblick auf die Neubestimmung des Verhältnisses von Arbeit und Leben in der Zukunft. Es beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der modernen Arbeitswelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Arbeit, Beruf, Arbeitsstruktur, Wirtschaftsstruktur, Strukturwandel, Sektoraler Wandel, Selbstverwirklichung, Lebensqualität, „Ende der Arbeit“, „Wiederkehr der Arbeit“, subjektbezogene Ansprüche an Arbeit, protestantische Arbeitsethik, Soziologie, Makroökonomie, Mikroökonomie, historischer Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die 4-Sektoren-Hypothese zum Strukturwandel?
Sie beschreibt die Verschiebung der Erwerbstätigkeit vom primären Sektor (Landwirtschaft) über den sekundären (Industrie) zum tertiären (Dienstleistung) und quartären Sektor (Information).
Wie hat sich der Begriff der „Arbeit“ historisch verändert?
Die Arbeit analysiert den Wandel von der negativen Konnotation in der Antike bis hin zum modernen Verständnis von Arbeit als Mittel der Selbstverwirklichung.
Gibt es ein „Ende der Arbeit“?
Die soziologische Diskussion stellt Positionen zum vermeintlichen Ende der Erwerbsarbeit den Thesen einer „Wiederkehr der Arbeit“ gegenüber.
Welche Bedeutung hat Arbeit für die Identität?
Traditionell definiert der Mensch seinen Platz in der Gesellschaft über seinen Beruf, was heute jedoch zunehmend subjektiv und differenziert interpretiert wird.
Was sind „subjektbezogene Ansprüche an Arbeit“?
Dies beschreibt den Trend, dass Arbeit weniger als reine Existenzsicherung und stärker unter dem Aspekt der persönlichen Entfaltung und Lebensqualität gesehen wird.
- Arbeit zitieren
- Alexander Pillris (Autor:in), 2005, Arbeitd-, Wirtschafts- und Berufstruktur der BRD, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40410