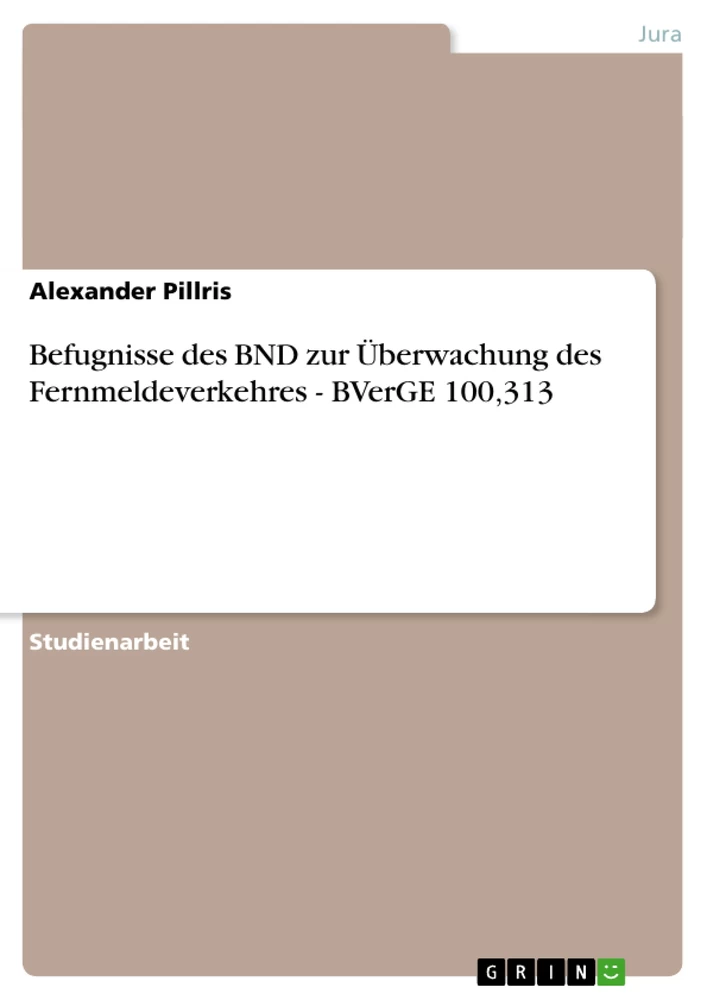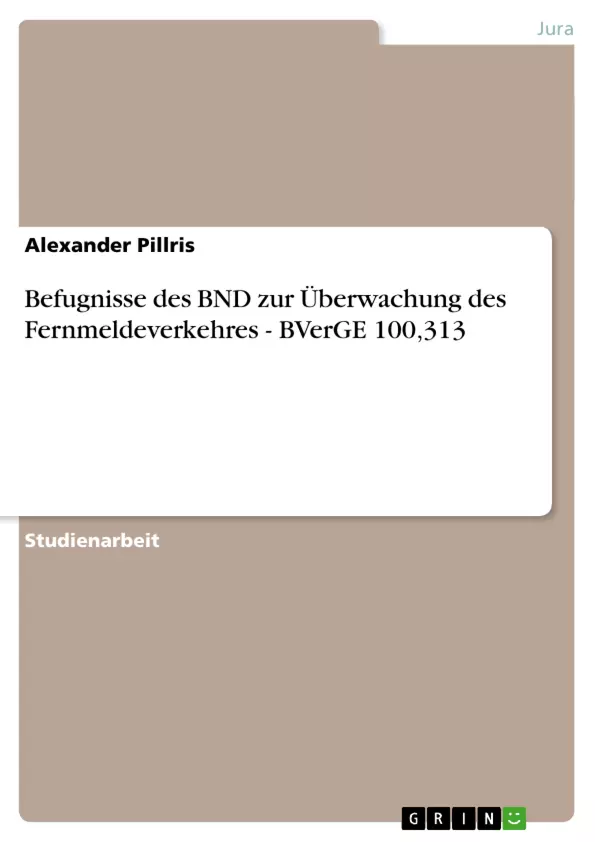Staatliche Macht einerseits und die Freiheit der Bürger andererseits standen sich von jeher sich seit Anbeginn nicht nur der modernen Staatlichkeit antagonistisch gegenüber. Vor Aufkommen der Aufklärung war der Staatsbürger lediglich Objekt staatlicher Machtausübung ohne eigene Rechte. Ein entsprechendes Übergewicht hatte demzufolge auch staatliches Eingreifen gegenüber dem Recht des Einzelnen. Im ausgehenden Mittelalter spiegelt sich dieser Sachverhalt auch im Verhältnis zwischen der „Polizey“ (von griechisch: „polis“ = „Gemeinschaft, Stadt, Staat“) und dem Bürger wieder. Vor dem Aufkommen der Idee der Gewaltenteilung war die Polizey als Inbegriff aller staatlichen Tätigkeit gegenüber dem Einzelnen prinzipiell immer im Recht, es existierten keine einklagbaren Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem – im absoluten Herrscher verkörperten - Staat.
Mit Aufkommen der Aufklärung verbesserte sich die Balance etwas: Der aufgeklärte Herrscher verkörperte nun nicht mehr den Staat, er wurde vielmehr zum „ersten Diener“ des Staates und band sich damit selbst an gewisse Grundregeln. Diese Bindung staatlicher Macht implizierte gleichzeitig, dass der Staat gegenüber dem Bürger auch nicht mehr vollkommen losgelöst von jeder Ordnung auftreten konnte. Im aufgeklärten Absolutismus wurde der Bürger vom bloßen Objekt nun zum Subjekt patriarchalisch-strenger Fürsorge durch den Landesherrn. Der Bürger verfügte nun über grundlegende Rechte (aber mehr im Sinne eines moralischen Anspruchs denn als „harte“ justiziable Rechte). Der Polizey-Begriff wandelte sich entsprechend. Er wurde nicht mehr global für jede staatliche Tätigkeit gebraucht, sondern ganz im Sinne streng-hausväterlicher Güte im Kontext der Gefahrenabwehr und der Wohlfahrtspflege. An der gedanklichen Verschränkung von Recht und Polizey änderte sich jedoch nichts.
Inhaltsverzeichnis
- A Das Verhältnis von Bürger und Strafverfolgung – Schranken der Gefahrenabwehr
- I. Historischer Blick: Staatsmacht, „Polizey“ und bürgerliche Freiheit
- II. Strafverfolgung: strafprozessuale Prinzipien als normatives Paradigma
- B Der BND und das „Gesetz zu Art. 10 GG – G 10“ contra BVerfG bis 1984
- I. Der Auftrag des BND und Abgrenzung zur Polizei
- II. Das G 10 – Herkunft und Inhalt
- III. Die „erste (I) Abhörentscheidung“ des BVerfG 1970
- IV. Die „zweite (II) Abhörentscheidung“ des BVerfG 1984
- C Die „dritte (III) Abhörentscheidung“ des BVerfG (14.07.1999)
- I. Die Novellierung des G 10 durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz (1994)
- II. Die Beschwerde der Beschwerdeführer
- III. Die Entscheidung des BVerfG („dritte Abhörentscheidung“) vom 14.07.1999
- 1. Zulässigkeit (nur problematische Punkte)
- 2. Begründetheit der Verfassungsbeschwerde
- a) Betroffenheit von Grundrechten
- b) Verletzung der einschlägigen Grundrechte
- 3. Ergebnis
- IV. Eine kritische Bewertung der Entscheidung
- D Kritische Betrachtung: Die Reaktion des Gesetzgebers auf die III. Abhörentscheidung
- I. Überwachung extremistischer Einzeltäter und Kleingruppen
- II. Strategische Kontrolle bei Krisensituationen im Ausland
- III. Zweckbindung von G 10-Daten
- IV. Kennzeichnung von G 10-Daten
- V. Mitteilung an Betroffene
- E Fazit: Die III. Abhörentscheidung und das Trennungsgebot mit föderalem Ansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND) zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs im Lichte des BVerfGE 100, 313 („dritte Abhörentscheidung“). Ziel ist es, die Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu diesem Thema nachzuvollziehen und die Auswirkungen auf die Praxis zu analysieren.
- Entwicklung der Rechtsprechung des BVerfG zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs durch den BND
- Abwägung zwischen dem Schutz der Grundrechte und der Notwendigkeit der Geheimdiensttätigkeit
- Auswirkungen der „dritten Abhörentscheidung“ auf die Gesetzgebung und Praxis
- Das Verhältnis von Bürgerrechten und staatlicher Überwachung im Kontext der Gefahrenabwehr
- Kritische Bewertung der Rechtslage und ihrer Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
A Das Verhältnis von Bürger und Strafverfolgung – Schranken der Gefahrenabwehr: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Wandel des Verhältnisses zwischen staatlicher Macht und bürgerlicher Freiheit, beginnend mit dem ausgehenden Mittelalter und der „Polizey“ bis zum modernen Verständnis des Rechtsstaates. Es analysiert die Entwicklung von einem Zustand, in dem der Bürger lediglich Objekt staatlicher Willkür war, hin zu einem System mit einklagbaren Abwehrrechten. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zwischen präventiver Gefahrenabwehr und repressiver Strafverfolgung, und wie sich diese im Laufe der Geschichte verschoben hat. Der Übergang vom „absoluten Herrscher“ zum „ersten Diener des Staates“ und die zunehmende Bedeutung der Gewaltenteilung werden ebenfalls thematisiert. Der Text zeigt die Entwicklung des Polizey-Begriffs und die zunehmende Betonung individueller Freiheiten im bürgerlichen Liberalismus auf. Die Bedeutung der Gewaltenteilung und die ideelle Trennung von Polizei und Justiz werden als wichtige Errungenschaften hervorgehoben, die bis heute die Beziehung zwischen Staat und Bürger prägen.
B Der BND und das „Gesetz zu Art. 10 GG – G 10“ contra BVerfG bis 1984: Dieses Kapitel beschreibt den Auftrag des BND und seine Abgrenzung von Polizei und anderen staatlichen Organen. Es behandelt die Entstehung und den Inhalt des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10) sowie die ersten beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den BND-Befugnissen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Rechtsprechung und der Herausforderungen bei der Abwägung von nationalen Sicherheitsinteressen und dem Schutz individueller Grundrechte. Die Kapitel analysiert die rechtlichen Grundlagen und die Gerichtsentscheidungen, die die Befugnisse des BND bis 1984 definierten und die Spannungsfelder zwischen den Aufgaben des BND und den Grundrechten der Bürger aufzeigen.
C Die „dritte (III) Abhörentscheidung“ des BVerfG (14.07.1999): Dieses Kapitel analysiert eingehend die dritte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs durch den BND. Es untersucht die Novellierung des G 10 durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz von 1994 und die Argumente der Beschwerdeführer. Die Entscheidung des BVerfG wird detailliert dargestellt, einschließlich der Prüfung der Zulässigkeit und der Begründetheit der Verfassungsbeschwerde. Der Text untersucht die Betroffenheit von Grundrechten und deren Verletzung im Kontext der BND-Überwachung. Die kritische Bewertung der Entscheidung beleuchtet die rechtlichen und politischen Implikationen des Urteils für die Praxis der Nachrichtendienste.
D Kritische Betrachtung: Die Reaktion des Gesetzgebers auf die III. Abhörentscheidung: Dieses Kapitel evaluiert die Reaktion des Gesetzgebers auf die „dritte Abhörentscheidung“. Es beleuchtet die Herausforderungen bei der Überwachung extremistischer Einzeltäter und Kleingruppen sowie bei der strategischen Kontrolle in Krisensituationen im Ausland. Der Text analysiert die gesetzlichen Regelungen zur Zweckbindung und Kennzeichnung von G 10-Daten und die Mitteilungspflichten an Betroffene. Es geht um die praktische Umsetzung der rechtlichen Vorgaben im Kontext der nationalen Sicherheit und den Schutz individueller Rechte.
Schlüsselwörter
Bundesnachrichtendienst (BND), Überwachung des Fernmeldeverkehrs, BVerfGE 100, 313 („dritte Abhörentscheidung“), Grundrechte, Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10), Gefahrenabwehr, Datenschutz, Verfassungsrecht, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: "Der BND und die Überwachung des Fernmeldeverkehrs im Lichte des BVerfGE 100, 313"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND) zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs, insbesondere im Kontext der dritten Abhörentscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 100, 313). Sie untersucht die Entwicklung der Rechtsprechung des BVerfG zu diesem Thema und deren Auswirkungen auf die Praxis.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Bürger und Strafverfolgung, den Auftrag des BND und dessen Abgrenzung zur Polizei, die Entstehung und den Inhalt des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10), die drei wichtigen Abhörentscheidungen des BVerfG (1970, 1984 und 1999), die Reaktion des Gesetzgebers auf die dritte Abhörentscheidung und eine kritische Bewertung der Rechtslage und ihrer Implikationen für den Datenschutz und die Grundrechte.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel A beleuchtet das historische Verhältnis von Bürger und Strafverfolgung; Kapitel B behandelt den BND und das G 10 bis 1984, einschließlich der ersten beiden Abhörentscheidungen des BVerfG; Kapitel C analysiert detailliert die dritte Abhörentscheidung von 1999; Kapitel D befasst sich mit der Reaktion des Gesetzgebers auf diese Entscheidung; und Kapitel E bietet ein Fazit und betrachtet das Trennungsgebot mit föderalem Ansatz.
Welche Rechtsquellen werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere die drei Abhörentscheidungen, sowie auf das Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10) und dessen Novellierungen. Sie bezieht sich auf die Entwicklung des deutschen Verfassungsrechts und die damit verbundene Abwägung zwischen Grundrechten und staatlichen Sicherheitsinteressen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Entwicklung der Rechtsprechung zum Thema Überwachung des Fernmeldeverkehrs durch den BND, die Abwägung zwischen Grundrechten und Geheimdiensttätigkeit, die Auswirkungen der dritten Abhörentscheidung auf Gesetzgebung und Praxis, sowie das Verhältnis von Bürgerrechten und staatlicher Überwachung im Kontext der Gefahrenabwehr. Sie enthält eine kritische Bewertung der Rechtslage und ihrer Implikationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Bundesnachrichtendienst (BND), Überwachung des Fernmeldeverkehrs, BVerfGE 100, 313 („dritte Abhörentscheidung“), Grundrechte, Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz (G 10), Gefahrenabwehr, Datenschutz, Verfassungsrecht, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung.
- Arbeit zitieren
- Alexander Pillris (Autor:in), 2005, Befugnisse des BND zur Überwachung des Fernmeldeverkehres - BVerGE 100,313, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40409