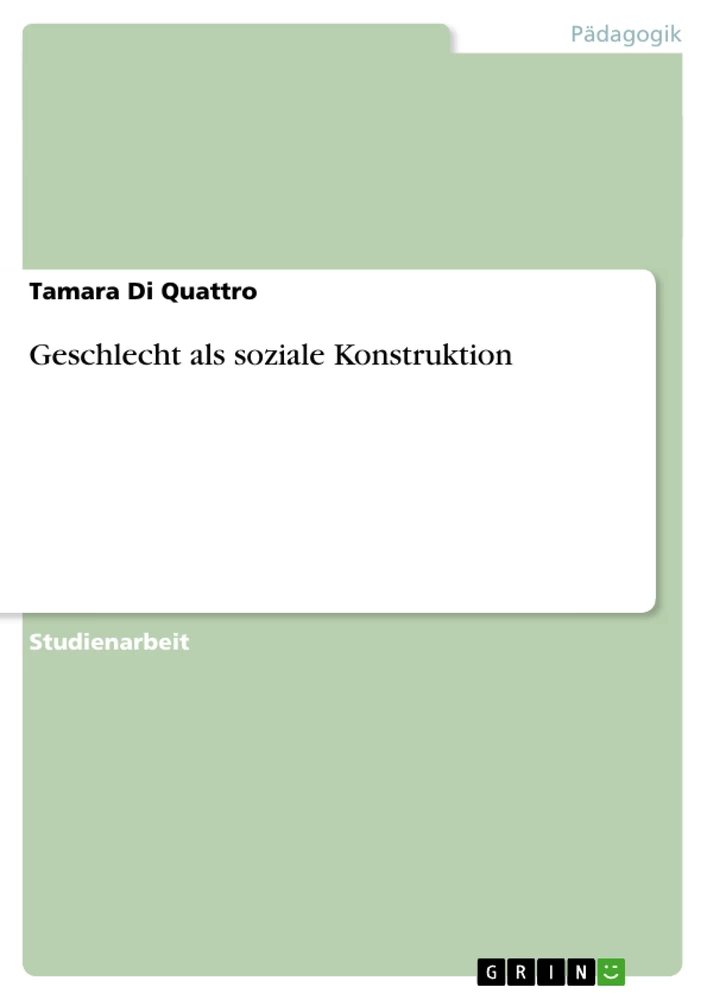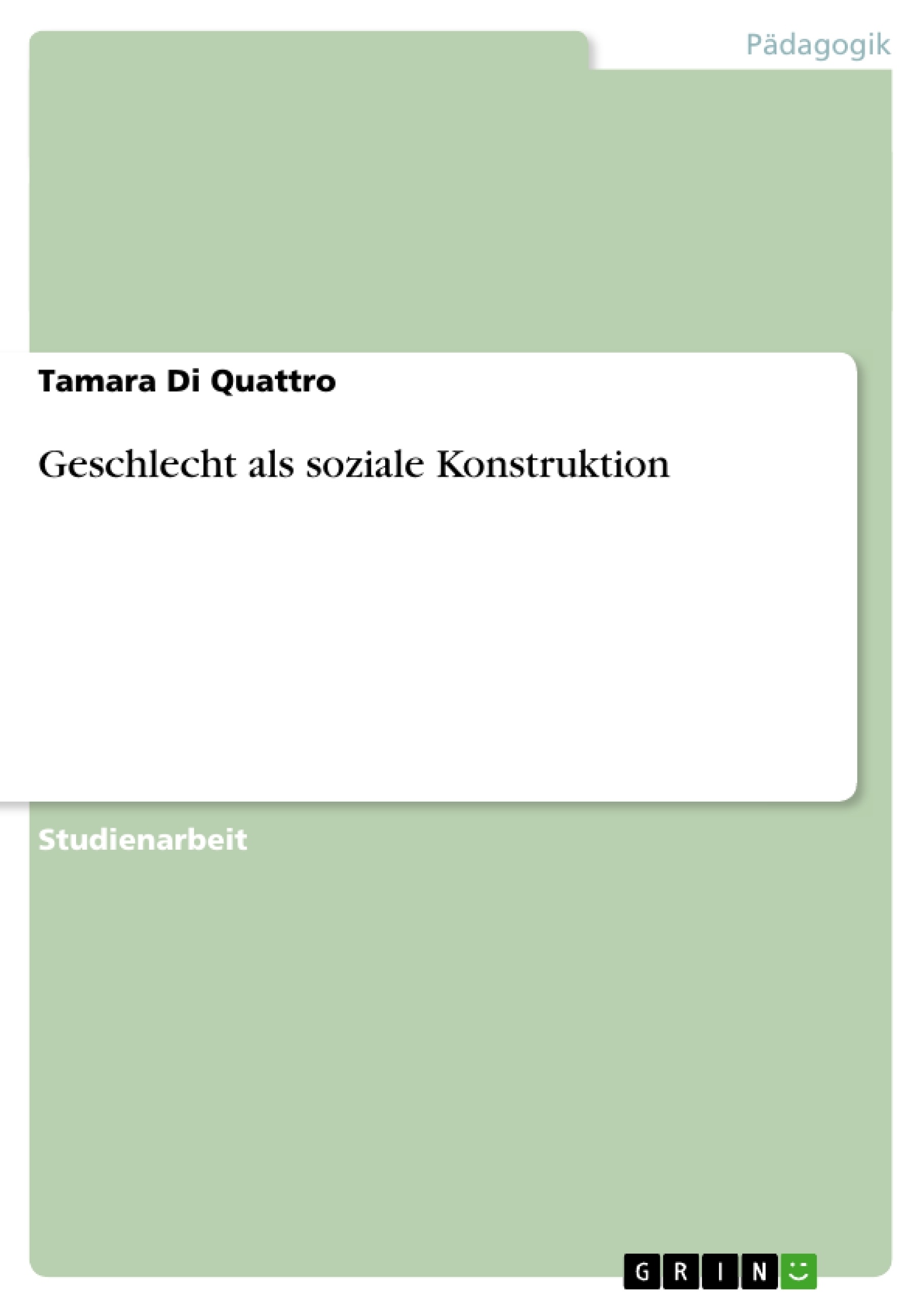Woran man denkt, wenn man den Begriff 'Geschlecht' hört, ist klar zu bestimmen. Wir assoziieren ihn unmittelbar mit zwei Kategorien, mit männlich und mit weiblich. Eine andere Zuordnung ist uns eher fremd. Die Frage, welchem der beiden Geschlechter man angehört, erübrigt sich meist bei zwischenmenschlichen Begegnungen, denn wir haben in der Regel eindeutige Zeichen für das Mann- bzw. Frausein. Dies sind nicht nur körperliche Merkmale, sondern das Geschlecht spiegelt sich ebenso im Verhalten, im Ausdruck und vielem Anderen wider. Dadurch ist es im Regelfall direkt zu bestimmen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Geschlecht als soziale Konstruktion, wobei die 'Natürlichkeit' des Geschlechts, nämlich das, wovon wir annehmen, es sei angeboren, eine andere Bedeutung bekommt. Das Geschlecht wird aus soziologischer Sicht betrachtet.
Wie werden Mädchen und Jungen behandelt? Welche Erwartungen werden an sie gestellt? Wie verhalten sich Erwachsene gegenüber Kindern unterschiedlichen Geschlechts? Und vor allem: mit welchen Auswirkungen? Diesen Fragen soll im ersten Teil dieser Arbeit nachgegangen werden.
Der zweite Teil befasst sich vor allem mit der Frage, was Menschen tun, um ihr Geschlecht zu verkörpern. Hierzu werden zunächst verschiedene Ansätze vorgestellt und darauf wird beschrieben, wie das Geschlecht innerhalb von Interaktionen dargestellt wird.
Die vorliegende Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung aus pädagogischer Sicht, die Folgerungen für die Erziehung beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung / Hinführung zum Thema
- Teil 1: Mädchen und Jungen im Sozialisationsprozess / „Making gender“
- 1. Zu den Begriffen „sex“ und „gender“
- 2. Feministische Ansichten und Biologismus
- 3. Erziehung / Sozialisation
- 3.1 Über Geschlechterdifferenzen (Untersuchungen)
- 3.2 Geschlechtsrelevante Erlebnisse und Geschlechtsetikettierung
- 4. Sozialisation als Abrichtung / Naturalisierung als Legitimation zur Ausbeutung von Frauen
- Teil 2: „Doing gender“
- 5. Feministische Mikrosoziologie und relevante Ansätze
- 5.1 Der Goffmannsche Ansatz
- 5.2 Garfinkels Ethnomethodologie
- 6. Transexuellenforschung
- 6.1 Garfinkels „Agnes-Studie“
- 6.2 Kessler und McKenna
- 7. Alltagswissen und Geschlechterdichotomie
- 8. Interaktive Konstruktion von Geschlecht
- 8.1 Geschlechtsdarstellung („ich stelle mein Geschlecht dar“)
- 8.2 Ressourcen
- 8.3 Geschlechtsattribution („ich mache dich zu einem Geschlecht“)
- 9. Stabilisierende Faktoren der Geschlechterdifferenz
- 10. Geschlecht und soziale Ungleichheit / Doing gender und doing inequality
- 5. Feministische Mikrosoziologie und relevante Ansätze
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Geschlecht als soziale Konstruktion, hinterfragt die vermeintliche Natürlichkeit von Geschlechterrollen und analysiert die Prozesse des „Making gender“ und „Doing gender“. Ziel ist es, die sozialen Mechanismen aufzuzeigen, die zur Konstruktion und Aufrechterhaltung von Geschlechterdifferenzen beitragen.
- Die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht (sex) und sozial konstruiertem Geschlecht (gender)
- Der Einfluss von Sozialisation und Erziehung auf die Entwicklung von Geschlechterrollen
- Die mikrosoziologischen Ansätze zur Erklärung von „Doing gender“
- Die Rolle von Interaktionen in der Konstruktion und Darstellung von Geschlecht
- Der Zusammenhang zwischen Geschlecht und sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung / Hinführung zum Thema: Die Einleitung führt in das Thema Geschlecht als soziale Konstruktion ein und stellt die zentrale Frage nach der Entstehung und Aufrechterhaltung von Geschlechterrollen. Sie hebt die scheinbare Selbstverständlichkeit der Zweigeschlechtlichkeit hervor und kündigt die soziologische Perspektive der Arbeit an, welche die "Natürlichkeit" des Geschlechts hinterfragt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, indem sie die Behandlung von Sozialisationsprozessen im ersten Teil und die Analyse interaktiver Geschlechterkonstruktionen im zweiten Teil ankündigt. Die Arbeit endet mit einer pädagogischen Schlussbetrachtung.
Teil 1: Mädchen und Jungen im Sozialisationsprozess / „Making gender“: Dieser Teil befasst sich mit den Prozessen, die dazu führen, dass Individuen zu Geschlechtern sozialisiert werden. Er beginnt mit einer Klärung der Begriffe „sex“ und „gender“, um die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht zu etablieren. Im Anschluss werden feministische Ansichten dem Biologismus entgegengesetzt, der soziale Geschlechterunterschiede allein auf biologische Faktoren zurückführt. Der Teil analysiert den Einfluss von Erziehung und Sozialisation auf die Entwicklung von Geschlechterrollen, wobei empirische Studien zu Geschlechterdifferenzen und die Bedeutung von Geschlechteretikettierung im Sozialisationsprozess beleuchtet werden. Schließlich wird die Sozialisation als ein Prozess der Abrichtung und Naturalisierung von Geschlechterrollen kritisiert, der die Ausbeutung von Frauen legitimiert.
Teil 2: „Doing gender“: Dieser Teil konzentriert sich auf die Frage, wie Menschen aktiv ihr Geschlecht in sozialen Interaktionen darstellen und herstellen („Doing gender“). Er präsentiert verschiedene mikrosoziologische Ansätze, insbesondere den Goffmannschen Ansatz und die Ethnomethodologie Garfinkels, um die interaktive Konstruktion von Geschlecht zu analysieren. Die Transexuellenforschung, mit Beispielen wie Garfinkels „Agnes-Studie“ und den Arbeiten von Kessler und McKenna, liefert wichtige Erkenntnisse über die Performativität von Geschlecht. Der Teil beleuchtet die Rolle von Alltagswissen und der Geschlechterdichotomie, die Geschlechtsdarstellung, die Bedeutung von Ressourcen und die Geschlechtsattribution in sozialen Interaktionen. Abschließend werden stabilisierende Faktoren der Geschlechterdifferenz und der Zusammenhang zwischen „Doing gender“ und sozialer Ungleichheit diskutiert.
Schlüsselwörter
Geschlecht, Gender, Sex, soziale Konstruktion, Sozialisation, Erziehung, Feminismus, Biologismus, Mikrosoziologie, Goffman, Garfinkel, Transexuellenforschung, Interaktion, Geschlechterdifferenz, soziale Ungleichheit, Doing gender, Making gender.
Häufig gestellte Fragen zum Thema: Geschlecht als soziale Konstruktion
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Geschlecht als soziale Konstruktion, hinterfragt die vermeintliche Natürlichkeit von Geschlechterrollen und analysiert die Prozesse des „Making gender“ und „Doing gender“. Ziel ist es, die sozialen Mechanismen aufzuzeigen, die zur Konstruktion und Aufrechterhaltung von Geschlechterdifferenzen beitragen.
Welche zentralen Begriffe werden behandelt?
Zentrale Begriffe sind „sex“ (biologisches Geschlecht) und „gender“ (sozial konstruiertes Geschlecht), Sozialisation, Erziehung, Feminismus, Biologismus, Mikrosoziologie, Interaktion, Geschlechterdifferenz und soziale Ungleichheit. Die Konzepte „Doing gender“ und „Making gender“ stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen ersten Teil („Making gender“ – Sozialisationsprozesse), einen zweiten Teil („Doing gender“ – interaktive Geschlechterkonstruktionen) und eine Schlussbetrachtung. Der erste Teil behandelt die Begriffe „sex“ und „gender“, feministische Ansichten im Gegensatz zum Biologismus, den Einfluss von Erziehung und Sozialisation sowie die Kritik an der Sozialisation als Abrichtung und Naturalisierung von Geschlechterrollen. Der zweite Teil analysiert mikrosoziologische Ansätze (Goffman, Garfinkel), die Transexuellenforschung (Garfinkels „Agnes-Studie“, Kessler und McKenna), Alltagswissen, Geschlechtsdarstellung, -attribution und -ressourcen sowie stabilisierende Faktoren der Geschlechterdifferenz und den Zusammenhang zwischen „Doing gender“ und sozialer Ungleichheit.
Welche Theorien und Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet feministische Ansätze, setzt sich kritisch mit dem Biologismus auseinander und stützt sich auf mikrosoziologische Theorien, insbesondere den Goffmannschen Ansatz und die Ethnomethodologie Garfinkels. Die Transexuellenforschung liefert wichtige empirische Belege.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Hausarbeit zeigt auf, wie Geschlecht durch Sozialisationsprozesse („Making gender“) und interaktive Praktiken („Doing gender“) konstruiert und aufrechterhalten wird. Es wird deutlich, dass die Zweigeschlechtlichkeit kein natürliches Phänomen, sondern ein sozial konstruiertes System ist, das zu sozialer Ungleichheit beiträgt.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen und betont die Bedeutung des Verständnisses von Geschlecht als soziale Konstruktion für die Überwindung von Geschlechterungleichheit. (Der genaue Inhalt der Schlussbetrachtung ist in der Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben.)
Welche Kapitel gibt es?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, einen Teil zu „Making gender“, einen Teil zu „Doing gender“ und eine Schlussbetrachtung. Jeder Teil ist in mehrere Unterkapitel gegliedert, die sich mit spezifischen Aspekten der Geschlechterkonstruktion befassen (siehe Inhaltsverzeichnis im Originaltext).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Geschlecht, Gender, Sex, soziale Konstruktion, Sozialisation, Erziehung, Feminismus, Biologismus, Mikrosoziologie, Goffman, Garfinkel, Transexuellenforschung, Interaktion, Geschlechterdifferenz, soziale Ungleichheit, Doing gender, Making gender.
- Quote paper
- Tamara Di Quattro (Author), 2003, Geschlecht als soziale Konstruktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40342