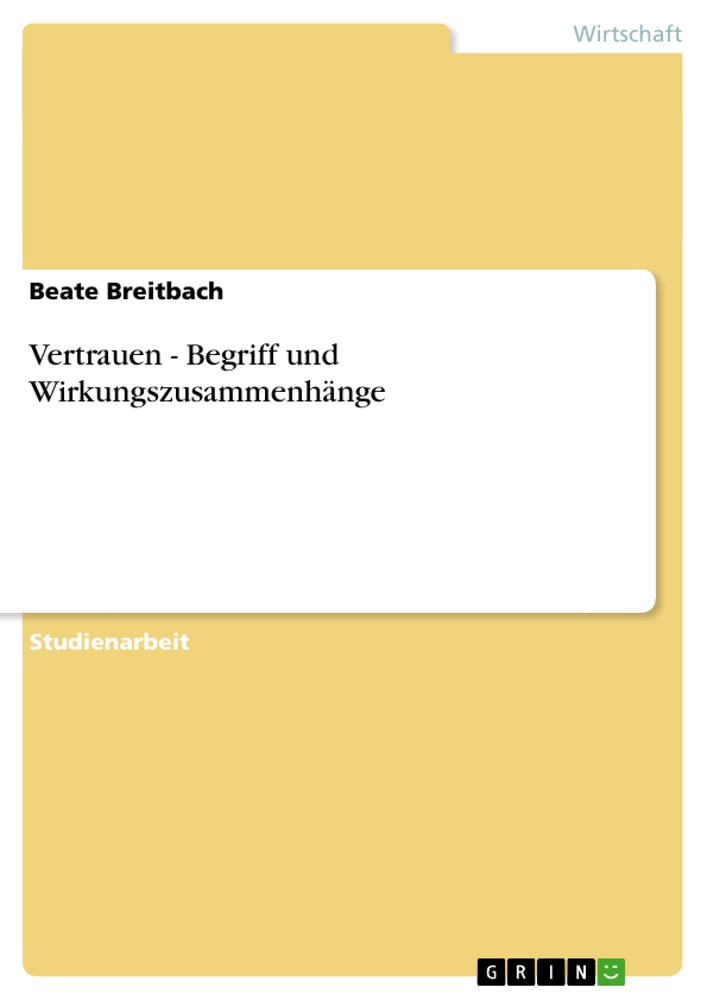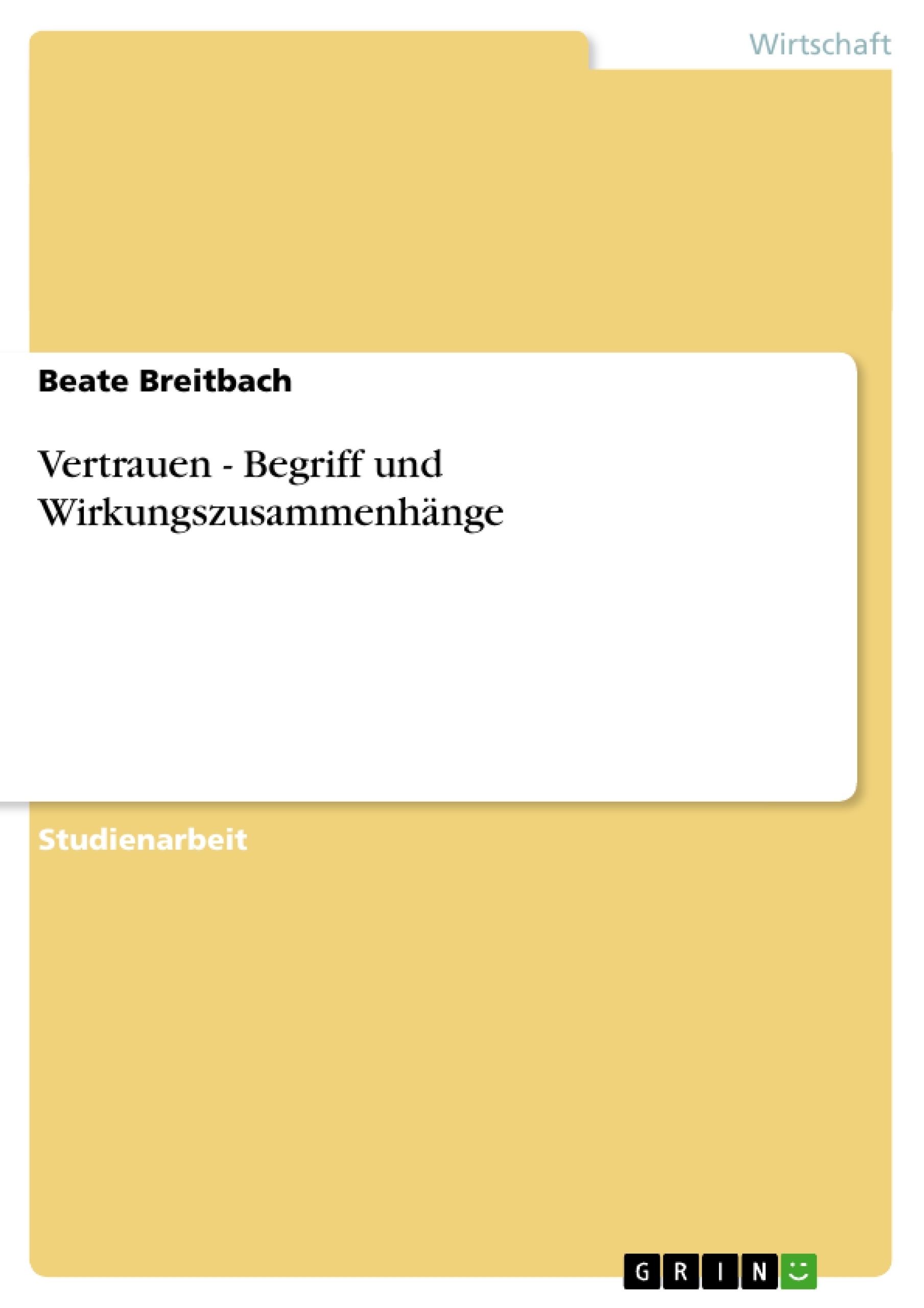Grundlage der Welt ist das Vertrauen. Das stellte schon Hans-Günther Sohl, Ehrenpräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI) fest, als er sagte: „In einer solchen Welt kann man nur zusammenleben, wenn man nicht Misstrauen zur Grundlage seiner menschlichen Handlung macht. Was wir brauchen, ist Mut zum Vertrauen.“1 Diesen Mut bringen viele Bürger im täglichen Leben immer wieder auf, auch gegenüber staatlichen Institutionen. Doch dieses Vertrauen wird immer wieder enttäuscht, immer häufiger kommen Skandale der Politiker ans Tageslicht, die das Vertrauen in den Staat schwächen. Dies geschah zuletzt bei der Entlassung von Florian Gerster, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, dessen Verwaltungsrat ihm aufgrund von Ungereimtheiten bei der Auftrags vergabe von Beraterverträgen das Vertrauen entzogen hatte.2
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, den Begriff des Vertrauens zu definieren und ihn in Zusammenhang zu bringen mit Situationen, in den Vertrauen entsteht. Die Voraussetzungen für Vertrauen werden hierbei erläutert. Im Anschluss daran wird mit Hilfe der Prinzipal-Agenten- Theorie dargestellt, wie sich der Vertrauensgeber und der Vertrauensnehmer verhalten und welche besonderen Probleme mit den Rollen verknüpft sind. Das vierte Kapitel erklärt den Begriff der Reputation und wie dieser im Zusammenhang mit Vertrauen steht. Danach wird auf die Funktionen von Vertrauen eingegangen und ihre Auswirkungen auf den Markt. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit Objekten des Vertrauens, hier wird besonders das Vertrauen in Institutionen und in den Staat dargestellt. Die Ergebnisse aus einer Befragung verdeutlichen hierbei die dargelegten Theorien. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Thematik und Aufbau der Arbeit
- 2. Der Begriff des Vertrauens
- 2.1. Entstehung von Vertrauen
- 2.1.1. Komplexität der Umwelt
- 2.1.2. Vertrauen bei Risiken
- 2.2. Definition von Vertrauen
- 3. Die Prinzipal-Agenten-Theorie im Zusammenhang mit Vertrauen
- 3.1. Die Prinzipal-Agenten-Problematik
- 3.2. Der Vertrauensgeber
- 3.3. Der Vertrauensnehmer
- 4. Reputation als Beitrag zum Vertrauen
- 5. Funktionen von Vertrauen
- 5.1. Abbau von Informationsdefiziten
- 5.2. Einsparung von Transaktionskosten
- 5.3. Aufrechterhaltung der Märkte
- 6. Objekte des Vertrauens
- 6.1. Vertrauen in Institutionen
- 6.2. Vertrauen in den Staat
- 7. Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, den Begriff des Vertrauens zu definieren und seine Entstehung in wirtschaftlichen Kontexten zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Rolle von Vertrauen im Kontext der Prinzipal-Agenten-Theorie und beleuchtet die Bedeutung von Reputation. Zusätzlich werden die Funktionen von Vertrauen und seine Auswirkungen auf Märkte erörtert, mit einem Fokus auf Vertrauen in Institutionen und den Staat.
- Definition und Entstehung von Vertrauen
- Vertrauen in der Prinzipal-Agenten-Theorie
- Die Rolle von Reputation
- Funktionen von Vertrauen und Marktwirkungen
- Vertrauen in Institutionen und den Staat
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thematik und Aufbau der Arbeit: Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Vertrauen, wobei die Bedeutung von Vertrauen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext hervorgehoben wird. Einleitend wird anhand eines aktuellen Beispiels (Entlassung von Florian Gerster) die Brisanz des Vertrauensmangels in staatliche Institutionen verdeutlicht. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau und die Zielsetzung der Untersuchung.
2. Der Begriff des Vertrauens: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs „Vertrauen“ im ökonomischen Kontext. Es wird der Unterschied zwischen dem theoretischen Modell des „homo oeconomicus“ und dem realen Marktverhalten, welches durch Unsicherheit und Intransparenz geprägt ist, herausgearbeitet. Die Entstehung von Vertrauen wird im Zusammenhang mit der Komplexität der Umwelt und der Notwendigkeit zur Reduktion von Unsicherheiten erklärt. Ein Beispiel für die Reduktion von Unsicherheiten durch Vertrauen ist das Vertrauen in die Polizei, allein aufgrund der Uniform, ohne Hinterfragen der Person in der Uniform.
Schlüsselwörter
Vertrauen, Prinzipal-Agenten-Theorie, Reputation, Transaktionskosten, Institutionen, Staat, Markt, Unsicherheit, Informationsdefizite, homo oeconomicus.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Vertrauen. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Schlüsselwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Definition und Entstehung von Vertrauen, seiner Rolle in der Prinzipal-Agenten-Theorie, der Bedeutung von Reputation, den Funktionen von Vertrauen und seinen Auswirkungen auf Märkte, insbesondere in Bezug auf Vertrauen in Institutionen und den Staat.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Definition und Entstehung von Vertrauen (inkl. der Rolle von Komplexität und Risiko), die Prinzipal-Agenten-Theorie im Zusammenhang mit Vertrauen, die Bedeutung von Reputation, die Funktionen von Vertrauen (z.B. Abbau von Informationsdefiziten, Einsparung von Transaktionskosten), und die Auswirkungen von Vertrauen auf Märkte. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vertrauen in Institutionen und den Staat.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung in die Thematik und den Aufbau. Es folgen Kapitel zur Definition und Entstehung von Vertrauen, zur Prinzipal-Agenten-Theorie, zur Rolle der Reputation, zu den Funktionen von Vertrauen und schließlich zu den Objekten des Vertrauens (Institutionen und Staat). Die Arbeit endet mit einer Schlussbemerkung, einem Literaturverzeichnis und einem Abbildungsverzeichnis.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Es wird eine Zusammenfassung des ersten Kapitels („Thematik und Aufbau der Arbeit“) und des zweiten Kapitels („Der Begriff des Vertrauens“) gegeben. Kapitel 1 führt in das Thema ein und verdeutlicht die Relevanz des Themas anhand eines aktuellen Beispiels. Kapitel 2 befasst sich mit der Definition von Vertrauen im ökonomischen Kontext und dem Unterschied zwischen theoretischem Modell und realem Marktverhalten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Vertrauen, Prinzipal-Agenten-Theorie, Reputation, Transaktionskosten, Institutionen, Staat, Markt, Unsicherheit, Informationsdefizite, homo oeconomicus.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Begriff des Vertrauens zu definieren, seine Entstehung in wirtschaftlichen Kontexten zu untersuchen und seine Rolle im Kontext der Prinzipal-Agenten-Theorie und die Bedeutung von Reputation zu analysieren. Die Funktionen von Vertrauen und seine Auswirkungen auf Märkte, mit besonderem Fokus auf Vertrauen in Institutionen und den Staat, werden ebenfalls erörtert.
Wie wird Vertrauen definiert?
Das Dokument geht auf die Definition von Vertrauen im ökonomischen Kontext ein. Es wird der Unterschied zum Modell des „homo oeconomicus“ und die Entstehung von Vertrauen im Kontext von Komplexität und Unsicherheit erklärt.
Welche Rolle spielt die Prinzipal-Agenten-Theorie?
Die Arbeit analysiert die Rolle von Vertrauen im Kontext der Prinzipal-Agenten-Theorie, beleuchtet die Problematik und untersucht die Perspektive des Vertrauensgebers und des Vertrauensnehmers.
- Quote paper
- Beate Breitbach (Author), 2004, Vertrauen - Begriff und Wirkungszusammenhänge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40190