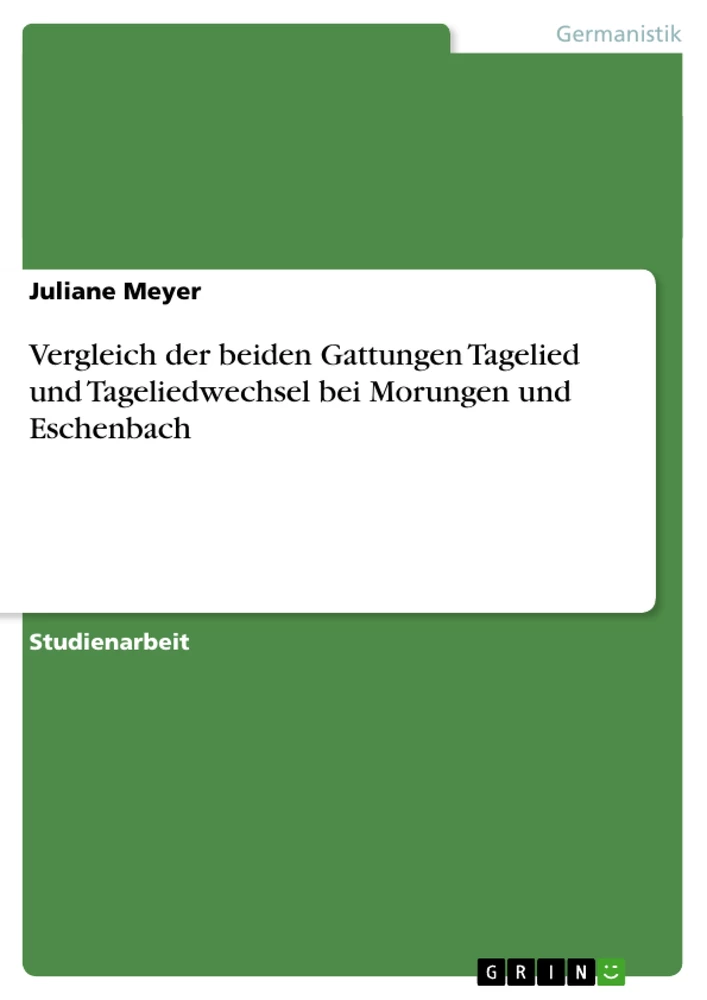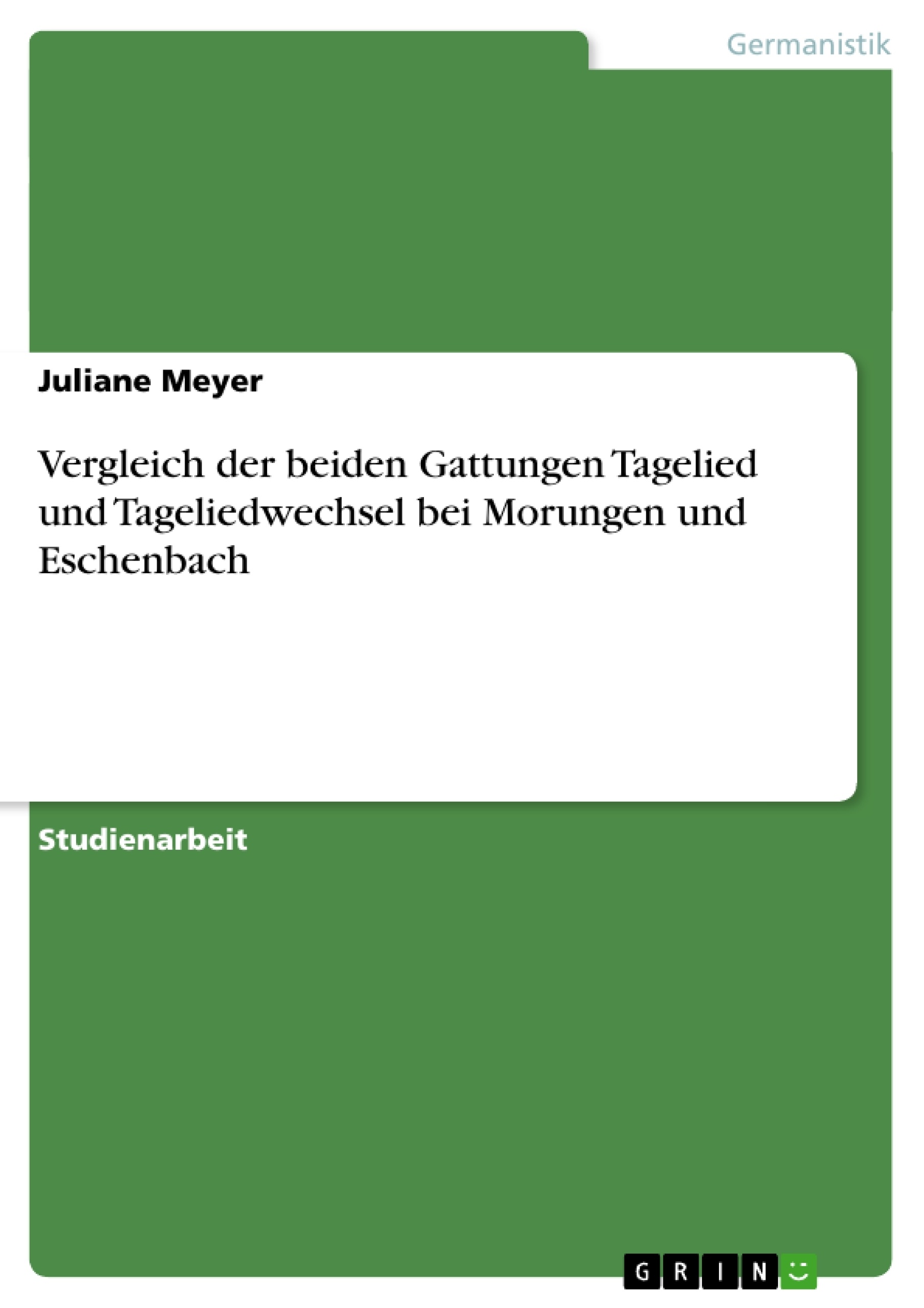Wolfram von Eschenbach (ca. 1190-1220), der Dichter des „Parzival“, hat wenige Lieder geschrieben, zumeist Tagelieder. Diese Gattung, die in Spannung zum Hohen Sang steht, weil sie von der heimlichen Erfüllung der Liebe in einer verbotenen Nacht zwischen Ritter und Herrin spricht, kommt bei Wolfram von Eschenbach voll zur Geltung. Heinrich von Morungen (1200-1222) pries am Hofe die „Hohe Minne“. Seine 33 überlieferten Minnelieder sind in Form (Kanzonenform) und Inhalt von der provenzalischen Troubadourdichtung beeinflusst und bilden den Höhepunkt des mittelalterlichen Minnesangs. Seine Lieder sind sowohl durch die antike Tradition als auch durch die religiöse Lyrik geprägt. 1 Ziel dieser Arbeit ist der Vergleich der Lieder von Wolfram von Esche nbach „Den morgenblic bî wahtaeres“ und Heinrich von Morungen „Owé, sol aber mir iemer mê“ unter Berücksichtigung der Gattungsbegriffe Tagelied und Wechsel, beziehungsweise der Sonderform Tageliedwechsel in Heinrich von Morungens Lied „Owé, sol aber mir iemer mê“. Im Folgenden sollen die beiden Lieder hinsichtlich ihres Inhalts interpretiert werden. Dabei soll darauf eingegangen werden, inwieweit Wolframs Lied der allgemeinen Definition des Tagelieds entspricht und wie Morungens Lied diese Gattung mit dem Wechsel verbindet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Minnesang
- Begriffserläuterung
- Tagelied
- Wechsel
- Wolfram von Eschenbach „Dem morgenblic bî wahtaeres“
- Formanalyse
- Inhaltsanalyse
- Beschreibung der Situation
- Interpretation
- Heinrich von Morungen „Owé, sol aber mir iemer mê“
- Formanalyse
- Inhaltsanalyse
- Beschreibung der Situation
- Interpretation
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Lieder „Dem morgenblic bî wahtaeres sange erkôs“ von Wolfram von Eschenbach und „Owé, sol aber mir iemer mê“ von Heinrich von Morungen zu vergleichen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Gattungen Tagelied und Wechsel, insbesondere der Verbindung beider in Morungens Lied. Die Interpretation des Inhalts beider Lieder soll Aufschluss darüber geben, inwieweit Wolframs Lied der Definition des Tagelieds entspricht und wie Morungens Lied diese Gattung mit dem Wechsel verbindet.
- Vergleich der Lieder von Wolfram von Eschenbach und Heinrich von Morungen
- Analyse der Gattung Tagelied
- Untersuchung der Gattung Wechsel
- Interpretation des Inhalts beider Lieder
- Verbindung von Tagelied und Wechsel in Morungens Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die beiden zu vergleichenden Lieder von Wolfram von Eschenbach und Heinrich von Morungen vor. Sie skizziert die Bedeutung des Tagelieds im Kontext des Minnesangs und hebt die unterschiedlichen poetischen Hintergründe der beiden Autoren hervor, wobei Wolframs eher spärliches lyrisches Schaffen im Kontrast zu Morungens umfangreichem Werk steht. Der Forschungsfokus liegt auf der Gattungsanalyse und der Interpretation der Lieder im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit oder Abweichung von den gattungsspezifischen Merkmalen.
Minnesang: Dieses Kapitel bietet eine Begriffserklärung des Minnesangs als höfische Liebeslyrik des Mittelalters. Es beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Kontexte, die Entstehungsgeschichte und die formalen Merkmale, insbesondere die dreigeteilte Strophenform. Der Abschnitt über das Tagelied beschreibt seine Struktur, die typischen Figuren (Ritter, Dame, Wächter) und den zentralen Konflikt der Trennung am Morgen. Der Abschnitt über den Wechsel erklärt diese Liedform als Kombination von Männer- und Frauenstrophen, die nicht als Dialog, sondern als Selbstgespräche angelegt sind. Die Ausführungen legen die Grundlage für den Vergleich der beiden Lieder im Hinblick auf ihre Einordnung in diese Gattungen.
Wolfram von Eschenbach „Dem morgenblic bî wahtaeres“: Die Formanalyse dieses Kapitels untersucht die Struktur und die formalen Eigenschaften von Wolframs Lied. Die Inhaltsanalyse hingegen konzentriert sich auf die Beschreibung der dargestellten Situation und deren Interpretation im Kontext der Tagelied-Gattung. Es wird analysiert, wie Wolfram die Elemente des klassischen Tagelieds verwendet und welche Besonderheiten sein Werk aufweist. Die Interpretation beleuchtet die Bedeutung der beschriebenen Situation und die zugrundeliegenden Emotionen der beteiligten Figuren.
Heinrich von Morungen „Owé, sol aber mir iemer mê“: Analog zum vorherigen Kapitel wird hier Heinrich von Morungens Lied analysiert. Die Formanalyse konzentriert sich auf die strukturellen Eigenheiten des Liedes, während die Inhaltsanalyse die Situation beschreibt und interpretiert. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Verbindung von Tagelied und Wechsel und der Analyse, wie Morungen diese beiden Gattungen in seinem Lied kombiniert und welche Wirkung dies erzielt. Die Interpretation berücksichtigt die Besonderheiten des „Tageliedwechsels“ und dessen Bedeutung im Gesamtkontext des mittelalterlichen Minnesangs.
Schlüsselwörter
Minnesang, Tagelied, Wechsel, Wolfram von Eschenbach, Heinrich von Morungen, mittelhochdeutsche Lyrik, Formanalyse, Inhaltsanalyse, Gattungsmerkmale, höfische Liebe, Trennung, Morgen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Lieder "Dem morgenblic bî wahtaeres" und "Owé, sol aber mir iemer mê"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und vergleicht zwei mittelhochdeutsche Lieder: "Dem morgenblic bî wahtaeres sange erkôs" von Wolfram von Eschenbach und "Owé, sol aber mir iemer mê" von Heinrich von Morungen. Der Fokus liegt auf der Gattungszuordnung (Tagelied und Wechsel), der Formanalyse und der Interpretation des Inhalts beider Gedichte.
Welche Gattungen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Gattungen Tagelied und Wechsel. Es wird erklärt, was diese Gattungen im Kontext des Minnesangs bedeuten, welche typischen Merkmale sie aufweisen und wie diese in den analysierten Liedern zum Ausdruck kommen. Besonders wird die Kombination von Tagelied und Wechsel in Morungens Lied untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Minnesang (mit Unterkapiteln zu Tagelied und Wechsel), Einzelanalysen der beiden Lieder (Formanalyse und Inhaltsanalyse) und eine abschließende Reflexion. Jedes Lied wird separat hinsichtlich seiner formalen Struktur und seines Inhalts untersucht und im Kontext der jeweiligen Gattung interpretiert.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist der Vergleich der beiden Lieder von Wolfram von Eschenbach und Heinrich von Morungen. Es soll untersucht werden, inwieweit Wolframs Lied der Definition des Tagelieds entspricht und wie Morungens Lied die Gattungen Tagelied und Wechsel verbindet. Die Arbeit analysiert die Übereinstimmung mit oder Abweichung von den gattungsspezifischen Merkmalen.
Welche Aspekte der Lieder werden analysiert?
Die Analyse umfasst sowohl die Formanalyse (Struktur, Metrik, Reimschema etc.) als auch die Inhaltsanalyse (Beschreibung der Situation, Interpretation der Bedeutung, der Emotionen und der Figuren). Die Interpretation der Lieder wird im Kontext des mittelalterlichen Minnesangs und der spezifischen Merkmale der Gattungen Tagelied und Wechsel vorgenommen.
Wie werden Tagelied und Wechsel definiert?
Das Tagelied wird als eine Liedform des Minnesangs definiert, die die Trennung von Liebenden am Morgen thematisiert. Typische Figuren sind ein Ritter, eine Dame und ein Wächter. Der Wechsel hingegen ist eine Liedform, die sich aus abwechselnden Strophen von Mann und Frau zusammensetzt, die aber nicht als Dialog, sondern als Selbstgespräche angelegt sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Minnesang, Tagelied, Wechsel, Wolfram von Eschenbach, Heinrich von Morungen, mittelhochdeutsche Lyrik, Formanalyse, Inhaltsanalyse, Gattungsmerkmale, höfische Liebe, Trennung, Morgen.
Was ist die Bedeutung der Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels und bietet eine prägnante Darstellung der wichtigsten Punkte der Analyse. Sie dient dem schnellen Verständnis des Aufbaus und der Argumentationslinie der Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Juliane Meyer (Autor:in), 2002, Vergleich der beiden Gattungen Tagelied und Tageliedwechsel bei Morungen und Eschenbach, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40146