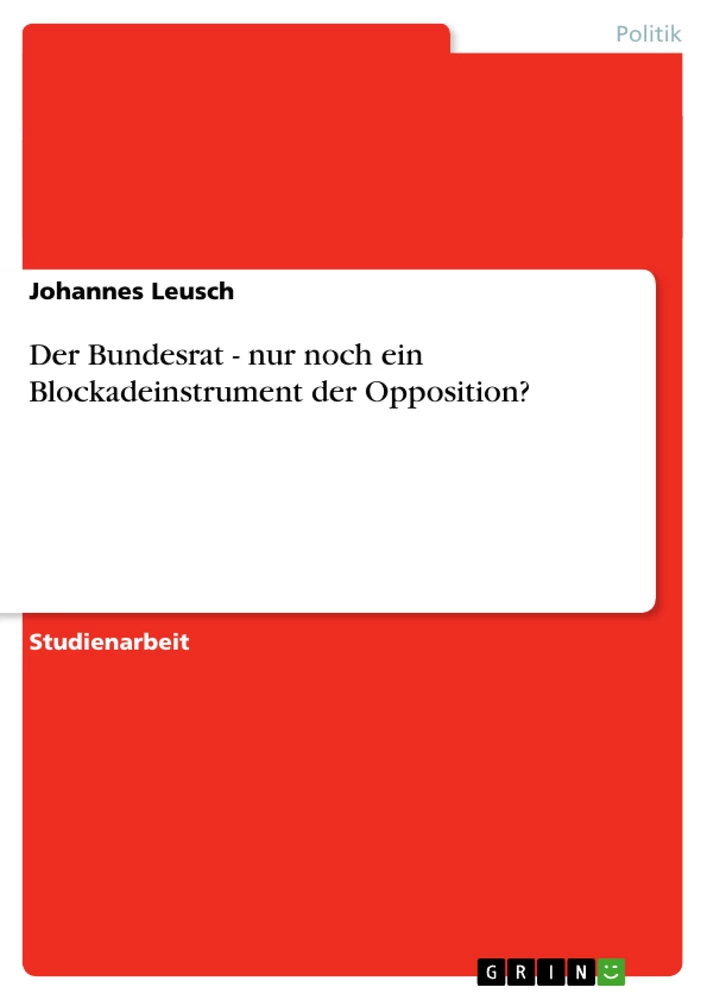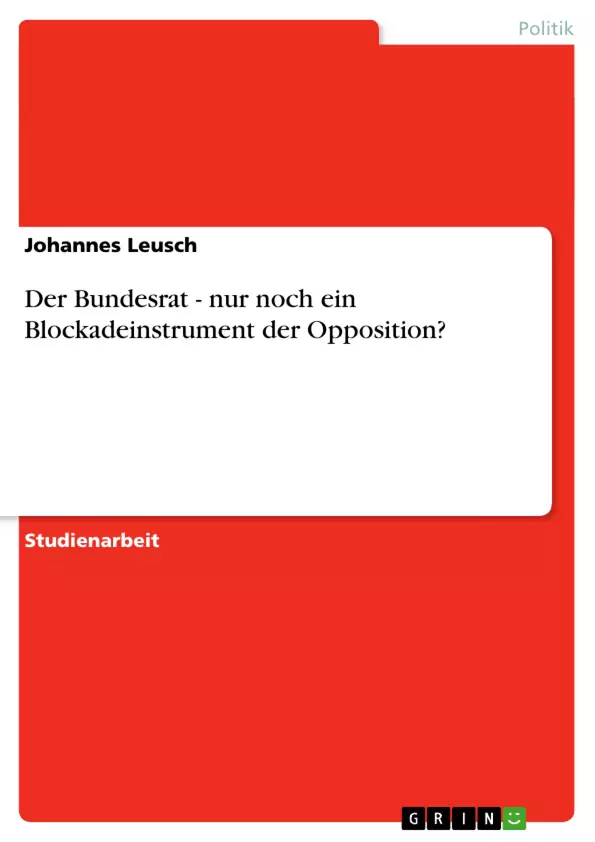Fast täglich sieht und hört man in den Medien Diskussionen des Bundestags in denen um Reformen oder Gesetzesvorlagen gestritten wird. Gerade bei brisanten Themen wie Einwanderung, Arbeitsmarktpolitik oder Gesundheitspolitik enden die Diskussionen oft damit, dass die vom Bundestag beschlossenen Vorhaben im Bundesrat vorerst abgelehnt werden. Dabei fällt immer wieder das Wort Blockadepolitik, das bedeutet, dass die Oppositionsparteien versuchen, mit ihren Bundesratstimmen die Vorhaben der Regierung zu stoppen. Der Bundesrat wurde 1949 durch die Verfassung gegründet, er dient als Repräsentant des föderativen Prinzips. Der Bundesrat besteht aus Vertretern der einzelnen Länderegierungen. Die Anzahl der jeweiligen Sitze und damit auch Stimmen, jeder Sitz hat eine Stimme, ist abhängig von den Einwohnerzahlen der Länder, sie beträgt zwischen 3 und 6 Stimmen pro Land. Die Hauptaufgaben des Bundesrats sind im Grundgesetz festgeschrieben. Darunter fällt zum Einen, administrative Gesichtspunkte in den Entscheidungsprozeß des Bundes einzubringen und zum Anderen, den Föderalismus gegen eine Aushöhlung durch den Bundesgesetzgeber abzuschirmen. Gesetze, welche die Verfassung ändern, oder die Länderhoheit beeinträchtigen, bedürfen der Zustimmung des Bundesrats. Der Bundesrat muss den zustimmungspflichtigen Gesetzen mit der absoluten Mehrheit seiner Stimmen zustimmen. Enthaltungen gelten somit wie Gegenstimmen. Einspruchsgesetze können vom Bundesrat faktisch nicht blockiert werden und spielen deshalb in der Thematik der Blockadepolitik keine Rolle. In den Sitzungen des Bundesrats wird über die bereits bekannten und in der Landesregierung abgesprochenen Vorlagen abgestimmt. Die Abgeordneten des Bundesrats werden von der jeweiligen Landesregierung bestimmt und sind bilden somit nicht repräsentativ die jeweiligen Machtverhältnisse des Landtags ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff Gesetzesblockade
- 2.1. Blockade wegen landespolitischen Interessen
- 2.2. Blockade wegen parteipolitischen Interessen
- 3. Die statistische Blockadebilanz
- 4. Das Abstimmungsverhalten des Bundesrats in der politischen Praxis
- 4.1. 1970 bis 1982 - Blockadepolitik der CDU/CSU Opposition unter der SPD/FDP geführten Regierung Brandt und Schmidt
- 4.2. 1990 bis 1998 - Blockadepolitik der SPD Opposition unter der CDU/CSU/FDP geführten Regierung Kohl
- 4.3. 2000 bis 2004 - Blockadepolitik der CDU/CSU Opposition unter der SPD/Grüne geführten Regierung Schröder
- 5. Reformansätze
- 5.1. Bertelsmann-Kommission unter Vorsitz von Werner Weidenfeld
- 5.2. Experten-Kommission unter Vorsitz von Dr. Otto Graf Lambsdorf
- 5.3. Stoiber-Müntefering Kommission
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Abstimmungsverhalten des Bundesrates, insbesondere die Frage, ob er als Instrument der Oppositionsblockade genutzt wird. Es wird analysiert, inwieweit landespolitische und parteipolitische Interessen die Entscheidungen des Bundesrates beeinflussen. Die Untersuchung stützt sich auf statistische Daten und die Analyse von konkreten politischen Ereignissen.
- Analyse des Begriffs "Gesetzesblockade" und der Unterscheidung zwischen landespolitischen und parteipolitischen Motiven.
- Statistische Auswertung der Blockadehäufigkeit im Bundesrat seit 1949.
- Untersuchung des Abstimmungsverhaltens des Bundesrates in verschiedenen Regierungsperioden.
- Bewertung von Reformansätzen zur Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Bundestag und Bundesrat.
- Abschließende Bewertung der Rolle des Bundesrates im politischen System der Bundesrepublik Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gesetzesblockaden im Bundesrat ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle des Bundesrates als Blockadeinstrument der Opposition. Sie beschreibt die Entstehung und die institutionelle Einbettung des Bundesrates, seine Aufgaben und seine Zusammensetzung. Die Einleitung hebt die scheinbare Häufung von Ablehnungen von Gesetzesvorhaben hervor, insbesondere wenn die Opposition im Bundesrat die Mehrheit hat, und kündigt die anschließende Untersuchung des Abstimmungsverhaltens an.
2. Der Begriff Gesetzesblockade: Dieses Kapitel präzisiert den Begriff der Gesetzesblockade. Es definiert die Bedingungen für eine Blockade und differenziert zwischen Blockaden aufgrund landespolitischer und parteipolitischer Interessen. Landespolitische Interessen beziehen sich auf Konflikte zwischen Bund und Ländern bezüglich Kompetenzen oder Finanzen, während parteipolitische Blockaden durch die Opposition ohne erkennbare landespolitische Gründe erfolgen.
3. Die statistische Blockadebilanz: Dieses Kapitel präsentiert eine statistische Analyse der Blockaden im Bundesrat seit 1949. Es untersucht die Häufigkeit von Blockaden im Kontext von zustimmungspflichtigen Gesetzen und stellt die Daten in Relation zur Gesamtzahl der vorgelegten Gesetzesvorlagen. Dabei wird der Unterschied zwischen Blockaden in Phasen unterschiedlicher Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat herausgearbeitet.
4. Das Abstimmungsverhalten des Bundesrats in der politischen Praxis: Dieses Kapitel analysiert das Abstimmungsverhalten des Bundesrates in verschiedenen Phasen der bundesdeutschen Geschichte, wobei verschiedene Regierungsperioden mit unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat betrachtet werden. Es werden konkrete Beispiele für Blockadepolitik der Opposition unter verschiedenen Regierungen genannt und deren Motive analysiert.
Schlüsselwörter
Bundesrat, Gesetzesblockade, Landesinteressen, Parteipolitik, Opposition, Regierungskoalition, Föderalismus, Abstimmungsverhalten, Reformansätze, Vermittlungsausschuss.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Abstimmungsverhaltens des Bundesrates
Was ist der Gegenstand dieser Analyse?
Diese Arbeit untersucht das Abstimmungsverhalten des Bundesrates, insbesondere die Frage, ob er als Instrument der Oppositionsblockade genutzt wird. Analysiert werden die Einflüsse landespolitischer und parteipolitischer Interessen auf die Entscheidungen des Bundesrates. Die Untersuchung basiert auf statistischen Daten und der Analyse konkreter politischer Ereignisse.
Welche Aspekte des Begriffs "Gesetzesblockade" werden behandelt?
Der Begriff "Gesetzesblockade" wird präzisiert. Es wird definiert, was eine Blockade ausmacht und zwischen Blockaden aufgrund landespolitischer (Konflikte Bund-Länder) und parteipolitischer Interessen (Opposition ohne landespolitische Gründe) unterschieden.
Welche statistischen Daten werden verwendet?
Die Analyse beinhaltet eine statistische Auswertung der Blockadehäufigkeit im Bundesrat seit 1949. Die Daten zur Häufigkeit von Blockaden bei zustimmungspflichtigen Gesetzen werden in Relation zur Gesamtzahl der vorgelegten Gesetzesvorlagen gesetzt. Der Unterschied zwischen Blockaden in Phasen unterschiedlicher Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat wird herausgearbeitet.
Welche Regierungsperioden werden untersucht?
Das Abstimmungsverhalten des Bundesrates wird in verschiedenen Phasen der bundesdeutschen Geschichte analysiert. Konkret werden Regierungsperioden mit unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat betrachtet, beispielsweise die Blockadepolitik der CDU/CSU-Opposition unter den Regierungen Brandt und Schmidt, Kohl und Schröder.
Welche Reformansätze werden diskutiert?
Die Arbeit bewertet Reformansätze zur Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Bundestag und Bundesrat. Genannt werden unter anderem die Bertelsmann-Kommission (Weidenfeld), die Experten-Kommission (Lambsdorf) und die Stoiber-Müntefering-Kommission.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Begriff Gesetzesblockade, Die statistische Blockadebilanz, Das Abstimmungsverhalten des Bundesrates in der politischen Praxis, Reformansätze und Fazit. Jedes Kapitel fasst seine Kernaussagen zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bundesrat, Gesetzesblockade, Landesinteressen, Parteipolitik, Opposition, Regierungskoalition, Föderalismus, Abstimmungsverhalten, Reformansätze, Vermittlungsausschuss.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Landes- und Parteiinteressen auf das Abstimmungsverhalten des Bundesrates und bewertet dessen Rolle als mögliches Instrument der Oppositionsblockade im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Sie bewertet auch Reformansätze zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bundestag und Bundesrat.
- Citation du texte
- Johannes Leusch (Auteur), 2005, Der Bundesrat - nur noch ein Blockadeinstrument der Opposition?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39869