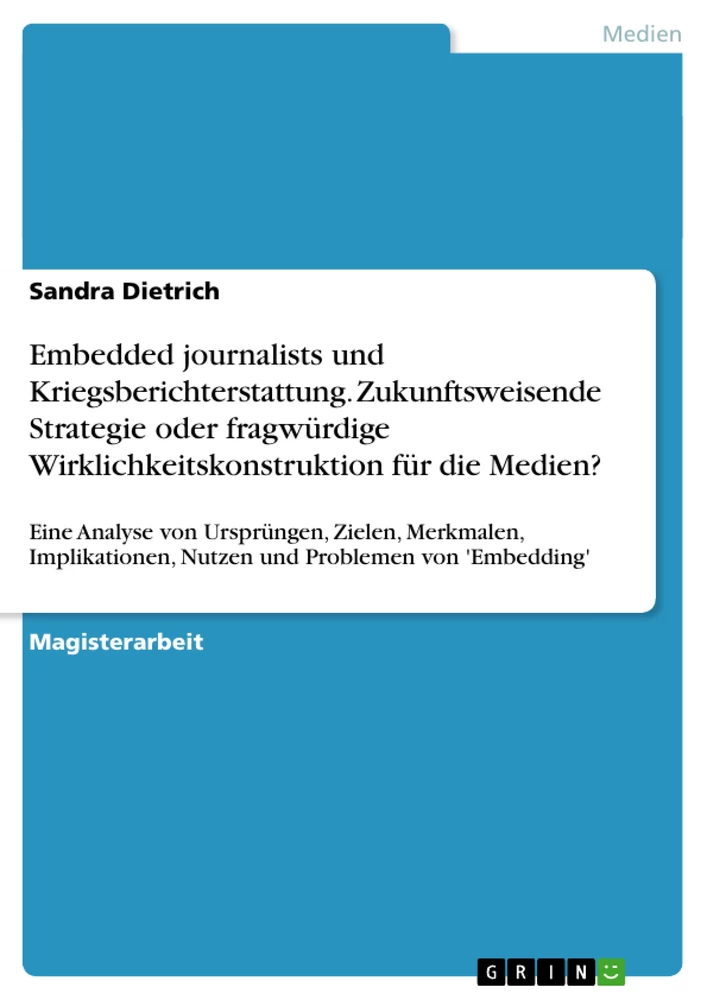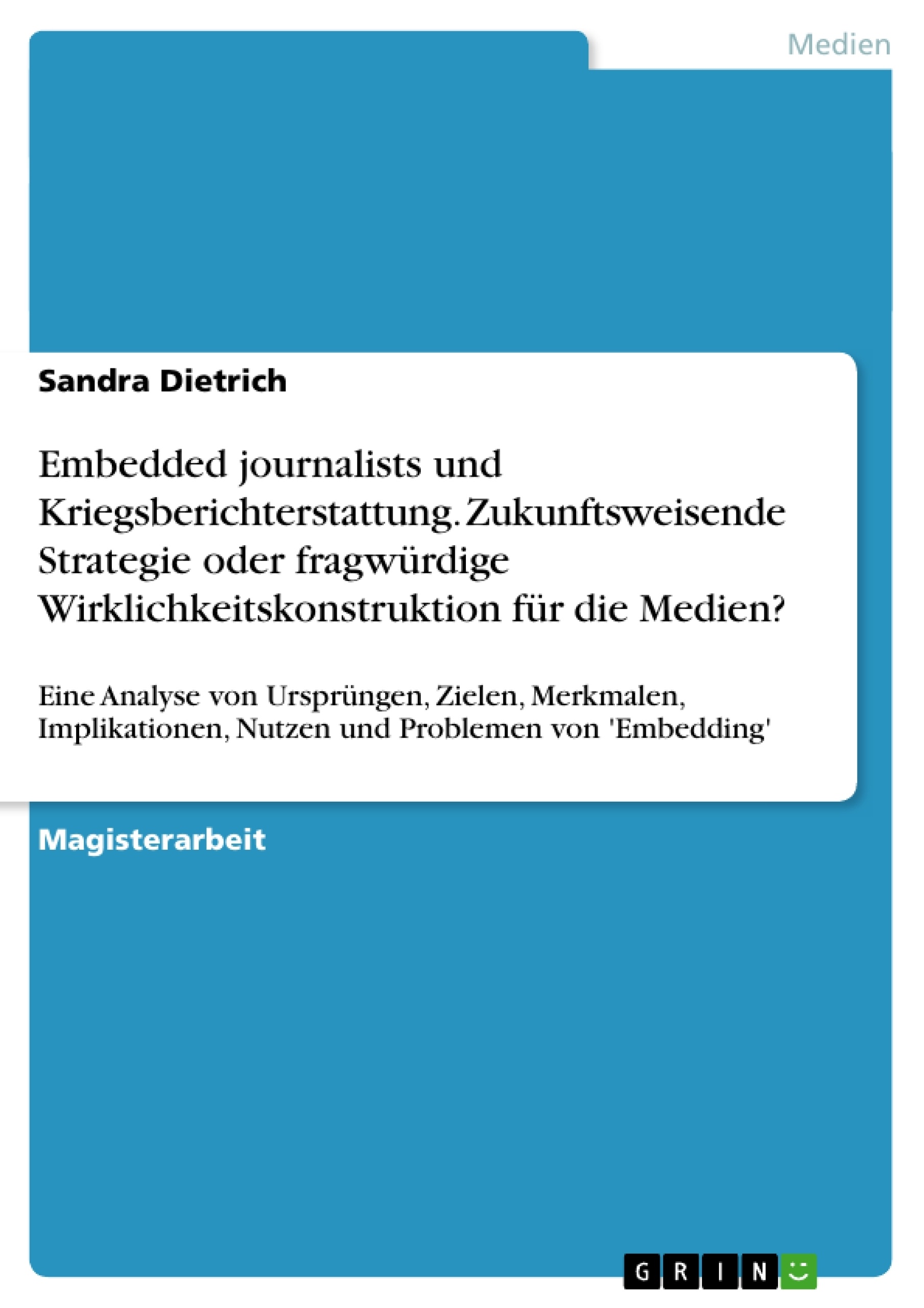[...] Nie zuvor waren Journalisten in einem Krieg mit ausdrücklicher Genehmigung des Militärs so nah am Geschehen und noch nie zuvor gab es so viele Berichte von der Front wie im Irak-Krieg. Dennoch wurde das Einbetten von Reportern in das Militär heftig diskutiert. Kritiker warnten, dass die eingebetteten Journalisten unter der Zensur des US-Militärs stehen und als Sprachrohr der US-Regierung fungieren würden. Ihre Berichte würden einer Sportberichterstattung ähneln, einseitige Perspektiven produzieren und den Krieg verherrlichen, lauteten die Vorwürfe. Befürworter des Konzepts priesen embedding als einzigartige Augenzeugenschaft für Kriegsereignisse, die den Zuschauern in Echtzeit faszinierende Bilder und Berichte von der Front sowie einmalige Einblicke in die Realität des Krieges bieten würde. Die Meinungen der Medienkritiker beiderseitig des Atlantiks waren äußerst divergierend. Für das US-Militär hingegen war das Konzept des embedded journalism ein voller Erfolg. Das Militär hätte seine Verpflichtung, den Medien Zugang zum Kampfgebiet zu ermöglichen, erfüllt und zugleich militärische Informationen geheim halten können. Zudem seien die Falschinformationen und Propaganda des irakischen Regimes mithilfe von eingebetteten Journalisten aufgedeckt worden. Ansehen und Glaubwürdigkeit des US-Militärs in der Öffentlichkeit seien durch die meist positive Berichterstattung der embedded journalists gestiegen. (vgl. Paul/Kim 2004: 35-61) Die Pentagon-Sprecherin Victoria Clarke erklärte somit nach Ende der Hauptkampfhandlungen des Irak-Krieges, dass embedding ein großer Erfolg gewesen sei und auch in zukünftigen Konflikten als Medienstrategie eingesetzt werden solle. Nun eröffnet sich die Frage, ob das Konzept des embedded journalism ausschließlich als Erfolg für das Militär angesehen werden kann oder ob embedding zugleich auch für den Journalismus sowie für die Rezipienten der Berichterstattung als erfolgreich einzustufen ist. Ziel dieser Arbeit ist es demnach, die Ursprünge, Merkmale und Ziele sowie die Bedeutung der Medienstrategie des embedded journalism in der Irak-Kriegsberichterstattung zu analysieren und die Vor- und Nachteile, die sich aus diesem Konzept für die Kriegsberichterstattung ergeben, herauszuarbeiten. Am Schluss der Arbeit soll eine Einschätzung des Erfolgs oder Misserfolgs von embedding im Hinblick auf die Ansprüche von Journalisten und Rezipienten an eine Konfliktberichterstattung möglich sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Fragestellung
- 1.2. Vorgehensweise
- 2. Terminologie
- 2.1. Definition des Begriffs „Kriegsberichterstattung“
- 2.2. Relevanzkriterien der Kriegsberichterstattung
- 2.3. Qualität in der Kriegsberichterstattung
- 2.4. Definition des Begriffs „Objektivität“
- 2.5. Definition des Begriffs „Zensur“
- 3. Historiographie der Kriegsberichterstattung
- 3.1. Anfänge der Kriegsberichterstattung
- 3.2. Der Krim-Krieg – der „erste Pressekrieg“
- 3.3. Der amerikanische Sezessionskrieg
- 3.4. Das „Goldene Zeitalter“ der Kriegsberichterstattung
- 3.5. Kriegsberichterstattung im Ersten Weltkrieg
- 3.6. Kriegsberichterstattung im Zweiten Weltkrieg
- 3.7. Vietnam - der „erste Fernsehkrieg“
- 3.8. Falkland-Krieg, Grenada-Invasion und Panama-Konflikt
- 3.9. Golfkrieg 1991 – der „erste Live-Krieg“
- 3.10. Kriegsberichterstattung im Irak-Krieg 2003
- 3.11. Krieg und Medien – eine Symbiose
- 3.12. Friedensjournalismus als Alternative zum Kriegsjournalismus
- 4. Das Konzept des „Embedded journalism“ im Irak-Krieg 2003
- 4.1. Definition des Begriffs embedded journalism
- 4.2. Merkmale des embedded journalism
- 4.2.1. Prozess der Einbettung
- 4.2.2. Rechte und Pflichten von embedded journalists
- 4.2.3. Informationsbeschaffung von embedded journalists
- 4.3. Ursprung und Hintergründe des Konzepts embedded journalism
- 4.3.1. Vorläufer von embedded journalists
- 4.3.2. Prozess und Gründe der Entstehung von embedding
- 4.4. Ziele von embedding
- 4.5. Bedeutung von embedded journalists in der Irak-Berichterstattung
- 4.6. Rezeption der Berichterstattung von embedded journalists
- 4.7. Probleme des embedded journalism
- 4.7.1. Sicherheit der Journalisten
- 4.7.2. Unterschiedliche Behandlung von Journalisten
- 4.7.3. Distanzverlust
- 4.7.4. Restriktionen
- 4.7.5. Fehlender Überblick
- 4.8. Nutzen des embedded journalism
- 4.9. Reality-War-TV
- 4.10. Schlussfolgerungen für die empirischen Analysen
- 5. Methodik der empirischen Analysen
- 5.1. Befragung von embedded journalists
- 5.1.1. Auswahl der Stichprobe
- 5.1.2. Auswahl der Befragungsmethode
- 5.1.3. Konzeption des Fragebogens
- 5.1.4. Durchführung der Befragung
- 5.1.5. Auswertung der Befragung
- 5.2. Befragung von Rezipienten
- 5.2.1. Auswahl der Stichprobe
- 5.2.2. Auswahl der Befragungsmethode
- 5.2.3. Konzeption des Fragebogens
- 5.2.4. Durchführung der Befragung
- 5.2.5. Auswertung der Befragung
- 6. Präsentation der Ergebnisse
- 6.1. Ergebnisse der Befragung von embedded journalists
- 6.1.1. Informationsbeschaffung der embedded journalists
- 6.1.2. Freiheit der Berichterstattung der embedded journalists
- 6.1.3. Einhaltung journalistischer Standards
- 6.1.4. Vor- und Nachteile von embedding
- 6.1.5. Friedensjournalistischer Beitrag der eingebetteten Journalisten
- 6.1.6. Zukunftspotential von embedded journalism
- 6.2. Ergebnisse der Befragung von Rezipienten
- 6.2.1. Mediennutzung während des Irak-Krieges 2003
- 6.2.2. Kenntnis des Konzepts embedded journalism
- 6.2.3. Freiheit und Unabhängigkeit der Berichterstattung von embeds
- 6.2.4. Informationsgewinn und Glaubwürdigkeit der Berichterstattung
- 6.2.5. Vermittlung der Kriegsrealität durch eingebettete Journalisten
- 6.2.6. Friedensjournalistischer Beitrag der eingebetteten Journalisten
- 6.2.7. Zukunftspotential von embedded journalism
- 7. Diskussion der Ergebnisse
- 7.1. Erfolg von embedding aus Sicht von eingebetteten Journalisten
- 7.1.1. Informationsbeschaffung der embedded journalists
- 7.1.2. Freiheit der Berichterstattung der embedded journalists
- 7.1.3. Einhaltung journalistischer Standards
- 7.1.4. Friedensjournalistischer Beitrag der eingebetteten Journalisten
- 7.1.5. Zukunftspotential von embedded journalism
- 7.1.6. Erfolgsbewertung aus Sicht von embedded journalists
- 7.2. Erfolg von embedding aus Sicht von Rezipienten
- 7.2.1. Freiheit und Unabhängigkeit der Berichterstattung von embeds
- 7.2.2. Informationsgewinn und Glaubwürdigkeit der Berichterstattung
- 7.2.3. Vermittlung der Kriegsrealität durch eingebettete Journalisten
- 7.2.4. Friedensjournalistischer Beitrag der eingebetteten Journalisten
- 7.2.5. Zukunftspotential von embedded journalism
- 7.2.6. Erfolgsbewertung aus Sicht von Rezipienten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht das Phänomen des „Embedded Journalism“ im Irak-Krieg 2003. Ziel ist es, die Ursprünge, Ziele, Merkmale, Implikationen, den Nutzen und die Probleme dieser Berichterstattungsform zu analysieren und deren Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung des Krieges zu bewerten. Die Arbeit basiert auf empirischen Daten aus Befragungen von eingebetteten Journalisten und Rezipienten.
- Historische Entwicklung des Kriegsjournalismus
- Definition und Charakteristika von Embedded Journalism
- Auswirkungen von Embedding auf die Objektivität der Berichterstattung
- Analyse der Rezeption des Embedded Journalism durch die Öffentlichkeit
- Bewertung des Nutzens und der Risiken von Embedding für die Kriegsberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Embedded Journalism ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit. Es wird die Vorgehensweise der Untersuchung skizziert, welche die Analyse der Ursprünge, Ziele und Auswirkungen dieser Berichterstattungsform im Irak-Krieg 2003 zum Gegenstand hat. Die methodische Herangehensweise mit empirischen Befragungen von Journalisten und Rezipienten wird ebenfalls erläutert.
2. Terminologie: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie „Kriegsberichterstattung“, „Objektivität“ und „Zensur“, um ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie sicherzustellen und mögliche Missverständnisse zu vermeiden. Es werden verschiedene Aspekte dieser Begriffe beleuchtet und deren Relevanz für die Analyse des Embedded Journalism herausgestellt.
3. Historiographie der Kriegsberichterstattung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung der Kriegsberichterstattung, beginnend bei den Anfängen bis hin zum Irak-Krieg 2003. Es werden verschiedene Kriege und Konflikte als Fallbeispiele verwendet, um die evolutionären Veränderungen der Berichterstattungsmethoden und -technologien aufzuzeigen und den Kontext für das Verständnis des Embedded Journalism zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Beziehung zwischen Krieg, Medien und Öffentlichkeit.
4. Das Konzept des „Embedded journalism“ im Irak-Krieg 2003: Dieses Kapitel steht im Mittelpunkt der Arbeit und analysiert das Konzept des Embedded Journalism im Detail. Es definiert den Begriff, beschreibt die Merkmale, beleuchtet die Ursprünge und Hintergründe, untersucht die Ziele und die Bedeutung im Kontext des Irak-Krieges. Die Rezeption der Berichterstattung, die damit verbundenen Probleme (Sicherheit, Restriktionen, Distanzverlust) und der Nutzen werden umfassend diskutiert. Der Abschnitt über „Reality-War-TV“ untersucht die mediale Darstellung des Krieges durch eingebettete Journalisten.
5. Methodik der empirischen Analysen: In diesem Kapitel wird die Methodik der empirischen Untersuchung detailliert beschrieben. Es werden die Auswahl der Stichproben (eingebettete Journalisten und Rezipienten), die Befragungsmethoden und die Gestaltung der Fragebögen erläutert. Die Durchführung und Auswertung der Befragungen werden ebenfalls detailliert dargestellt, um die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Embedded Journalism, Kriegsberichterstattung, Irak-Krieg 2003, Medien, Objektivität, Zensur, Propaganda, empirische Forschung, Rezipienten, Informationsbeschaffung, Medienwirklichkeit, Friedensjournalismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Embedded Journalism im Irak-Krieg 2003
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht das Phänomen des „Embedded Journalism“ im Irak-Krieg 2003. Sie analysiert die Ursprünge, Ziele, Merkmale, Implikationen, den Nutzen und die Probleme dieser Berichterstattungsform und bewertet deren Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung des Krieges.
Welche Methoden wurden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf empirischen Daten aus Befragungen von eingebetteten Journalisten und Rezipienten. Die Methodik umfasst die Auswahl der Stichproben, die Befragungsmethoden (Art der Befragung und Fragebogenkonstruktion), die Durchführung und die Auswertung der Befragungen.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert wichtige Begriffe wie „Kriegsberichterstattung“, „Objektivität“ und „Zensur“, um ein gemeinsames Verständnis der verwendeten Terminologie zu gewährleisten und Missverständnisse zu vermeiden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Terminologie, Historiographie der Kriegsberichterstattung, Das Konzept des Embedded Journalism, Methodik der empirischen Analysen, Präsentation der Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse. Der Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Was sind die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Kriegsjournalismus, die Definition und Charakteristika von Embedded Journalism, die Auswirkungen von Embedding auf die Objektivität der Berichterstattung, die Analyse der Rezeption des Embedded Journalism durch die Öffentlichkeit und die Bewertung des Nutzens und der Risiken von Embedding für die Kriegsberichterstattung.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Befragungen von eingebetteten Journalisten und Rezipienten werden präsentiert und diskutiert. Dies umfasst Aspekte wie Informationsbeschaffung, Freiheit der Berichterstattung, Einhaltung journalistischer Standards, Vor- und Nachteile von Embedding, Friedensjournalistischer Beitrag und Zukunftspotential von Embedded Journalism.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zum Erfolg von Embedding aus der Sicht der eingebetteten Journalisten und der Rezipienten. Diese Schlussfolgerungen beziehen sich auf Informationsbeschaffung, Freiheit der Berichterstattung, Einhaltung journalistischer Standards, Friedensjournalistischen Beitrag und Zukunftspotential. Die Arbeit bewertet den Erfolg von Embedding anhand verschiedener Kriterien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Embedded Journalism, Kriegsberichterstattung, Irak-Krieg 2003, Medien, Objektivität, Zensur, Propaganda, empirische Forschung, Rezipienten, Informationsbeschaffung, Medienwirklichkeit, Friedensjournalismus.
Was ist der historische Kontext des Embedded Journalism?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die historische Entwicklung der Kriegsberichterstattung von den Anfängen bis zum Irak-Krieg 2003. Sie beleuchtet verschiedene Kriege und Konflikte, um die evolutionären Veränderungen der Berichterstattungsmethoden und -technologien aufzuzeigen und den Kontext für das Verständnis des Embedded Journalism zu schaffen.
Welche Probleme des Embedded Journalism werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Probleme des Embedded Journalism, darunter die Sicherheit der Journalisten, die unterschiedliche Behandlung von Journalisten, Distanzverlust, Restriktionen und fehlender Überblick.
- Quote paper
- Sandra Dietrich (Author), 2005, Embedded journalists und Kriegsberichterstattung. Zukunftsweisende Strategie oder fragwürdige Wirklichkeitskonstruktion für die Medien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39315